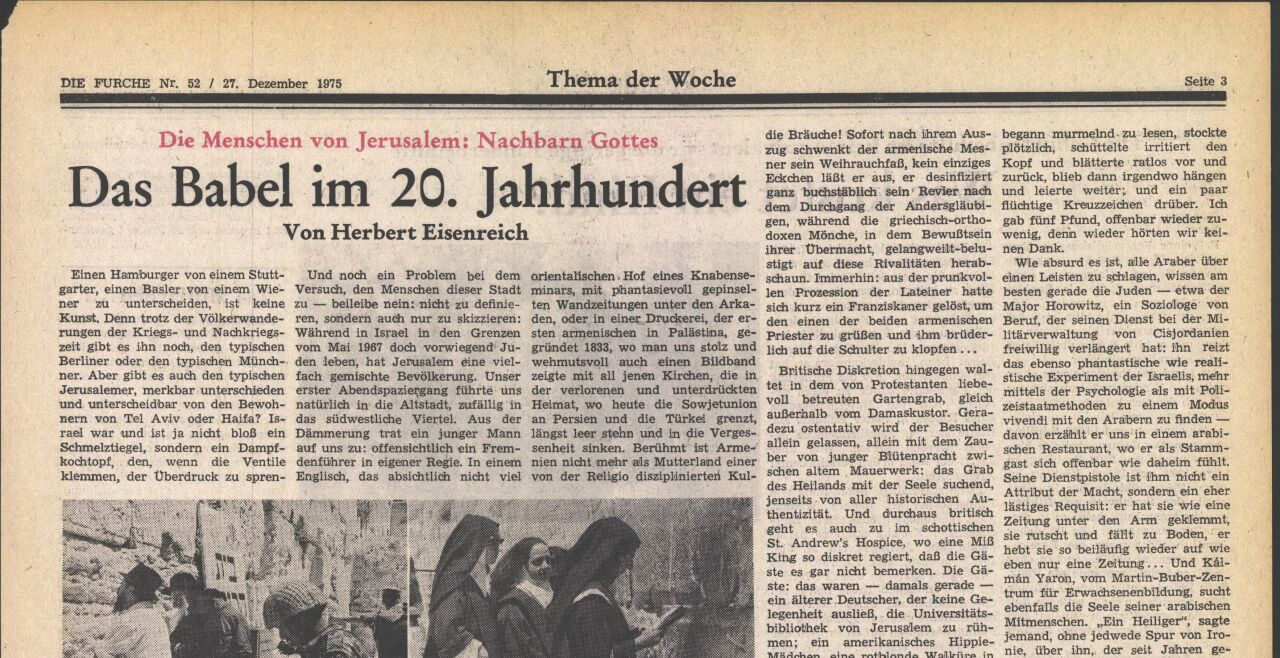
Einen Hamburger von einem Stuttgarter, einen Basler von einem Wiener zu unterscheiden, ist keine Kunst. Denn trotz der Völkerwanderungen der Kriegs- und Nachkriegszeit gibt es ihn noch, den typischen Berliner oder den typischen Münch--ner. Aber gibt es auch den typischen Jerusalemer, merkbar unterschieden und unterscheidbar von den Bewohnern von Tel Aviv oder Haifa? Israel war und ist ja nicht bloß ein Schmelztiegel, sondern ein Dampfkochtopf, den, wenn die Ventile klemmen, der Überdruck zu sprengen droht In ein ethnisch schon vorher bunt gemischtes Land haben all die Immigranten ihre kulturellen Eigenarten eingebracht und manchmal generationenlang beibehalten: der preußische Jude sein Pflichtgefühl, der jemenitische sein mittelalterliches Weltbild, der russische seinen sozialen Messianismus mitsamt seinen Zweifeln daran, der amerikanische seine Ideologie von God's own country mitsamt seinem Überdruß daran. Sie leben dort Tür an Tür und mischen sich täglich im Autobus, auf der Baustelle, im Büro, im Kino, im Restaurant, aber vielfach reden sie noch im jeweils heimischen Idiom, vom alten Jiddisch und Ladino über das völkerverbindende Englisch bis zum Ungarischen oder zum Polnischen, und weiter bis zu den arabischen Dialekten — in dieser Hinsicht ein aus dem Mythos ins 20. Jahrhundert gehobenes Babel.
Und all diese Juden sehen nun nicht nur nicht gleich, sondern auch keineswegs immer typisch jüdisch aus. Der Minister Burg, noch in Dresden geboren, erzählte uns: Wenn er durch die Frankfurter Innenstadt spaziere, werde er von zehn ihm begegnenden Juden mindestens sieben als solche erkennen. Seine Frau hingegen, deren Familie schon in der fünften Generation in Palästina lebt, finde die Juden unter den Deutschen schon nicht mehr heraus: „Die Leute hier sehen nicht anders aus als bei uns die Leute auf der Ben Yehuda.“
Und umgekehrt: Wir sind bei dem aus Wien stammenden Architekten Hoffmann und seiner ungarischen Frau zu Gast, zusammen mit einigen ihrer Freunde, darunter einem bekannten Korrespondenten aus der alten Prager Schule des Journalismus. Obwohl all diese Leute schon seit Jahrzehnten in Palästina ansässig sind, befinden wir uns plötzlich in jenem Klima bester bürgerlicher Intelligenz, das in dem magischen Dreieck Wien—Prag—Budapest das Ende der Monarchie überdauert hat und erst von Hitler verpestet worden ist. Kaum etwas gemahnt an Israel, überhaupt nichts an das Israel-Klischee, zumal die Damen /Nachmittagskleid mit passenden Accessoires und die Herren Sakko und Krawatte tragen. Und. wie diese kleine Gesellschaft, so wirkt ganz Jerusalem überhaupt viel weniger hemdsärmelig als Tel Aviv oder Haifa — und das gewiß nicht nur aus klimatischen Gründen.
Und noch ein Problem bei dem Versuch, den Menschen dieser Stadt zu — beileibe nein: nicht zu definieren, sondern auch nur zu skizzieren: Während in Israel in den Grenzen vom Mai 1967 doch vorwiegend Juden leben, hat Jerusalem eine vielfach gemischte Bevölkerung. Unser erster Abendspazieijgang führte uns natürlich in die Altstadt, zufällig in das südwestliche Viertel. Aus der Dämmerung trat ein junger Mann auf uns zu: offensichtlich ein Fremdenführer in eigener Regie. In einem Englisch, das absichtlich nicht viel besser war-als das seine, lehnten wir dankend ab — im Nahen Osten waren wir oft genug schon gewürzt worden. Der junge Mann aber: ließ sich, ohne deswegen eigentlich : indiskret zu sein, nicht abschütteln, und sagte, endlich kapierend, daß er ja keineswegs Geld erbetteln, sondern uns etwas zeigen und etwas erzählen wolle von seinem Volk und von den kultischen und kulturellen Zeugnissen seines Volkes hier im armenischen Viertel, und endlich kapierten auch wir. Der junge Mann — ein Gymnasiast, wie sich dann herausstellte t-war weder Jude noch Araber, son--dern ein Armenier, hier in Jerusalem wohnhaft, doch mit jordanischem Paß, wenn auch ohne besondere Sympathie für den Staat König Husseins. Auf einen beschädigten Kirchturm deutend, sagte er kalt: „Das waren jordanische, nicht israelische Granaten.“ Im Grunde aber wollte er, radebrechend, nichts weiter, als uns Mitteleuropäer erinnern an die geistige und geistliche Kultur seines Volkes und an dessen blutiges Schicksal unter der türkischen Herrschaft: an diese der Welt kaum bekannte Analogie zu dem jüdischen Schicksal.
Später dann nahmen wir tiefere Einblicke in die armenische Welt von Jerusalem: gegen ein anfängliches Mißtrauen, das aber meist bald der Sachlichkeit, endlich der Freundlichkeit wich. So erging es uns zwischen den kühlen Klostermauern, in dem säuberlich gepflegten, also gar nicht orientalischen, Hof eines Knabenseminars, mit phantasievoll gepinselten Wandzeitungen unter den Arkaden, oder in einer Druckerei, der ersten armenischen in Palästina, gegründet 1833, wo man uns stolz und wehmutsvoll auch einen Bildband zeigte mit all jenen Kirchen, die in der verlorenen und unterdrückten Heimat, wo heute die Sowjetunion an Persien und die Türkei grenzt, längst leer stehn und in die Vergessenheit sinken. Berühmt ist Armenien nicht mehr als Mutterland einer von der Religio disziplinierten Kultur, sondern nur noch durch die Ra-dio-Eriwan-Witze...
Die Christen fallen in und um Jerusalem zwar nicht zahlenmäßig, aber durch ihre zahlreichen und pompösen Institute auf, in die mehr als zwei Dutzend Konfessionen sich teilen, mit vertraglich geregelten prozentuellen Besitz- und Benützungsrechten an diesem Altar und an jenem Portal, an dieser Treppe und an jenem Vorhang. Dieser sogenannte „Status quo“ (von 1757) hindert freilich die“ geistlichen Herren jeglicher christlichen Observanz nicht daran, einander gelegentlich eine leere Bierflasche an den Schädel zu knallen; ja, er konnte nicht einmal den Krimkrieg Verhindern: Der den römischen Katholiken gehörende silberne Stern in der Geburtsgrotte zu Bethlehem war von den griechischen Christen entwendet worden, was zu internationalen Spannungen führte, die von der Diplomatie allein nicht mehr gelöst werden konnten... Die Geburtskirche selbst gehört mehrheitlich den Griechisch-orthodoxen, in dem kleinen Seitenschiff links von der Geburtsgrotte fristen armenische Mönche ihr Dasein. Durch dieses Seitenschiff sahen wir an irgendeinem Freitagnachmittag die römischen Katholiken, mit ungeheurem Gesang und Geläut', aus ihrem eigenen Gotteshaus zu der Grotte und dann wieder heimwärt wallen, alles unter Vorantritt zweier kostümierter Zeremonienmeister, die auch in der römischen Kirche den Fez auf dem Kopf behalten — so streng sind dort die Bräuche! Sofort nach ihrem Auszug schwenkt der armenische Mesner sein Weihrauchfaß, kein einziges Eckchen läßt er aus, er desinfiziert ganz buchstäblich sein - Revier nach dem Durchgang der Andersgläubigen, während die griechisch-orthodoxen Mönche, in dem Bewußtsein ihrer Übermacht, gelangweilt-belu-stigt auf diese Rivalitäten herab-schaun. Immerhin: aus der prunkvollen Prozession der Lateiner hatte sich kurz ein Franziskaner gelöst, um den einen der beiden armenischen Priester zu grüßen und ihm brüderlich auf die Schulter zu klopfen ...
Britische Diskretion hingegen waltet in dem von Protestanten liebevoll betreuten Gartengrab, gleich außerhalb vom Damaskustor. Geradezu ostentativ wird der Besucher allein gelassen, allein mit dem Zauber von junger Blütenpracht zwischen altem Mauerwerk: das Grab des Heilands mit der Seele suchend, jenseits von aller historischen Authentizität. Und durchaus britisch geht es auch zu im schottischen St. Andrew's Hospice, wo eine Miß King so diskret regiert, daß die Gäste es gar nicht bemerken. Die Gäste: das waren — damals gerade — ein älterer Deutscher, der keine Gelegenheit ausließ, die Universitätsbibliothek von Jerusalem zu rühmen; ein amerikanisches Hippie-Mädchen, eine rotblonde Walküre in bunt bestickter dünner Leinenbluse ohne was anderes drunter, mit ziemlich nebulosen Vorbehalten gegen den — wie sie es nannte — israelischen Imperialismus; ein Kränzchen silberhaariger Damen, die alle aussahen wie die von der Rutherford gespielte Detektivin der Agatha-Christie-Filme; und schottische Familien, die sich benahmen, wie eben schottische Familien sich benehmen. Und nach dem Sonntagsgottesdienst gab es Tee und Sandwiches für die Gemeinde.
Aber höchstens einen Kilometer weiter, wieder iri der Altstadt: das äthiopische Kloster, in das wir, ahnungslos, hineingeraten waren. Der geräumige Hof entdeckte sich uns als eine Landschaft aus etwa mannshohen Buckeln, primitiv gemauert; als ein labyrinthischer Garten voll runder Kavernen; als ein winziges, dicht gedrängtes Höhlendorf. Und scheinbar menschenleer; erst nah beim Kirchenportal ein würdiger Greis in grauem Mönchsgewand, meditierend. Ich bin so erzogen, geistliche Herren zu grüßen. Ich neigte also ein wenig den Kopf, und meine Lippen formten ein zwar nicht hörbares, aber ehrfurchtsvolles „Grüß Gott!“ worauf der Mönch etwas sagte wie „Monni“ — ich dachte „Salve!“ auf abessinisch und ich neigte nochmals und tiefer mein Haupt. Der Mönch wiederholte: „Monni“, und noch einmal: „Monni, monni!“ Vielleicht doch hebräisch? Warum nur, zum Teufel, hatte ich seinerzeit, im Seminar beim Professor Schubert, so wenig aufgepaßt? Doch dann endlich gewahrte ich die mir entgegengestreckte offene Hand, und verstand jetzt: money. Schamhaft gab ich zwei Pfund, die Münze verschwand, nach kurzem prüfenden Blick, in den Falten der Kutte; kein Wort des Dankes, also zuwenig. Wir flohen wie Diebe.
Aber hat jener katholische Priester in der Grabeskirche, bei dem ich, für eine fromme Katholikin daheim, einen Rosenkranz weihen ließ, vielleicht würdiger gehandelt? Sichtlich mißmutig über die Störung, schlug er ein völlig zerfleddertes Büchlein auf, begann murmelnd zu lesen, stockte plötzlich, schüttelte irritiert den Kopf und blätterte ratlos vor und zurück, blieb dann irgendwo hängen und leierte weiter \, und ein paar flüchtige Kreuzzeichen drüber. Ich gab fünf Pfund, offenbar wieder zuwenig, denn wieder hörten wir keinen Dank.
Wie absurd es ist, alle Araber über einen Leisten zu schlagen, wissen am besten gerade die Juden — etwa der Major Horowitz, ein Soziologe von Beruf, der seinen Dienst bei der Militärverwaltung von Cisjordanien freiwillig verlängert hat: ihn reizt das ebenso phantastische wie realistische Experiment der Israelis, mehr mittels der Psychologie als mit Poli-zeistaatmethoden zu einem Modus vivendi mit den Arabern zu finden — davon erzählt er uns in einem arabischen Restaurant, wo er als Stammgast sich offenbar wie daheim fühlt. Seine Dienstpistole ist ihm nicht ein Attribut der Macht, sondern ein eher lästiges Requisit: er hat sie wie eine Zeitung unter den Arm geklemmt, sie rutscht und fällt zu Boden, er hebt sie so beiläufig wieder auf wie eben nur eine Zeitung ... Und Kaiman Yäron, vom Martin-Buber-Zentrum für Erwachsenenbildung, sucht ebenfalls die Seele seiner arabischen Mitmenschen. „Ein Heiliger“, sagte jemand, ohne jedwede Spur von Ironie, über ihn,, der seit Jahren gemischte Sprachkurse abhält: zugleich Arabisch für Juden und Hebräisch für Araber. Er exemplifiziert uns die Schwierigkeiten: Die Araber kennen kein.Wort für Kompromiß; der Lehrer erläutert: Wenn beide einen Schritt zueinander tun. Er konstruiert ein Beispiel und fragt, wer jetzt nachgelben soll. Die Antwort: Natürlich der Schwächere. Also gälte es, schließt er, den Sinn zu wecken für das Nachgeben des Stärkaren aus Einsicht. Und er berichtet auch von Erfolgen: 1970 demonstrierten Araber gegen die Besatzungsmacht, es gab sogar Handgreiflichkeiten. Auch einer seiner arabischen Studenten war daran beteiligt, bemerkte plötzlich, daß es Zeit war für den Hebräischkurs, entschuldigte sich bei seinen Kameraden und eilte ins Seminar. Er kam zwar etwas zu spät, doch er kam, erzählte uns Kälmän Yaron. Vielleicht wirklich: ein Heiliger.
So wenig die Araber gleich sind, so wenig sind's auch die Juden, Auf der Ben Yehuda zwar wähnt man, daß alle Juden Ungarn seien: man hört dort genausoviel Ungarisch wie auf dem Leninring zu Budapest. Und ihren Akzent verlieren die Ungarn auch in Israel nicht. Meine in Budapest geborene Begleiterin, sonst deutsch oder manchmal englisch redend, prostete in einer Gesellschaft auf hebräisch: „Lechaim!“ „Sind Sie Ungarin?“ kam als Antwort. Nicht der Akzent ihrer zweiten, der deutschen, sondern ihrer ersten Muttersprache war durchgeschlagen.
Aber also: wer sind nun die „echten“ Juden von Jerusalem? Der mindestens siebzig jälhrige kugelrunde und quicklebendige Portier von Hesse (mit Sauerkraut auf der Speisenkarte und „Applestrudel“), aus Hamburg stammend, der auf unsere Erwähnung, daß wir dann weiterführen nach Tel /.viv, nur kopfschüttelnd sagte: „Tel Aviv? Da komm' ich noch öfter in die Schweiz als nach Tel Aviv!“ Oder aber jener Herr P., der mit uns im Kaffeehaus saß, wie er, als ganz junger Mann, vor vierzig Jahren in Wien im Kaffeehaus gesessen sein mochte, schier endlos in seinem Mokka rührte und ohne Selbstmitleid mehr als zu uns zu der Tischplatte redete: „Dort bin ich nicht mehr daheim, hier bin ich niemals heimisch geworden; ich bin entwurzelt.“ Eine Angestellte in einem Verkehrsbüro meinte so zwischendurch und ganz ohne Pathos: „Ich bin Jüdin, und ich weiß nur wenig von Jesus. Ich kann nur sagen, daß er ein guter Jude war. Wenn die Menschen nur endlich sehen wollten, dann wäre Frieden!“ Ist diese Jüdin charakteristisch für Jerusalem, oder sind es die Ghetto-Juden von Mea Schearim, die — wie sie sich selber kühn nennen — „Wächter der Stadt“, wenn sie ein Hakenkreuz an eine Hauswand schmieren: nicht als einen Protest gegen alten oder neuen Nazismus, sondern, wie der Begleittext erhellt, gegen den Judenstaat; gegen die Politik, die mit der Staatsgründung dem Erscheinen des Messias frevelhaft vorgegriffen hat?




































































































