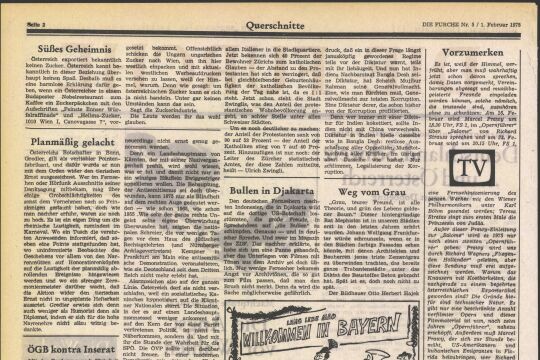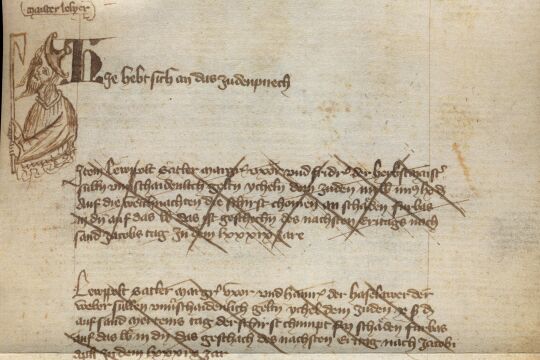„ÖKUMENISCHES GESPRÄCH, Referenten: Univ.-Prof. Dr. Michael Marlet SJ. (katholisch), Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Dantine (evangelisch), Univ.-Prof. Dr. Kurt Schubert (vertritt den jüdischen Standpunkt).“
Dies kann man auf der Einladung lesen, die die Frauen von Bethanien anläßlich der „Woche der Einheit“ ausschickten. „Das gibt ziemlich prägnant die Situation der Juden in Österreich wieder!“ meint Professor Schubert, der an der Wiener Universität über jüdische Religion liest. „Es gibt in Österreich keinen Juden, der bereit ist, vor einem größeren Forum eindeutig und klar seinen Standpunkt zu vertreten!“ Wo immer es um die Kontaktnahme zwischen Christen und Juden geht, wendet man sich an den bekannten Judolögen, der sich seit 1945 bemüht, ein christlich-jüdisches Dis-kussionsforum zu schaffen. Seit etwa einem Jahr existiert nun ein christlich-jüdischer Koordinationsausschuß, in dem Meinungsverschiedenheiten zwischen gläubigen Christen und Juden in Form von Debatten ausgetragen werden sollen. „Wir wollen auf engem Raum Freundschaft stiften“, umreißt Professor Schubert die Ziele des Komitees. „Wir versuchen auch in den Schulen zu wirken, zum Teil durch Vorträge, zum Teil aber auch, indem wir Broschüren, die über das Judenthema aufklären, den Schulbibliotheken zur Verfügung stellen. Wir versuchen auch, die wichtigsten Sonntagsevangelien, die das Judentum formal in einem ungünstigen Licht erscheinen lassen, so zu erklären, wie es zeitgeschichtlich richtig ist.“ In diesem Forum wirken die von den einzelnen Kirchenbehörden ernannten Vertreter im Kampf gegen den Antisemitismus. Uber die derzeitige Schlagkraft dieses Komitees macht sich Professor Schubert keineswegs Illusionen: „Wir sind keine Massenorganisation und wollen auch keine werden.“ Der einzige offizielle Vertreter Österreichs in der internationalen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ist aber eine stark linksgerichtete Aktion, deren Problemstellung auch weniger religiöser denn politischer Natur ist.
MEHR POLITISCHER NATUR sind auch die Agenden der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien, die die Interessen der Juden in Österreich vertritt. „Die Kultusgemeinde ist alles andere als eine Kultusgemeinde!“ stellt der Judologe Schubert fest. „Ich bin überzeugt, daß keine zehn Prozent ihres Aufwandes an Personal und Geld für echte Kultusangelegenheiten aufgehen. Die Sorge für die regelmäßige Ausübung des Gottesdienstes ist eine ihrer Aufgaben, aber nicht die wesentlichste. Die Kirche ist hingegen in erster Linie eine Kultusinstitution!“ Den Vergleich mit der katholischen Kirche will der Präsident der Kultusgemeinde, Dr. Ernst Feldsberg, überhaupt nicht gelten lassen: „Die Kultusgemeinde ist keine Institution wie die Kirche. Wir haben keine hierarchische Gliederung. Wir sind auch keine rein politische Institution. Wir haben die Aufgabe, für den Tempel zu sorgen, den jüdischen Friedhof auf dem Wiener Zentralfriedhof, das Altersheim, das Spital und die Bibliothek zu erhalten. Für einen Außenstehenden ist die Struktur der Kultusgemeinde schwer verständlich. Deshalb gibt es auch so viele falsche Ansichten über uns!“ Von den ungefähr 15.000 in Österreich lebenden Juden sind ungefähr 9000 bei der Kultusgemeinde registriert. Im keineswegs offiziellen, aber durchaus existenten Gegensatz stehen die Bestrebungen der Kultusgemeinde und der einzelnen zionistischen Parteien. „Dieser Gegensatz ergibt sich zwangsläufig daraus, daß unser Ziel die Heimkehr nach Israel ist, während die Kultusgemeinde eine ortsgebundene Institution ist, die die Interessen der Kultussteuerzahler vor den einzelnen Regierungen vertritt“, erklärt der geschäftsführende Sekretär der Föderation der Zionistischen Parteien in Österreich, Peter Stiegnitz. „Zur Zeit sind in der Föderation sieben zionistische Parteien vertreten, von denen jede in eine andere politische Richtung wirkt. Unsere Aufgabe ist es, vor allem in der Jugend den zionistischen Gedanken wachzuhalten. Den einzigen Weg gegen den Antisemitismus sehen wir darin, dem Judentum eine Heimat zu geben. Solange der Jude keine echte Heimat hat, bleibt er — wie es die Geschichte zeigt — ein ewig Außenstehender.“
DIE BETREUUNG DER JÜDISCHEN Jugend in Österreich haben vier von einzelnen israelischen Parteien gelenkte Jugendklubs übernommen. Da gibt es etwa den Schomer-Hazair, von der linksgerichteten Mapam geleitet, den Bne-Akiba von der national-religiösen Partei, den Israel-Hazeira der liberalen Partei Israels und den Gor-donia, der von der Regierungspartei Israels finanziert wird.
Betritt man das stark baufällige Haus Judenplatz 8, dringt einem zunächst kühle Düsternis entgegen. Hat man sich an das Dunkel ein wenig gewöhnt, bringen einen Steinstiegen in den ersten Stock, der vom Lachen und Gejohle junger Menschen erfüllt ist. In einem als Garderobe eingerichteten Vorraum, in dem es von Mädchen und Burschen nur so wimmelt, erhält der fremde Besucher eines jener Käpp-chen, das strenggläubige Juden allerorts und zu jeder Zeit tragen. Endlich geht es in ein nicht sonderlich heimeliges Zimmer, dessen Wände durch Bilder bärtiger Rabbiner und einige Plakate geschmückt sind. Hier also finden sich an jedem Samstag die Mitglieder des Bne-Akiba ein, um den Schabbat in geselliger Weise mit Gebet, Tanz, Gesang und Vorträgen zu begehen. Der geplante Vortrag über jüdische Philosophie, der ansonsten eine Stunde des Nachmittagsprogramms in Anspruch nimmt, wird zugunsten einer Diskussion mit dem Besucher fallengelassen. Die jungen Leute,die sich zu Wort melden, sind teils Studenten, teils noch Mittelschüler. „Eine echte Freundschaft mit einem NichtJuden gibt es sehr selten!“ meint der Chemiestudent Andy. „In der Schule komme ich mit meinen Mitschülerinnen ganz gut aus“, erzählt Hedi, „aber ich habe keine Freundinnen, mit denen ich auch außerhalb der Schule in Kontakt bin. Dazu ist eben der Klub da. Da habe ich meine gleichgläubigen Kameraden, unter denen ich mich wohlfühle!“ „Bei uns in der Klasse war ich der sogenannte .Ausnahme-jude'“, berichtet Roby, der nun Medizin studiert. „Über die Juden im allgemeinen wurde sehr geschimpft, aber ich war eben eine erfreuliche Ausnahme!“ „Meine Mitschülerinnen sind dem Judentum gegenüber eher gleichgültig“, sinniert Bronja. „Einmal sollte sich die ganze Klase den Film .Exodus' ansehen; die meisten wollten nicht!“
DAS GESPRÄCH WIRD UNTERBROCHEN, weil die Jungen zum Nachmittagsgebet gerufen werden. Die Mädchen bleiben im Zimmer; Beten und Gottesdienst ist bei den Juden Männersache. Die Mädchen beginnen zu singen, und der metallene Klang ihrer Stimmen übt auf den Besucher einen seltsam fremdartigen Reiz aus.
Nachdem die Burschen aus dem Nebenraum zurückkommen, wird im Kreis Aufstellung genommen. Nach dem Absingen der Klubhymne gibt der Gruppenführer das Programm für den Abend bekannt, das neben der Lesung aus dem Talmud einzelne Referate über Israel beinhaltet. Mit dem Abendgebet wird der Schabbat abgeschlossen (für den Juden beginnt der neue Tag bereits mit Einbruch der Dunkelheit). „Sie haben hier einen Teil der geschlagenen Generation des Judentums kennengelernt!“ bemerkt der Gruppenführer beim Hinausgehen leise; fast klingt es wie eine Entschuldigung. „Bedenken Sie, daß diese Jugend voll Mißtrauen gegenüber ihren Mitmenschen ist. Diese jungen Menschen müssen erst den Schock überwinden lernen, den ihre Eltern erlitten haben.“
VON DEN 15.000 IN ÖSTERREICH lebenden Juden findet man die meisten im Altersheim oder in Intelligenzberufen. Im Kulturleben gibt es heute bereits wieder eine große Anzahl jüdischer Künstler. Viele Juden sind heute in leitender Position in der Textilbranche tätig. Der alte „Ha ;eljud“ hingegen, wie ihn das alte Wien kannte, ist heute fast ausgestorben. In der Wiener Judengasse, in der vor 1938 an die 40 jüdische Kaufleute ihre billigen Waren anboten, gibt es heute nur noch drei Geschäfte, deren Besitzer Juden sind. Dennoch bietet die Judengasse noch heute jenes Bild, wie es in der Vorstellung der Bevölkerung von einem jüdischen Einkaufszentrum lebt. An den Eingangstüren zu den meist recht kleinen Läden hängen an Bügeln Mäntel, Cowboyhosen und „Lederwesten“ aus Kunststoff. Auch den „Anreißer“, dessen Wortschwall und Aufdringlichkeit früher jeder Besucher der Judengasse zum Opfer fiel — falls er nicht über einen ausgeprägten Willen und einige Widerstandkraft verfügte —, gibt es heute noch, wenngleich die Kundschaft heute, weitaus dezenter angelockt wird: „Na, junger Mann, was darf es denn sein?'“ „Kommen Sie nur herein! Wir geben es Ihnen billiger!“ Waren es früher die Armen Wiens, die in der Judengasse abgelegte Kleidungsstücke der reichen Herrschaften zu einem niedrigen Preis erstanden, fährt man heute mit dem Auto vor. Samstag vormittags knattern die Mopeds durch die Judengasse: Wiens Halbwüchsige pflegen hier ihren Bedarf an enganliegenden Hosen und spitzen Schuhen zu decken.
IN DIE JUDENGASSE MÜNDET die Seitenstettengasse, wo sich die Synagoge befindet, in der täglich Gottesdienste abgehalten werden. Da der . fromme Jude, der im; Berufsleben steht, nicht immer die' Zeit findet, in den Tempel zu kommen, hat man über die ganie Stadt verstreut Gebethäuser errichtet, in denen man nicht nur sein Abendgebet verrichten, sondern auch Bücher in hebräischer Sprache studieren, aber auch essen kann. In der Weihburggasse im 1. Bezirk befindet sich ein solches Gebethaus, das zusammen mit dem einzigen Koscher-Restaurant in . Österreich von einem jüdischen Verein erhalten wird. Das Restaurant strahlt nichts von der gemütlichen Atmosphäre eines Wiener Kaffeehauses aus. Der große Saal faßt etwa 200 Personen und ist von kalter Sauberkeit. An einigen Tischen nehmen Gäste einen kleinen Imbiß zu sich. Die Speisenkarte zeigt zunächst keinen Unterschied von der der übrigen Gastbetriebe in Wien.
Zur Auswahl stehen etwa an Suppen: Fleisdhsuppe mit Frittaten oder mit Knödel, Gerstisuppe; an Vorspeisen: Leberpastete und Ostseehering; an Gemüse und Beilagen: Salzkartoffel, Reis, Nockerl, Kohl; an Salaten: Salz- oder Eissiggurkerl, Paprikasalat, Kren; an Fleischspeisen: Rindfleisch, Beinfleisch, Rindsgulasch, geröstete Leber, Kalbsbraten, Wiener Schnitzel, Einmachhuhn, Brathuhn; an Mehlspeisen: Apfelstrudel, Reisauflauf, Mohnbeugel, Biskuit; an Kompotten: Apfel-, Birnen- oder Pflaumenkompott.
Der Unterschied liegt in der Zubereitung. „Koscher heißt eigentlich ,rein'“, erklärt der Geschäftsführer des Restaurants, Herr Vorhand. „Für uns fromhie Juden ist zum Beispiel ein Tier unrein, wenn es von einem anderen Tier zerrissen wurde. Das Tier darf auch nicht erschossen oder abgestochen worden sein. Es muß rituell geschlachtet werden, sonst dürfen wir sein Fleisch nicht als Nahrung verwenden. Nach der Schlachtung wird das Fleisch etwa eine halbe Stunde in Salzwasser liegen gelassen, damit das Blut entfernt wird. Zur Zubereitung dürfen wir natürlich kein Schweinefett verwenden. Für uns wird in österreichischen Fabriken unter Aufsicht eines Rabbiners reines Pflanzenfett hergestellt.“ Ein Blick auf die Getränkekarte des Koscher-Restaurants läßt den Gast ein in Wien besonders beliebtes Getränk vermissen, den Kaffee. „Das kommt daher“, erklärt Herr Vorhand, „daß bei uns gläubigen Juden Milch-und Fleischspeisen nicht vermengt werden dürfen. Geschirr, auf dem Fleisch serviert wurde, muß getrennt von dem gereinigt werden, auf dem Milchspeisen gegessen würden. Da ich das hier bei zwölf Angestellten,, die alle Nicht Juden sind, nicht überwachen könnte, führen wir überhaupt keine Milch.“ Dem Koscher-Restaurant in der Weihburggasse obliegt auch die Belieferung der einzelnen Fluggesellschaften mit koscheren Speisen. Hierzu wird das sorgfältig verpackte Geschirr immer wieder neu geliefert, weil man nicht kontrollieren könnte,, ob das benützte Geschirr auch den strengen Vorschriften entsprechend gereinigt wurde. „Fromihsein ist nicht leicht!“ meint Herr Vorhand. „Und wir fragen auch nicht: Warum? Wir leben so, wie es uns Gott befohlen hat!“
DAS ' JUDENTUM IN ÖSTERREICH, wie überhaupt, tritt uns in einer ungeahnten Vielschichtigkeit entgegen, die sich vom strenggläubigen • Orthodoxen bis zum überzeugten Kommunisten erstreckt. In allen Juden, auch in denen, die nicht unmittelbar davon betroffen waren, lebt jüngst Vergangenes in erschreckender Präsenz. Vor allem in der jüdischen Jugend ist ein Gettogefühlt wach, das es von außen her zu überwinden gilt.