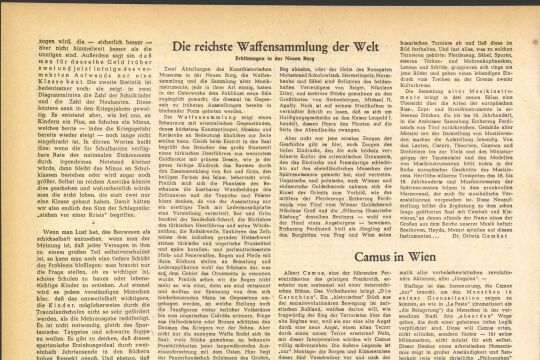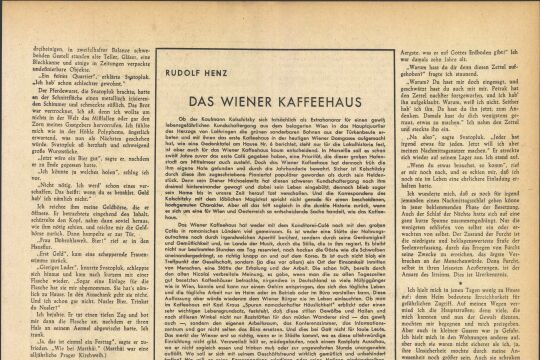DER FR8MDE BUMMELT, wenn er Wien besucht, durch die Kärntner Straße. Das gehört nun einmal zum „Sightseeing” dazu. Der Wien-Kenner aber ergibt sich dem Reiz der Dorotheergasse. Ruhig und verträumt windet sie sich, drei Parallelgassen weiter von Wiens exklusivster Geschäftsstraße, vom Graben zur Augustinerstraße. Höchstens 200 Meter lang und oft nicht mehr als vier Meter breit, bietet dieses Gäßchen Wien in konzentriertester Form.
Hier ist das „Beisl” im verwitterten Barockpalast zu finden, Nachtlokal und Kirche, voneinander nur durch einige Häuser getrennt, haben jeweils ein Antiquitätengeschäft zum Gegenüber, Wiener Coiffeurkunst spiegelt sich in dem Auslagenglas eines Musikalienverlages, Dorotheum, Hawelka und Trzes- niewski — das alles sind Komponenten, die zu dieser Stadt gehören. Hier ist Wien typisch, unfaßbar und die Extreme liebend.
Biegt man in die Dorotheergasse ein, fühlt man sich vorerst einmal als Eindringling, denn an beiden Enden verengt sich dieses Gäßchen wie ein Fla-
schenhals. Es wirkt abweisend und gewährt kaum Einlaß. Hat man aber diese Engpäße hinter sich gelassen, wird diese Gasse zum Dorado für Antiquitäten-, Kunst- und Musikliebhaber, Kaffeehaussitzer, Versteigerungsfanatiker oder Feinschmecker.
„...UND EINEN .PFIFF, BITTE”, ruft der junge Mann dem Büfettfräulein noch zu, ehe er sich mit einem Teller voll Brötchen an einen freigewordenen Platz an der Theke begibt. Er ist offensichtlich ein Stammkunde hier im Trzesniewski, denn ein Neuling würde unwissend-naiv ein kleines Bier, was in’ diesem speziellen Fall ein Achtelliter bedeutet, verlangen.
Wie in einem Bienenhaus schwirren hier, wenige Schritte vom Verkehrs- Hexenkessel Graben entfernt, die Kenner dieser Wiener Spezialität ein und aus. Die warmen Schinkenpasteten, die Champignon-, Hummer- und Tomatenbrötchen oder wie sie nach den rund 40 verschiedenen Aufstrichen heißen, sind ein Begriff für Wiener und Nicht-wiener, für einen „Herrn Karl” Qual- tinger ebenso wie für eine Hilde Güden.
Magnetisch ziehen diese Brötchen die großen und die kleinen Gourmets immer wieder in die Dorotheergasse. Denn so wie es üblich ist, schnell auf einen „kleinen Braunen” zu gehen, gehört es für viele selbstverständlich zum Tagesprogramm, den „Pfiff” und die Brötchen bei Trzesniewski einzukalkulieren.
Niemand denkt heute noch an jene Zeiten, als während des Krieges die Trotzdem-Feinschmecker für jedes Brötchen eine Semmelmarke zu opfern hatten. Daß trotz der Versorgungsschwierigkeiten der Büfettbetrieb kontinuierlich aufrechterhalten werden konnte, war ein kleines wienerisches Wunder.
Das „Trzesniewski” war ursprünglich ein polnisches Spezialitätenrestaurant in der Nähe des Kojilmarkts, man führte jedoch nach dėr Übersiedlung in die Dorotheergasse im Jahr 1923 das Lokal nur noch als Spezialitätenbüfett. Der beste Beweis für das Gelingen dieses Betriebes sind wohl die Millionen dieser Brötchen, die im Lauf der Jahre entweder sitzend-genießerisch verzehrt oder hastig, schnell im Vorbeigehen, hinuntergeschlungen wurden.
IM „HAWELKA”, derzeit Wiens Literatencafe, kann man sich dem Wert produktiven Nichtstuns ergeben. Eingehüllt in die undefinierbare Geräuschkulisse von Geschirrgeklirr, dumpfem Stimmengemurmel und das Rascheln von Zeitungen lasse ich die Zeit mit meinen Gedanken spielen. Vor mir dampft der „kleine Braune”, daneben steht das obligate Tablett mit den drei Gläsern Wasser.
Oberflächlich betrachtet ist das „Hawelka” ein typisches Wiener Cafe, mit Plüschsofas, Marmorplatten auf den Tischen und Stößen von in- und ausländischen Zeitungen. Nicht typisch Wiener Cafe, sondern typisch „Hawelka” ist eine von oben bis unten mit Plakaten von Ausstellungen, Dichterlesungen und sonstigen Kulturveranstaltungen tapezierte Wand. Was dieses Cafe zum „Hawelka” und damit zu einem Begriff schlechthin machte,
sind seine Gäste plus „das gewisse Etwas”.
Hier sind fast nur Stammgäste, die sich untereinander oder via Freundesfreunde kennen, unter ihnen Schauspieler, Maler, Schriftsteller oder solche, die es noch werden wollen.
Herr Hawelka, alles managender Besitzer des Lokals, gehört zu dem „gewissen Etwas”, das die individuelle Note des Cafes ausmacht. Immer noch schafft er für seine Gäste, die er fast alle persönlich kennt und per Handschlag begrüßt, Platz, wo keiner mehr zu sein scheint. Er reicht dem Stammgast dessen bevorzugte Zeitungen und vergißt auch nicht, eine hinterlassene Nachricht gewissenhaft zu bestellen. Seit er vor einiger Zeit Bilder junger, bereits anerkannter Wiener Maler ankaufte und sie für seine urteilsfreudigen Gäste im Lokal aufhängte, gilt er auch als Kunstmäzen.
Beim Durchblättern des Gästebuches stoße ich auf viele berühmte Namen und geistreiche Bonmots. Die Eintragung eines Theaterwissenschaftlers aber sagt vielleicht mehr als jeder Versuch einer Beschreibung. Da heißt es: „Ich mich eintragen? Ins Gästebuch? Wieso? — Ich wohne doch hier!”
PETER ALTENBERG wohnte viele Jahre hier im Grabenhotel, die erste Gasbeleuchtung Wiens erhellte dieses Gäßchen, das sei nur am Rand vermerkt.
Heute helfen den elektrischen Glühbirnen zusätzlich grelle, auf die Striptease-Photos eines Nachtlokals gerichtete Scheinwerfer, das Dunkel zu erhellen. Trotzdem ist sie eine konservative Gasse geblieben, ohne nervös flimmernde Neonröhrenreklame, mit wenig Straßenverkehr. Die ehrwürdige Umgebung von zwei evangelischen Kirchen, einer des helvetischen und einer des lutherischen Bekenntnisses, oder die nur jeweils wenige Schritte von der Dorotheergasse entfernte Augustiner- und Michaelerkirche scheinen dies zu verlangen. Aber auch die unmittelbare Nähe des barocken Josefsplatzes, der Nationalbibliothek, des riesigen Komplexes der Hofburg oder des vielbewunderten Renaissancehofes der Spani- schen-Hofreitschule-Stallungen sind am Fluidum dieses Gäßchens beteiligt.
IN DAS „DOROTHEUM” gehe ich bei einem Bummel durch dieses Gäß- chen natürlich auch. Dies der österreichische Ausdruck für das schriftdeutsche Versatzamt, was wiederum auf gut wienerisch „Pfandl” heißt.
Am 14. März 1707 hatte Kaiser Josef I. das Gründungspatent unterzeichnet, womit die Errichtung eines „Versatz- und Fragamtes” anbefohlen worden war. Der erste Amtssitz dieser Anstalt befand sich in der Annagasse. Die Aufgabe bestand darin, der finanzieller Hilfe bedürfenden Bevölkerung gegen Verpfändung von Wertgegenständen billige Kredite zu verschaffen, um so den damals blühenden Wucher einzudämmen. Von 1787 bis 1901 war das Versatzamt im Chorherrenstift zur heiligen Dorothea in der Spiegelgasse untergebracht. Durch einen radikalen Umbau des Komplexes, der sich von der Spiegelgasse bis zur parallel verlaufenden Dorotheergasse erstreckt, konnte das mustergültige, mit den letzten technischen Errungenschaften ausgestattete Gebäude im Beisein Kaiser Franz Josefs und des damaligen Bürgermeisters Doktor Lueger eröffnet werden; es führte den Titel „Versatz-, Verwahrungs- und V ersteigerungsamt”.
Allerdings nur bis zum Jahr 1923, als es zur Erinnerung an das an dieser Stelle bestandene Chorherrenstift „St. Dorothea” als kommerziell selbständiges „Dorotheum” in das Handelsregister eingetragen wurde, nachdem es bis dahin vom Staat verwaltet worden war. Gleichzeitig erhielt es auch die Genehmigung zur Errichtung von Zweigstellen im In- und Ausland. So trocken auch seine Geschichte klingen mag, so abwechslungsreich, ja fast spannend ist der Alltag in diesem Gebäude.
Schon im Flur bietet sich dem Besucher eine andere Welt, eine Wunderwelt. Möbel aller Art sind hier abgestellt, Badewannen stehen neben alten Küchenöfen, Schreibtische neben Schlafzimmereinrichtungen. Das alles aber läßt vorerst nur die Vielfalt der in den Schauräumen angehäuften Gegenstände erahnen. Pelzmäntel, Bücher, Schreibmaschinen, Ziergegenstände, Teppiche, Schmuck, Briefmarkensammlungen versuchen neben unzähligen anderen Gegenständen die Aufmerksamkeit der Neugierigen und Ersteigerungslustigen zu wecken. Da steht eine bemalte Bauerntruhe in unmittelbarer Nähe eines Barocktischchens und neben diesem wiederum ein mir unbekanntes, baumstammartiges Etwas. Ich lese den angehängten Zettel: Tumba, Schlaginstrument aus Tahiti, S 500,—. An den Wänden hängen viele Bilder, große und kleine, röhrende Hirsche in jeder Menge, aber noch mehr Madonnenbilder.
Im Labyrinth der Gänge, Räume und Türen gelange ich unvermutet in einen Saal, in dem gerade eine Versteigerung in vollstem Gang ist. Hier, im sogenannten Franz-Josef-Saal, herrscht unter dem Publikum eine erregte Stimmung. Vorne, auf einem erhöhten Pult, unter aufgehängten Teppichen, zwischen Möbeln und verschiedenartigsten Gegenständen eingeengt, sitzt der Versteigerungsausschuß und ruft in knappen zwei Stunden zwischen zwei- bis dreihundert Posten aus. An den Mienen der in Reihen Sitzenden erkennt man, wer nur aus Schaulust hier ist und wer vorhat, etwas zu ersteigern. Letztere halten einen oder mehrere Zettel in der Hand, vergleichen die in rascher Folge aufgerufenen Nummern mit jenen von ihnen notierten, um im richtigen Moment die Hand zu heben. Manche rotgefleckte Wange läßt die Aufregung erkennen, die der Besitzerwechsel eines Gegenstandes hervorruft.
Neben mir sitzt eine Amerikanerin. Sie steigert begeistert mit, man nennt ihr zuliebe die Preise auch in englischer Sprache, und nachdem sie einige buntbemalte Teller erworben hat, scheint ihre Freude keine Grenzen mehr zu kennen. Strahlend verläßt sie den Raum, so als hätte sie beim Roulette die Bank gesprengt. Aber das Publikum beachtet ihre Freude nicht, es konzentriert sich weiterhin auf die ausgerufenen Nummern. Der nächste Posten ist ein Teppich zum Ausrufungspreis von 13.000 Schilling. Nur eine einzige Hand wird gehoben, zwei, drei, Sekunden ist es ganz still im Raum, man blickt umher, ob noch jemand mitsteigert.
Jährlich wechseln hier durchschnittlich 700.000 Gegenstände an freiwillig versteigerten sowie Pfandposten ihren Besitzer.
Während ich durch den Ausgang trete, werden bereits wieder zu versteigernde Sachen abgeladen, daneben versteigerte aufgeladen. Ein ständiger Kreislauf, eine Welt für sich, amüsant und wert, kennengelernt zu werden.
Auch für den Antiquitätenliebhaber und Musikkenner hält das Gäßchen unerwartete Möglichkeiten offen. In einer Vielzahl wie nirgends sonst in Wien sind hier Antiquitätengeschäfte auf engstem Raum konzentriert. Als Folge davon, daß sich auch die Kunstabteilung des „Dorotheums” in dieser Gasse befindet. Bedeutende Auktionen locken immer wieder sachverständige Käufer an.
SO WIE WIEN UND MUSIK zusammengehören, so läßt sich auch kaum das schon beinahe hundert Jahre in der Dorotheergasse bestehende Musikhaus Döblinger aus der Geschichte des Wiener Musikalienverlages wegdenken. Es erfüllt eine weltweite Kulturabgabe, verschickt den Ruhm unserer Musikstadt in die ganze Welt.
Den Rahmen für diesen Musikverlag bildet ein Barockhaus aus dem späten 17. Jahrhundert, welches durch den Ankauf einer Gräfin von Worcell im Jahr 1825 als „Worcellsches Haus seine gesellschaftliche Bedeutung erlangte. Heute noch finden im festlichen Barocksaal Konzerte statt, welche die große Tradition aufrechterhalten sollen.
DIE PULSIERENDE HEKTIK der Augustinerstraße entreißt mich der dumpfen Süße dieser Gasse, in der Vergangenheit und noch zögerndes Jetzt so nebeneinander existieren wie Kirche und Nachtlokal, ohne einander zu stören.
Freilich, das Publikum von heute, vor allem die Jugend, isoliert sich, umgibt sich mit kritischem Mißtrauen. Wenn aber tief drinnen der Mensch durch echte Menschlichkeit angesprochen wird, fällt jede Maske, das Ereignis des großen Theaterabends tritt ein. Regisseur, Autor und Schauspieler sind vereinigt im Dienst an der Kunst. Sie sind berufen, von einem Geheimnis, von der Wahrheit zu künden. Alles wird voll Hoffnung, alles ist ein Beginnen, wie eine Schöpfung am ersten Tag. Es kreist immer wieder um eines: um den Menschen selbst, die Erschaffung des Menschen und sein Streben nach Vollkommenheit. Kunst existiert ja nur um des Menschen willen, seiner Sehnsucht entspringend. „Illusio” — Beginn eines Spiels. Die Kosmogonie des Theaters ist nun einmal die Antirealität. Es birgt die Hoffnung in sich, die jedep Angst vorausgeht. Es birgt ebenso die Trauer um das Unvollkommene, den Schmerz, daß eben alles nur „luduso” ist. Für die Spannung, das Herausheben aus dem Alltag, für die Ergriffenheit, ist dies alles Voraussetzung und mitbestimmend. Es muß sich also das elementar Uralte ereignen, oder es ereignet sich nichts.
Unsere Gegenwart trägt das Bewußtsein, daß die Welt nicht nur ist, sondern vielmehr geworden ist. Dadurch kann heute eine Inszenierung nur dann als befriedigende Aussage gelten, wenn man auf den Erkenntnissen der Vergangenheit Schicht um Schicht aufbaut, bis zu der Form, durch welche man das Publikum aus seiner Leere wachrütteln kann. Erst der Umgang mit der Vergangenheit, die Vertrautheit mit ihr. macht produktiv. Produktiv aus Verstehen und Liebe. Erst dann ist man zu einer Aussage berechtigt, erst dann hat man etwas zu sagen und fügt nicht der Leere noch leeres, verkrampftes Geschwätz hinzu. Das Publikum ist also gehemmt und daher reserviert. Um es nun