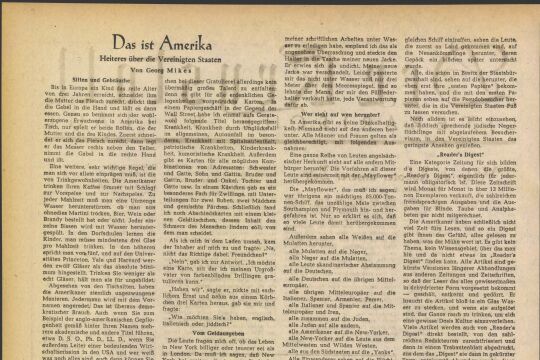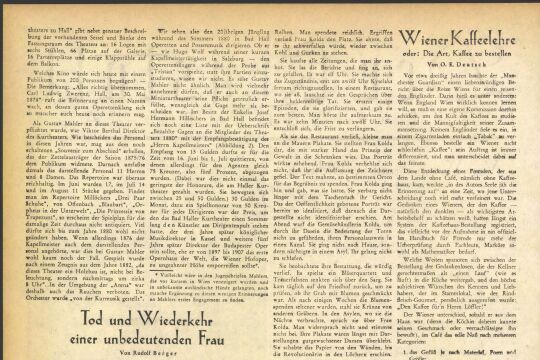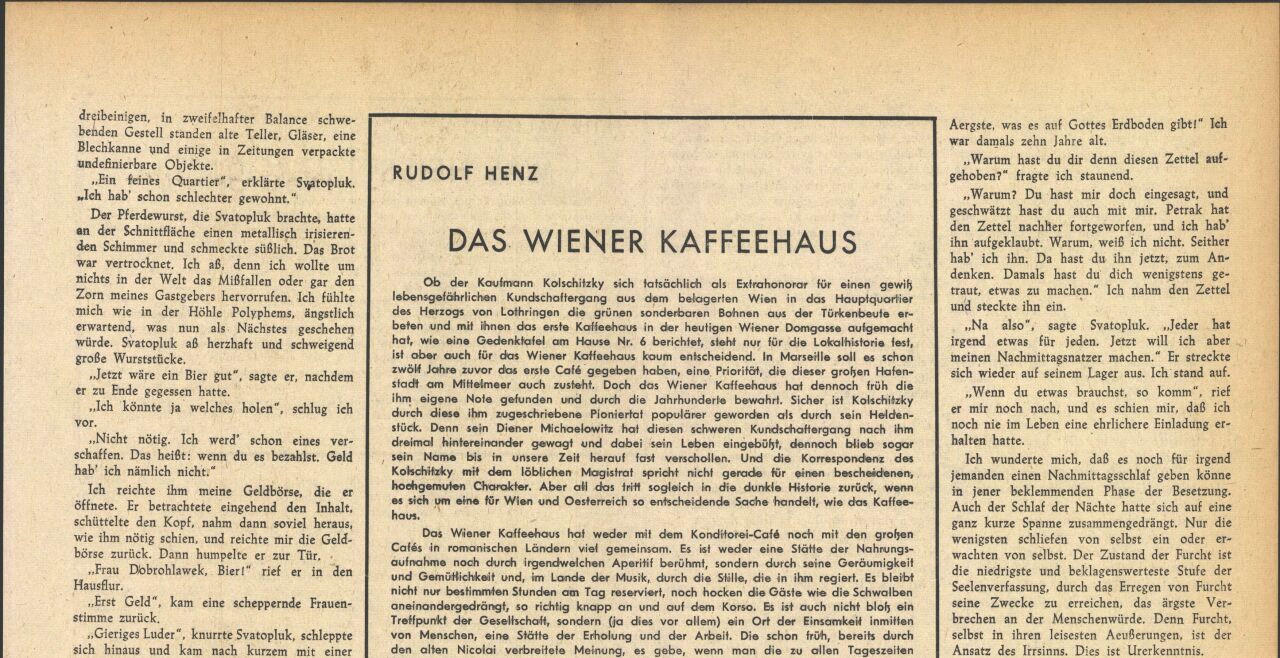
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
DAS WIENER KAFFEEHAUS
Ob der Kaufmann Kolschitzky sich tatsächlich als Extrahonorar für einen gewiß lebensgefährlichen Kundschaftergang aus dem belagerten Wien in das Hauptquartier des Herzogs von Lothringen die grünen sonderbaren Bohnen aus der Türkenbeute erbeten und mit ihnen das erste Kaffeehaus in der heutigen Wiener Domgasse aufgemacht hat, wie eine Gedenktafel am Hause Nr. 6 berichtet, steht nur für die Lokalhistorie fest, ist aber auch für das Wiener Kaffeehaus kaum entscheidend. In Marseille soll es schon zwölf Jahre zuvor düs erste Cafe gegeben haben, eine Priorität, die dieser großen Hafenstadt am Mittelmeer auch zusteht. Doch das Wiener Kaffeehaus hat dennoch früh die ihm eigene Note gefunden und durch die Jahrhunderte bewahrt. Sicher ist Kolschitzky durch diese ihm zugeschriebene Pioniertat populärer geworden als durch sein Heldenstück. Denn sein Diener Miichaelowitz hat diesen schweren Kundschaftergang nach ihm dreimal hintereinander gewagt und dabei sein Leben eingebüßt, dennoch blieb sogar sein Name bis in unsere Zeit herauf fast verschollen. Und die Korrespondenz des Kolschitzky mit dem löblichen Magistrat spricht nicht gerade für einen bescheidenen, hochgemuten Charakter. Aber all das tritt sogleich in die dunkle Historie zurück, wenn es sich um eine für Wien und Oesterreich so entscheidende Sache handelt, wie das Kaffeehaus.
Das Wiener Kaffeehaus hat weder mit dem Konditorei-Cafė noch mit den großen Cafes in romanischen Ländern viel gemeinsam. Es iist weder eine Stätte der Nahrungsaufnahme noch durch irgendwelchen Aperitif berühmt, sondern durch seine Geräumigkeit und Gemütlichkeit und, im Lande der Musik, durch die Stille, die in ihm regiert. Es bleibt nicht nur bestimmten Stunden am Tag reserviert, noch hocken die Gäste wie die Schwalben oneinandergedrängt, so richtig knapp an und auf dem Korso. Es ist auch nicht bloß ein Treffpunkt der Gesellschaft, sondern (ja dies vor allem) ein Ort der Einsamkeit inmitten von Menschen, eine Stätte der Erholung und der Arbeit. Die schon früh, bereits durch den alten Nicolai verbreitete Meinung, es gebe, wenn man die zu allen Tageszeiten gut besetzten Kaffeehäuser befrachte, nirgendwo in Deutschland so viele Müßiggänger wie in Wien, konnte und kann nur einem Gehirn entspringeny das sich das tägliche Leben und die tägliche Arbeit nur im Heim oder im Betrieb oder im Büro verstellen kann. Diese Auffassung aber würde wiederum dem Wiener Bürger nie im Leben einte,uohten. Ob man im Kaffeehaus mit Karl Kraus „Spuren nomadenhafter Häuslichkeit” erblickt oder einen sehr wichtigen Lebensgrundsatz, feststeht, daß diese stillen Gewölbe und Hallen und noch stilleren Winkel nicht nur Raststätten für den müden Wanderer sind — das gewiß auch —, sondern den eigenen Arbeitsraum, das Konferenzzimmer, das Informationszentrum und -gar nicht selten das Büro ersetzen. Und dies bei Gott nicht für faule Leute. Das merkt der Wiener erst so richtig, wenn er in Städte kommt, wo es diese altehrwürdige Einrichtung nicht gibt. Verzweifelt hält er, müdegelaufen, nach einem Rastplatz Ausschau, wo er nicht sogleich essen und trinken muß oder zur ungewohnten Stunde unangenehm auffällf. Wo soll er sich mit seinem Geschäftsfreund wirklich gemütlich und unbehindert treffen? Wo will er seine Korrespondenz erledigen oder seine Notizen niederschreiben, wo liegen die Zeitungen aus aller Welt für ihn bereit und wo fühlt er sich bald daheim und von einem Ober so sehr in seinen geheimsten Wünschen verstanden und betreut, und sei es bloß mit einigen fürsorglich erneuerten Gläsern Wasser. Das viele Wasser wirkt auf die Fremden noch komischer als das Herumsitzen und Zeitunglesen. Aber weshalb sollte der Wiener das ausgezeichnete naturbelassene Hochquellenwasser nicht lieben und trinken und dabei so tun, als säße er doch, vom Ober her gesehen, nicht umsonst im Lokal? Und ist die Neugier nach allen möglichen Gazetten etwa nackte Zeitverschwendung? Tut sich nicht erst aus all den Blättern jenseits des Leibblattes, das der Herr bereits beim Frühstück daheim gelesen hat, die Welt auf? Ist das Studium aller erreichbaren Informationen nicht eine Quelle der Weitläufigkeit, ein wenn auch papierener Damm gegen Engstirnigkeit, Hochmut und Versumperung? Und warum sollte es nicht ein Platzerl geben, wo sich der heutige, von allen technischen Teufeln gehetzte Mensch wie an einer Freistatt niederlassen und sicher fühlen kann, unerreichbar für eine Weile jenen zahlreichen Dieben, die ihm das wirkliche Leben stehlen? Und wieviel leichter spricht es sich in dieser aufgelösten Atmosphäre unter anderen Auchmenschen mit einem harten Gegenüber, wenn dieser nicht hinter seinem Schreibtisch thront, das Telephon nicht unablässig klingelt und der Herr Generaldirektor auch nur ein schlichter Mensch ist, ein einfacher Gast bei Kaffee und Wasser?
Es gab Jahre, wilde, aus den Fugen geratene Zeiten, in denen fremdländische Gesichter ein Kaffeehaus bis zum letzten Winkel erfüllten. Dann war nur noch der Wirt- schaftsteil der Zeitungen interessant, und auch der nicht, denn die Schleichhandelspreise standen ja doch nicht schwarz auf weiß gedruckt, und diese Lokale waren dann nur noch für die Polizei wichtig. Es waren dies jene Zeiten, in denen über Nacht dos Stammcafe in eine Bankfiliale umgewandelf wurde oder in ein Informationslokal einer Besatzungsmacht. Aber lange vor solcher Entartung war schon das Gegenstück da, das literarische Kaffeehaus, Treffpunkt der Feuilletonisten und Kritiker und einiger Dichter, die da als Arrivierte sich benahmen und den minder Arrivierten Audienz gewährten und an der Börse des literarischen Ruhmes spielten, meist wohl des Tagesruhmes.
Gibt es das heute noch? Gibt es überhaupt noch eine „Kaffeehausliteratur”? Die vielgerühmten Lokale vor dem ersten Weltkrieg sind längst verschwunden, natürlich auch die noch älteren, wie das „Silberne Kaffeehaus”, aber auch das „Cafė Central” existiert nicht einmal mehr als Espresso. Kaffeehausliteraten gibt es noch, sie sterben nicht aus und sind genau so auf ihren Eintagsruhm erpicht und auf jenen Tratsch, der dann in Boulevardblättern seinen Niederschlag findet. Auch der im Kaffeehaus schreibende Dichter ist noch da. Warum auch nicht? Er ist kein Anwärter auf den Elfenbeinernen Turm; gewiß, er bedarf für die Inspiration einer Einsamkeit, die er jederzeit mit gutem Gewissen aufgeben kann, er will ein leichte Ausrede haben, wenn ihm einmal nichts einfällt.
Und das Getränk, dem diese geistige, wirtschaftliche und gesellschaftliche Institution den Namen verdankt? Von dem in Deutschland beliebten Kaffee unterscheidet sich der Wiener Kaffee nicht nur in der Betonung, sondern auch durch die Vielfalt von Rezepten, nach denen er gebraut wird, besser der Bezeichnungen, unter denen man ihn bestellt. Man kann nicht einfach Kaffee verlangen, sondern Kaffee „mit’ od er „ohne (natürlich Schlag und nicht Sahne), „große’ und „kleine” Teeschalen (nicht mit dem Getränk Tee zu verwechseln!). Kannen gibt es nur beim Frühstück im Hotel. Aber auch der Kaffee mit Milch hat viele Schattierungen. Er ist „braun” oder „licht” oder „gold” oder eine „Melange”, entweder gemischt wie der „Kapuziner” oder vom Gast zu mischen wie der „Einspänner”, bei dem das Obers wohl in einem Glas, aber streng geschieden vom Schwarzen, auf den Tisch kommt. Für gewöhnlich genügt der Mokka. Filter wird selten bestellt. Der Türkische sieht aus wie überall, auch der Espresso.
Mit dem „Espresso” (in der Vorstadt heißt er auch „Expresso”) geraten wir mitten in eine Revolution. Als er, aus Italien kommend, nach dem zweiten Weltkrieg den Wiener Gaumen eroberte, sagten die Schwarzseher dem Wiener Cafe ein betrübliches Ende voraus. Aber hat nicht dieses Wien die Jahrhunderte hindurch zahllose Speisen und Getränke aus allen Richtungen der Windrose übernommen und eingewienert? Auch diesmal, auch dem Espresso ergeht es nicht anders. Wenn es auch heute bereits eine Unzahl von Espressostuben gibt und man genau wie in einer italienischen Stadt so im Vorüberlaufen sein Schälchen leeren kann (ohne Zeitungen natürlich, ohne Wassernachschub, ohne Dauersitzung und literarische Inspirationen), das alte Stammcafė existiert noch und ist durchaus lebendig. Es hat sich bloß eine Espressomaschine zugelegt und ist auf diese Art eine heimliche oder offene, sauber geordnete Symbiose eingegangen. Diese sehr kluge Symbiose steht hinter der Anpassungsfähigkeit der Vorfahren nicht zurück. Das bürgerliche Wien aber ist durch diesen sehr österreichischen Kompromiß gegen alle Arten und Abarten der Managerkrankheit gefeit, ohne daß es auf den Duft des Espresso verzichten braucht, der bereits auch wieder auf einige Arten serviert wird: „kurz”, „gestreckt”, „verlängert” und auf „braun”.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!