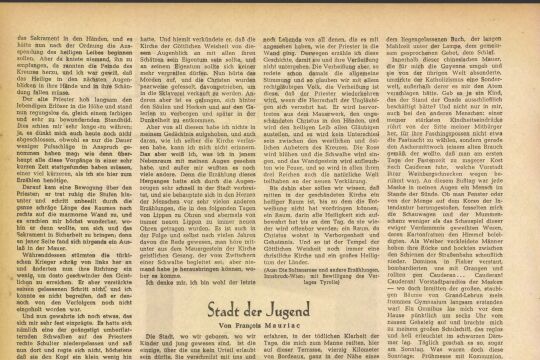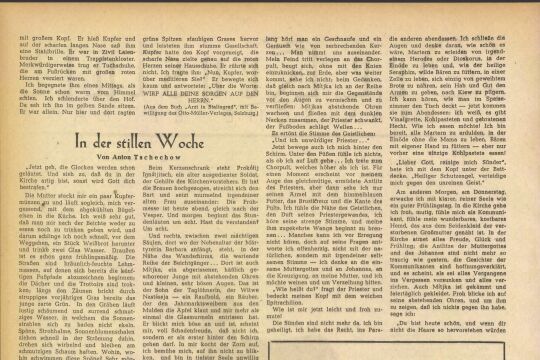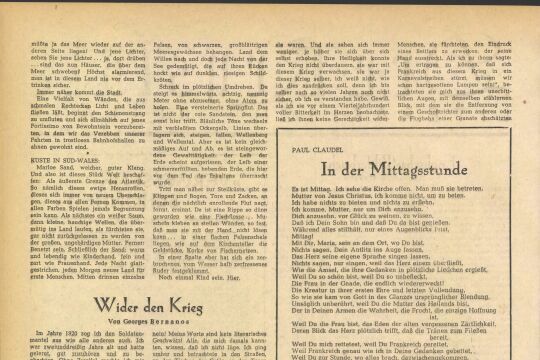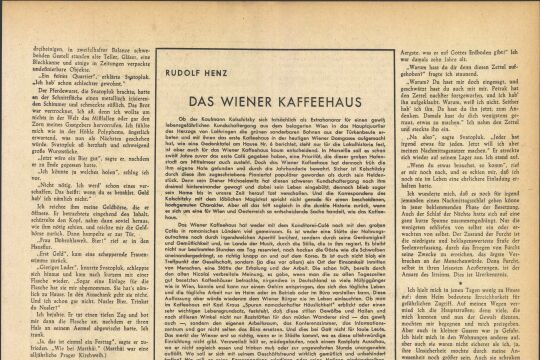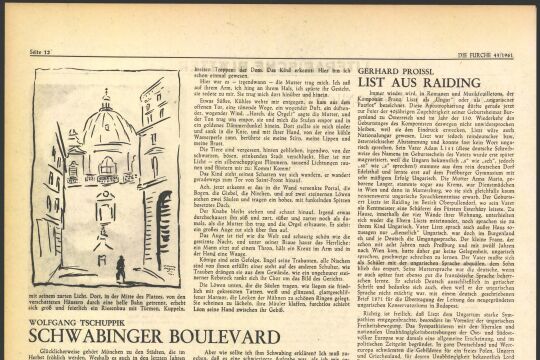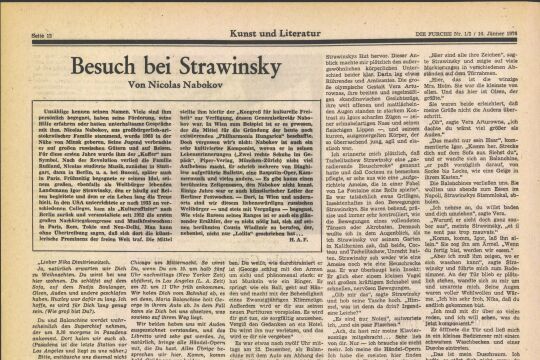Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Dick er im Cafe
Ich habe einen guten Teil meines Lebens im Kaffeehaus verbracht, und ich bedauere es nicht. Das Kaffeehaus ist ein Wartesaal der Poesie. Das Beste am Kaffeehaus ist sein unverbindlicher Charakter. Da bin ich in einer Gesellschaft, und keiner kennt mich. Man redet, und ich brauche nicht zuzuhören. Für mich agieren sie wie Komödianten. Wenn mir der erste beste mißfällt, greife ich nach meinem Hut und gehe ins nächste Kaffeehaus.
Zuweilen statte ich mir selber einen Besuch im Kaffeehaus ab. Manchmal gehe ich in ein halbes Dutzend Kaffeehäuser, ehe ich mich finde. Ringsum sind Spiegel mit zahlreichen gespiegelten Spiegeln, ich nicke meinem Bilde zu und sage: „Guten Abend, alter Freund!“
Wenn ich in Laune bin, ziehe ich mein altes Schulheft und einen Bleistift aus der Tasche, beginne zu schreiben und vergesse alle, die Kellner, die Gäste und mich. Das Kaffeehaus wird mein Parnaß. Ich bin Apoll. Ich schlage die Leier.
Oft leiht mir das Kaffeehaus eine geheime Unabhängigkeit. Ich bin der Fremde, in einer Stadt, wo jeder jeden kennt. Ich bin der Gast an einem Ort, wo jeder andere zu Hause ist.
Ein großer, Teil des Lebens hat Platz im Kaffeehaus, von der Liebe zum Tod, vom Spiel zum Geschäft, nur leiht das Cafe dem großen Publikum die falsche Leichtigkeit eines Balletts. Die meisten Leute gehen ins Cafe wie auf Urlaub vom täglichen Leben.
Als Kind lernte ich im Cafe den Witz der Deutschen kennen. Mein Vater, der täglich mit dem beschäftigten Ernst ins Kaffeehaus eilte, den andere in ihrem Büro zeigen, nahm zuweilen uns Kinder in sein Stammcafe mit. Der Kellner kannte meinen Geschmack. Er brachte, ohne lange zu fragen, eine Melange, eine Schokoladentorte und einen Packen Witzblätter, den „Simplicissimus“, den- „Kladderadatsch“, die ..Meggendorfer Blätter“, den „Ulk“, ferner Maximilian Hardens „Zukunft“ und die „Fackel“ von Karl Kraus, die der Kellner gleichfalls für Witzblätter hielt.
Dort begegnete ich zuerst den modernen deutschen Dichtern, teils schrieben sie in den Witzblättern, teils schrieben die Witzblätter über sie, einige, wie Ludwig Thoma, Thomas Mann oder Jakob Wassermann, waren sogar Witzblattredakteure..
.Damals blickte, ich noch zum Tischrand empor, ein Bübchen von sechs, oder neun Jahren. Ehe ich die. moderne deutsche Literatur ernst nehmen konnte, lachte ich bereits im Cafe über sie oder mit ihr. Schon <als Gymnasiast ibegann ich; allein ins Cafe zu gehen, jeden Mittwochnächmittag, mit Erlaubnis des Rektors vom Gymnasium.'
Nach der Matura ging ich ohne Erlaubnis ins-Cafe, in alle Sorten Cafes, wo Spieler saßen, Liebespaare oder Emigranten, Maler und Poeten. Ich saß in Strandcafes, Waldcafes, Weincafes, in'Cafe-Restaurants und Kabarettcafes, in revolutionären Cafes, wo die Spitzel Kopf an Kopf saßen, in Verbrecherkaschemmen und im „Cafe
Was habt' ick- -nicht ;alie5'^n .Kaffeehäuser erlebt! Ich- spielte-.Schach im „Cafe Hauptwache“ in Frankfurt. In Marrakesch deutete mir ein Schlangenbeschwörer die Zukunft. Im „Cafe Royal“ in London aß ich Austern und Kaviar mit proletarischen Schriftstellern.
Im „Cafe Rotondo“ am Montparnasse saß ich an einem Silvesterabend zwischen zwei deutschen Dichterinnen im Exil, eine war aus Köln, die andere aus Mainz; die Irmgard Keun wollte, wir alle- sollten inen fremden Herrn vom Nebentisch an seinem schwarzen Vollbart berühren, das bringe uns Glück, indes die Anna Seghers verstört in den* zahlreichen wandhohen Kaffeehäusspiegeln imaginäre oder reelle Spitzel ver-folgutigswahnsinniger Diktatoren suchte. Drei Tische, weiter saß Joseph Roth und machte gleichzeitig einer bayrischen Gräfin und deren Tochter den Hof.
Im Cafe betrog ich den Müßiggang der andern mit meiner Arbeit. Ich sah wie ein Müßiggänger aus, aber neben mir zwitscherten die jungen Mädchen-wie' Stare. Wenn ich auf - der Straße an einem der ausgesetzten Kaffeehaustische saß, wehte derselbe Wind durchs schmachtende Laub am Straßenrand und durch die Seiten meines Schreibheftes. Die gleichen Autos fuhren an mir und meinen Figuren vorüber. Wenn das Liebespaar in meinem Roman verstummt, begann das Liebespaar.am Nebentisch zu reden.
Ich saß vor der Tanzfläche in den Tanzcafes, und die Liebespaare tanzten im Tangorhythmus in meinen Roman'hinein und entstiegen meinem Heft wie einem Taxi und setzten sich an meinen Tisch und stritten mit mir und untereinander. Ich drohte, ich würde sie vor dem letzten Kapitel sterben lassen, aber„ sie seufzten, nur und tranken Likör und kosten im Zank und zankten kosend.
j Ich schrieb, versunken oder enthoben, als säße ich auf einem Leuchtturm im Meer oder an einer der tausend Quellen der großen Oasen inmitten der Sahara, und hörte die Rufe der Muezzin, das Allah il Allah. Die Kamele lagerten neben mir, wiederkäuend, und ich roch den Duft der Dattelpalmen und des schwarzgebrannten Kaffees.
• Bald wird es ein halbes Jahrhundert sein, daß ich in meinen Cafes sitze und schreibe. Ich sah die Fiebergespenster und die fröhlichen Helden eines halben Jahrhunde:ts. Ich schrieb das Jahrr hundert auf, ich schrieb es ab. Ich notierte alles * und prophezeite die Zeit,. das Beste und das Schlimmste, die ' Himmel und haufenweise die Höllen. ,: ,
Ich ' träumte so heiter im , Cafe. Alle Alpträume der Menschheit gehen an mir vorüber. Hier und da bleibt ein hübsches Mädchen stehen. Hier und da setzt sich ein geistreicher Mann zu mir. Hier und da grüßt mich ein Engel oder ein Genius. Die böse Zeit legt sich schlafen für ein oder zwei Stunden, und das Jahrhundert scheint hell und heiter. Die Kellner gehen auf müden Füßen, aber ihre Hände lächeln in der Vorahnung üppiger Trinkgelder. Immer sitzt links von mir ein Gast, der gerade mit mir schwatzen will. Immer sitzt rechts von mir ein Gast, der wie eine Geschichte von mir aussieht. In der Ecke gähnt, kichert oder zankt ein Liebespaar. Immer sitzt eine einzelne Dame da, als hätte nicht nur ein einziger Mann sie versetzt, sondern das ganze männliche Geschlecht.
Keine Stadt ist so fremd, ich brauche mich nur in ein Cafe zu setzen, schon fühle ich mich zu Hause. Der Müßiggang verbindet die Menschen Ich ziehe es vor, angesichts müßiger Menschen zu arbeiten, statt angesichts arbeitender Menschen müßig zu sein. Ich beobachte mit Vergnügen, wie sie vergnügt sind. Verliebt gewahre ich die Verliebten. Lachend nehme ich an ihrem Gelächter teil.
Ich beobachte, wie sie miteinander glücklich sind, und wie sie einander lieben, und wie sie zusammen unglücklich sind, einander hassen, und wie sie allein sind und mit sich selber reden, mit sich selber kämpfen, ich einsam fühlen, wie sie ungeduldig warten, geduldig verzweifeln, eilig kommen und gehen, nachdenken, mit sich und anderen schwatzen, tausend Tode sterben und jeder ein einziges Leben leben.
Ich schreibe diese Zeilen auf der Piazza del Popolo in Rom, es ist sechs Uhr nachmittags. Ende September. Ich sitze vor dem Cafe Rosati.
Der Himmel über mir zeigt ein vermischtes Blau und Rot; nur “die Wolken, die wie Wellen ziehen, sind rot dürchhaucht, im sanftesten Ab* schein ungeheurer Flammen. Zur Rechten stehen die beiden barocken Zwillingskirchen, links die Porta del Popolo, daneben die tausendjährige Kirche Santa Maria del Popolo mit ihrer frühen Renaissancefassade.
Mir gegenüber sind Brunnen, Statuen, die Treppen zum Pincio und die Terrasse, die Val-dier gebaut hat, mit Zypressen, Palmen und Pinien und einem Neptun und Tritonen wie aus dem Hofstaat von Louis XVI. Daneben ist das Literatencafe „Canova“, an der Bar plaudern die jungen Schauspielerinnen, Regisseure und Dichter der Radiotelevisione Italiana. Im Kloster an der Ecke hat Martin Luther gewohnt. Von der Via Flaminia ritt Goethe durch die Porta del Popolo, von meinem Tisch sehe ich das Haus am Corso, wo er seine römischen Jahre verlebt hat.
Ist mein Cafe kein hübsches Schreibzimmer für einen Poeten? Eben geht Alberto Moravia vorbei, er wohnt um die Ecke in der Gänsegasse, er summt und blickt allen Frauen nach. Ein Kutscher hält auf seinem Kutschbock vor meinem Tisch. Das Pferd, braun und vernünftig, wiehert leise und blickt in die Richtung des Tibers, als sähe es den nahen Fluß. Zwei Französinnen plappern am Nebentisch über Gott und die Sagan, mit Stimmen wie aus Porzellan., Schwarzlockige, olivenbraune Jünglinge, allzu hell gekleidet, gehen vorüber. Ein Chinese trägt, eine Aktentasche, eine Zigeunerin ein geliehenes Kind im Arm. Der Autobus „C“ fährt in beiden Richtungen vorüber, in der einen Richtung bin ich mit ihm in fünf Minuten am Pantheon, in der anderen in Parioli, Vor meiner Wohnung. Ich habe schon bezahlt. Ich kann jeden Augenblick aufstehen und gehen. Die Glocken der drei Kirchen am Platz beginnen zu läuten. Schon funkeln die Sterne am Himmel.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!