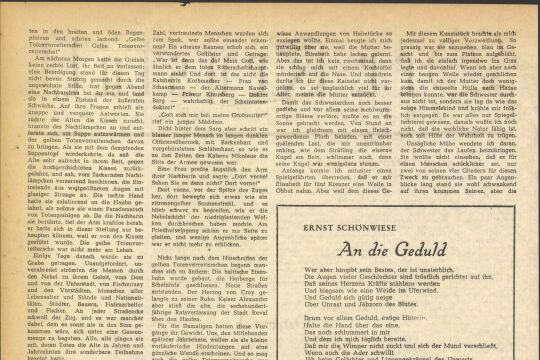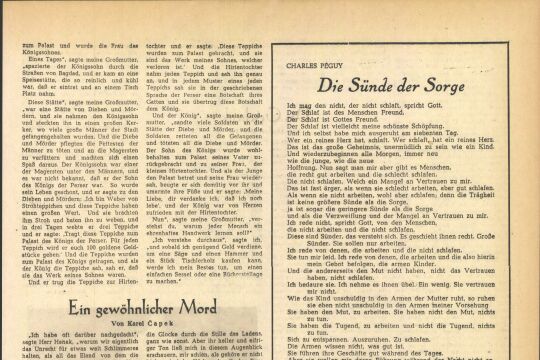Zwischen Tür und Angel
Geschrieben wurde diese Erinnerung anläßlich des Entschlusses des Styria- Verlages, Alfons Petzolds Roman „Das rauhe Leben“ in der Reihe „Wiedergefunden“ herauszubringen. Der Roman'ist jetzt erschienen.
Geschrieben wurde diese Erinnerung anläßlich des Entschlusses des Styria- Verlages, Alfons Petzolds Roman „Das rauhe Leben“ in der Reihe „Wiedergefunden“ herauszubringen. Der Roman'ist jetzt erschienen.
Wer will denn das heute noch lesen?“ wurde erst kürzlich gefragt, als von der Neuauflage des Petzoldschen Romanes „Das rauhe Leben“ die Rede war. Die Arbeitsnot der Väter, die hungrigen Kinder, siechen Mütter, die wackligen Möbel in spärlich beleuchteten Kammern, die die Hinterzimmer der Monarchie waren? „Das ist leserisch nicht mehr zu verkraften“, hieß es skeptisch, „das Elend hört darin über 500 Seiten nicht auf.“
Es stimmt, auch in die Erzählung „Kesselflickerbub“, die ich in diesem dicken Erzählband fand, scheint niemals die Sonne. Es regnet unaufhörlich. Der viel zu große, wahrscheinlich vom Vater geliehene Rock des Zehnjährigen ist durch und durch naß. Seit Stunden klappert er schon Straßen und Häuser nach löchrigen Häferln und Töpfen ab, die er flicken will. Ohne Erfolg. Niemand läßt ihn ein, niemand gibt ihm etwas, bis auf die Haut ist der Bub schon durchnäßt. Er weiß nicht wohin. Aus den Türspalten fremder Wohnungen bellt man ihm abweisende Worte entgegen. Viele Türen bleiben überhaupt zu.
In Wien haben die meisten Eingangstüren eine Kette. Die verhindert, daß die Türe, wenn sie eine Handbreit geöffnet wird, von außen ganz aufgerissen Werden kann. Gegen Bettler, Hausierer und Einbre- cliė9.rGė?ade''soviel Räum läßt’i‘ė!frei, daß der Briefträger die Post oder ein Fremder eine Nachricht durchgeben kann.
Auch meine Wohnungstür hat so eine Kette, nur benutze ich sie nie. Auch an jenem Tag stand ich nichtsahnend beim Läuten auf. Wird wohl die Nachbarin sein, dachte ich, die mir, redefreudig wie sie ist, erzählen wird wollen, was sie billig eingekauft hat. Hat keinen Sinn, so zu tun, als wäre ich nicht da. Ich nehme mir vor, ich mache es kurz.
Ich öffnete die Tür und erschrak.
Ein Mann stand vor mir im schäbigen dunklen, viel zu breiten Rock. Die Hose war ausgebeult und zu lang. Sie fiel über seine spitzen Schuhe, die heute keiner mehr trägt. Da hatte ich die Tür schon offen, stand ihm gegenüber und sah seine Hände, die er mir ent gegenhielt.
„Verhn, Hahn S Mehr, Schehn z schlhn.“
Ich verstand kein Wort von dem Gestammel, das er mühsam zwischen den Lippen hervorpreßte. Sehr weich, sehr dunkel und bedrohlich klang das Gutturale, das der Fremde mit dem Wolfsrachen ausstieß.
Ein Messerschleifer, durchfuhr es mich, wie kam der hierher?
Die Zigeuner fielen mir ein, die in meiner Kindheit oft das Dorf meiner Großmutter heimgesucht haben. „Rastelbinder“ wurden sie genannt, die beim Sportplatz hinter den Feldern ein Lager aufschlugen. Vorne auf der Hauptstraße zogen dann die Männer und Frauen mit Besen, Sieben und Körben von Tür zu Tür, ihre Ware mit lauten, fremdartigen Liedern anzupreisen. „Kommt herein, Kinder, und bleibt im Haus“, hieß der Befehl. Die Dorfstraße war seltsam leer. Nur hinter den Gärten, „,hint- aus“, wie die Sandstraße zürn Fußballplatz damals noch hieß, trafen die mutigsten der Kinder zusammen, um halb verängstigt, halb fasziniert, die Tiere und Planwagen der Straßenhändler zu mustern. Stimmt es, daß Zigeuner kleine Mädchen fressen?
Aber hier in der Stadt? Ein wandernder Gesell? Zehn Jahre wohne ich jetzt in diesem Haus, noch nie hab’ ich einen Hausierer oder gar Wandergewerbler gesehen. Vor allem Handwerker, man weiß doch,’wollen öfters gebeten sein, ehe sie zu erscheinen geruhn. Und überhaupt Messerschmiede, ich dachte, die gibt es nicht mehr.
Allmählich verstand ich, was der Fremde nun schon zum dritten Mal seinem regungslos dastehenden Gegenüber vorleierte.
„Ha Sie Meher, Schehn zum Schleihen?“ gurgelte er und machte dabei ein so freundliches, verschmitztes Gesicht, als wäre er der treuherzigste Bittsteller der Welt.
Natürlich stand in Gedanken längst der Kesselflickerbub Petzolds vor mir. Unbarmherzige Wohnungsbesitzer haben ihn unbarmherzig auf dem Gang stehen lassen. Bis zur Dunkelheit lief er, ohne Arbeit zu finden, umher, bis er irgendwo in einem Rinnsal zusammenbrach. Die weiße Schwesternhaube, die sich im Krankenhaus über ihn beugte, kahl ihm wie Engelsschwingen vor, bevor er an Lungenentzündung starb.
Zweifellos wollte ich nicht unbarmherzig sein. Gerade die franziskanische, tiefchristliche Liebesbereitschaft Petzolds war es doch, die ich mit achtzehn Jahren meinem Maturaprüfer mit so viel Leidenschaft vortrug, weshalb ich auf meine Arbeiten auch „sehr gut mit Auszeichnung“ bekam.
Aber meine Angst? Ich war allein am Gang. Zum Teufel mit der Nachbarin, warum schaut sie gerade an diesem Tag nicht heraus? Man liest doch so viel von Männern, die sich als Gaskassier ausge ben. Die den Fuß rasch in die Tür stellen. Dann von der Leiche einer Frau, die erst gefunden wird, wenn sie schon stinkt. Mitleid und Angst kämpften in mir miteinander, paralysierten mich, so daß ich nicht sagen kann, weshalb ich die Tür nicht sofort wieder schloß. Daß reine Nächstenliebe mich an der Schwelle festgehalten hätte, wäre gelogen. Ich muß starr vor Angst gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war es der Fremde, der das weitere Geschehen bestimmte.
Die Situation, daß Frauen sich vor ihm, vor seinem schäbigen Äußeren, viel mehr noch vor seinem Sprachdefekt schreckten, muß ihm vertraut gewesen sein. So daß er von sich aus das Entsprechende unternahm. Er wich einen Schritt zurück und wiederholte nochmals mit rührender Geste und hilflosen Wortfetzen, daß er nichts anderes als Arbeit von mir wollte.
Natürlich hatte ich Messer und Scheren zum Schleifen. So gut wie alle Schneidwerkzeuge meines Haushalts waren stumpf. So daß ich allmählich, die Chance begreifend, praktisch zu fragen begann. „Was kostet denn das?“
Er bellte verschiedene Zahlen. Ich hörte aufmerksam hin und wiederholte, was ich verstand. „Zehn Sehnl ling ein kleines, zwanzig ein großes und fünfzehn eine Schere?“
Er nickte. Er schien sich über das kommende Geschäft zu freuen. Jedenfalls deutete ich einerseits so seine freudig aufleuchtenden Augen. Oder unterstellte ich ihm da leichtgläubig etwas? Das verschmitzte Zwinkern könnte anderseits auch Gier oder die Gerissenheit eines Taschenspielers sein.
Noch war Zeit, die Tür zuzuwerfen. Ich wußte aber gleichzeitig, ich würde es bereuen. Denn so groß wie mein Mißtrauen war auch meine feste Absicht, nicht zu jenen feigen Bürgern in warmen Wohnungen zu gehören, die einen Zeitgenossen draußen stehen ließen. Draußen vor der Tür. Auch Borchert mahnte mein literarisch gespeichertes Gewissen. Dieses soufflierte, daß hier der Moment sei, Gutes zu tun. „Laß diesen Moment nicht vorbei, tu’s.“ Schon wollte ich die Messer holen. Wie aber, wenn er sich mit ihnen aus dem Staub machte?
„Und wo haben Sie Ihren Schleifstock?“ fragte ich.
„In der Einfahrt“ muß die Antwort gelautet haben, jedenfalls verstand ich sie so und fragte nicht weiter, in welcher.
„Und wie lange dauert’s?“ hab’ ich schon forscher gefragt. Mit seinen fuchtelnden Händen wollte er mir deuten, daß er in einer Stunde zurück sei.
Nun gut. Der theoretische Teil des Handels wäre besprochen. Wie aber jetzt gehen und die Messer holen? Ich müßte sie suchen und auch die Scheren, das würde dauern. Die Tür kann ich in dieser Zeit nicht offen lassen. Er käme mir dann doch nach!
Wieder schwankte ich zwischen Panik und Wohlerzogenheit. Die gewöhnliche mitteleuropäische Höflichkeit ließ es nicht zu, jemandem die Tür vor der Nase zu schließen. Dann aber schien mir eine kurzfristig geschlossene Tür mit dem Berufsrisiko eines Wanderhandwerkers vereinbar. Ich fühlte mich dazu berechtigt. War schließlich doch meine Tür. Dachte, er wird es gewohnt sein. Ja, er habe gar kein Recht zu verlangen, daß die Leute ihm trauten, er müsse ja wissen, wie unsicher die Zeiten sind und daß vor allem Frauen sich fürchten so allein mit einem Fremden am Gang. Jeden Augenblick ist von einem Unglück zu lesen…
Ob das beängstigend kleine Männchen überhaupt Zeitungen liest, fragte ich mich überflüssigerweise noch, dann sagte ich höflich „Warten Sie, bitte“ und schloß hinter mir die Tür.
Rasch hatte ich die großen und kleineren Messer beisammen, addierte flugs dreimal zehn und zweimal zwanzig, legte dann noch zwei kleine Scheren aus dem Nähzeug dazu, nachdem ich mich, so hastig arbeiteten Hirn und Hände, vergewissert hatte, genausoviel wie es kosten würde auch im Geldbörsel zu haben, damit dann beim Zahlen nicht ein peinlicher Handel entsteht, dann nämlich, wenn er auf meinen zu großen Schein nicht rausgeben könnte. Darauf öffnete ich wieder und hielt ihm die Geräte hin.
„Also dann in einer Stunde.“
Daraufhin wollte ich zum Schreibtisch zurück. Mit der Konzentration war es aber dahin. Petzold und Franz von Assisi und Wolfgang Borchert standen neben mir und sahen mich an. Redeten hämisch zu mir.
Petzold: Warum zögerst Du, einem armen Menschen zu helfen?
Ich: Aber auch ich bin ja nicht reich.
Franz von Assisi: Du sitzt in einem geheizten Zimmer, er wandert von Tür zu Tür.
Ich: Bewegung ist doch an und für sich gesund. Sehen Sie mich an. Mein sitzender Beruf ist viel schlechter für den Rücken…
Wolfgang Borchert: Der Mann hat vielleicht kein Zuhause.
Ich: Wer weiß, vielleicht war er insgeheim reich. Man hört doch immer wieder von Bettlern, die in ihren Matratzen Millionen horten…
Der Kesselflickerbub (wo kam der denn plötzlich her?): Du weißt, daß ich mich ohne Geld nicht nach Hause getraut habe…
Gottlob war die Stunde des Verhörs bald um. Als es läutete, eilte ich fröhlich zur Tür, reichte ebenso fröhlich dem Männchen die Hand, um die Messer in Empfang zu nehmen. Er muß gutes Geschäft gemacht haben, dachte ich, denn er hielt noch mehrere in der Hand, ohne die meinen mit diesen anderen zu verwechseln. Ich gab ihm hundert Schilling als wohlverdiente Gage, und dies alles begleitete er mit seiner verstümmelten Rede. Er Schien sich zu freuen, "daß ich Zutrauen gefaßt hatte, weshalb er auch so Bemerkungen fallen ließ und diese mit beredter Gestik unterstrich. Er deutete an, daß er gar nicht vorhabe, in fremde Wohnungen einzudringen, nicht einmal die Fußmatte wolle er betreten, heute wäre ein sehr guter Tag für ihn, er sei durstig geworden, ob ich nicht ein Glas Wasser hätte für ihn?
Ein Glas Wasser!
Da rollte er schon wieder ab in mir, der Film über die trickreichen Ver- . brecher, Räuber und Mörder, die sich in die Wohnungen wehrloser Frauen eingaunem. Ob er die Nachbarin vielleicht schon umgebracht hat? So still war es in ihrer Wohnung da drüben noch nie.
Schon wieder stand ich ratlos und verschreckt im Türrahmen. Und schon wieder das volle Mitleid: Warum ihm kein Wasser geben? Ein Scherenschleifer, der stundenlang in einer Einfahrt steht, muß durstig sein, lispelte mein Gewissen, was mich aber auch nicht auf Trab brachte, sondern aufs Neue paralysierte. Und wieder war es der andere, der vor meinem Zaudern einen Schritt zurückwich und der mir lächelnd gestattete, die Türe, von der er ohnehin zwei Meter entfernt stand, zu schließen. Er werde warten, deutete er, ich könne ruhig gehen.
Noch einmal getraute ich mich nicht, jetzt nach dem freundlichen Messertauschhandel, ihm die Tür vor dem Kopf zuzuschlagen, das Schloß machte ein so feindliches Geräusch. Was soll der arme Kerl denn von mir denken? Ich lehnte diesmal den Türflügel nur an, huschte in die Küche hinüber, suchte nach einem Glas, drehte den Wasserhahn auf, dies alles, während ich überreizt und hysterisch auf Geräusche vom Gang horchte. Ich hörte aber nichts. Das Glas war voll. Ich brachte es zur Tür. Der Mann stand immer noch auf seinem Fleck und lächelte und bedankte sich lallend, als ich ihm das Wasser gab.
DAS RAUHE LEBEN. Von Alfons Petzold. Styria Verlag, Graz-Wien- Köln 1979, 499 Seiten, öS 298,-