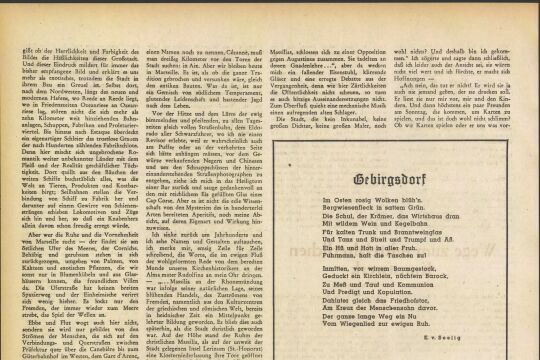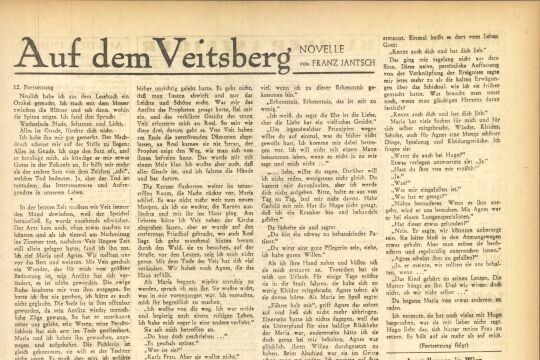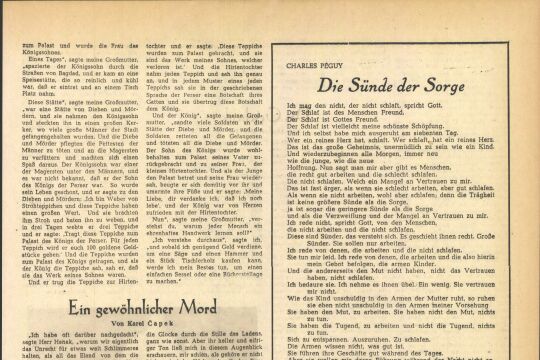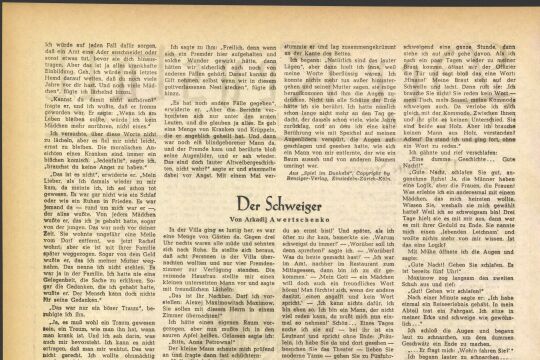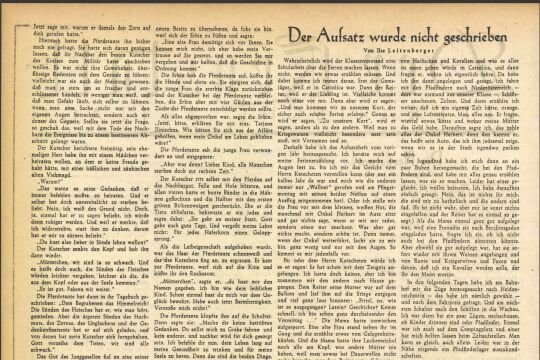Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Paar alte Pantoffel
Um mit dem zweiten anzufangen, von der Liebe von Romeo und Julia, auf die bekanntlich der zweite Satz angewendet ist, halte ich nicht viel. Wer weiß, was daraus geworden wäre, nach, sagen wir dreißig, vierzig Jahren. Man weiß doch, je mehr Liebesheiraten, um so mehr Scheidungen. Romantik ist ganz gut, damit die Paare zusammenkommen, aber dann muß gleich etwas dazukommen, sonst geht es schief. Aus dem Eros muß Caritas werden, dann hat die Sache Dauer.
Wenn ich von der größten Liebe reden soll, die ich fand, dann muß ich an meine grauen Pantoffel denken, durch die ich damit verbunden bin. Die grauen Pantoffel sind alt geworden, besorgt betrachtete ich neulich Sohle und Oberleder, sie gehen aus dem Leim oder, besser gesagt, aus der Naht. Ich habe mir zu Weihnachten neue gekauft, aber die alten habe ich nicht weggeworfen, ich hebe sie aus Pietät auf, und wenn ich auf Reisen gehe, nehme ich sie mit, weil sie weniger Platz brauchen als die neuen. Doch das ist nur das übliche Gerede am Anfang, jetzt gehe ich mitten in die Geschichte hinein.
Wer es nicht wissen sollte, ich bin von Beruf Pfarrer, katholischer Pfarrer, seit vielen Jahren und da erlebt man natürlich allerlei, vieles kann man nicht sagen, was wahrscheinlich das Interessanteste wäre, aber manches darf man doch erzählen, zum Nutzen und Frommen der Zuhörer, wie ich hoffen will. •
Zu meiner Pfarre gehörte eine soge-nanntet wilde Siedlung, wie sie in der ersten Nachkriegszeit entstanden sind. Die meisten waren kaum zur Hälfte mit dem Häuschen fertig, da wurden sie arbeitslos, man kann sich den Jammer denken. Aber immerhin, das waren wenigstens, wenn Buch unvollendet, Häuser, aber die Hütte, in der mein Romeo und Julia wohnten, war etwas Einzigartiges. Sie erinnerte mich an dieHütten derFellachen im Orient. Sie bestand nur aus einem einzigen winzigen Raum, dessen Wände so dünn waren, daß man sie mit einem Fußtritt hätte zertrümmern können. Damals war ich neu in der großen Gemeinde und ging wie ein Agent von Haus zu Haus,um die Leute kennenzulernen. Ich war schon am letzten Haus der Siedlung, da fragte ich: „Dort hinten wohnt niemand mehr, das scheint ein Stall für Ziegen zu sein?“
Doch, dort wohne jemand, den ich unbedingt besuchen müsse.
Also ging ich hin. Welch ein Elend, welch eine Not traf ich da an!
Das Häuschen habe ich schon beschrieben. Im Innern stand in einer Ecke ein kleiner Blechherd und das Bett, ein alter Kasten und eine Kiste. Das war alles. Die Wände waren roh, das Malter war abgesprungen, die Decke war so nieder, daß der Raum an einen Sarg erinnerte. So etwas war mir noch nicht untergekommen. Und hier sollen Menschen wohnen? Niemand war zu sehen.
.Hochwürden“, hörte ich jemand mit einer merkwürdig hohen Stimme mir zurufen.
Richtig, da lag eine Frau im Bett. Es war heller Nachmittap. Sie war gepen Fünfzig und erschien mir ein wenig aufgedunsen.
„Sie sind krank“, sagte ich. .wie lange liegen Sie schon im Bett?“ Da lachte sie.
„Sie werden es nicht glauben. Ich habe seit zehn Jahren das Bett nicht verlassen.“
Das verschlug mir die Rede. Bei einem späteren Besuch hat sie mir erzählt, wie sie das letztemal in der Stadt war. Dabei lag ihr Häuschen eine halbe Stunde südlich von der Spinnerin am Kreuz.
„Im Jahre 1922 war ich das letztemal in der Stadt.“
Als sie es erzählte, schrieben wir das Jahr 1937.
„Ich habe Wien gern“, sagte sie, „ich bin eine Wienerin. Mein Mann erzählt mir immer, was sich alles verändert hat. Vieles muß anders sein als vor fünfzehn Jahren. Damit habe ich mich abgefunden, daß ich Wien nicht mehr sehen werde. Aber aufstehen möchte ich können und dem Mann etwas kochen, wenn er heimkommt. Der Arme muß sich alles selber machen.“
Da sah ich ihre Hände. Sie waren entstellt, ein Fettwulst schob sich bis zu den kleinen steifen Fingern vor. Sie konnte nur die Hand als ganzes gebrauchen, aber nicht die einzelnen Finger.
„Warum beliebst du, manche so über alles Maß zu schlagen?“ seufzte ich im Geiste zu Gott. Auch wunderte ich mich, daß er mich so geschont hat.
Bei der armen Frau wunderte ich mich noch über etwas anderes, über ihre Heiterkeit. Sie klagte nie. (Oh, ihr anderen, die ihr immer klagt, wo euch Gott so geschont hat, ihr Wehleidigen.) Sie plauderte munter und froh und fand noch immer etwas, worüber sie sich freuen konnte.
„Ich habe einen braven Mann“, sagte sie, „was glauben Sie, was das wert ist. Ich sage zu ihm, du Armer, ich bin dir nur eine Last, und was glauben Sie, was er darauf antwortet? ,Du bist doch meine Freude, was tat ich ohne dich.' So ist mein Mann. Und gute Nachbarn habe ich. Ich bin doch den ganzen Tag allein. Wenn ich jemand brauche, dann brauche ich nur zu rufen und sie kommen.“ (Die ganz Armen, auf denen die Hand Gottes schwer liegt, die halten mehr zusammen und sind hilfsbereiter als die Gesättigten!)
„Und noch ein großes Glück habe ich. Aber das müssen Sie selber sehen. Das muß ich Ihnen zeigen.“
Sie schickte mich um eine Schachtel, in der sie mit den unbewegten Fingern (oh, es war erschütternd anzusehen) nach Bildern suchte.
„Nehmen Sie das heraus, bitte“, sagte sie zu mir und sah mich erwartungsvoll an. Ich sah ein junges stattliches Mädchen mit einem Häubchen der Krankenschwestern auf dem Kopf.
„Was sagen Sie?“ fragte sie gespannt.
„Ein hübsches Mädchen“, sagte ich.
„Nicht wahr? Das ist meine Tochter. Als ich jung war, habe ich genau so ausgesehen. Wie gesund sie ist. Ich bin so froh mit dem Kind.“
„Wo lebt sie denn? Sie ist doch nicht hier?“
„In Linz ist sie im Krankenhaus. Sie ist Krankenschwester und hat ein Diplom. Sie hat sehr viel zu tun. Sie ist so tüchtig.“
Mit der Zeit kam ich darauf, daß die Tochter aus der ersten.Ehe war, mit dem neuen Vater schien sie nicht gut zu stehen. Ich habe später mit ihm über sie geredet. Er sagte so:
„Die Frau wartet immer auf sie und das Luder will von ihr nichts wissen, sie schämt sich ihrer und meiner.“
„Sie lebt in Linz?“
„Weiß der Teufel, wo sie sich herumtreibt. Das Häubchen hat sie sich wo ausgeliehen.“
„Und das Diplom?“
„Das ist ein anderes Diplom, von dem wir nicht reden wollen. Aber lassen Sie bei der Frau nichts verlauten. Ich erfinde immer neue Geschichten, warum sie nicht kommen kann. Ich lasse Briefe schreiben, mit der Maschine, daß sie die Handschrift nicht kennt, lauter Lügen, um die Arme zu trösten.“
Also das König-Lear-Motiv dachte ich bei mir. Hier geht es nach den großen alten mythischen Vorbildern.
Und nun von dem Manne: Er war älter als sie, ein zäher Sechziger, ein wenig gebeugt, mit einem Schnurrbart.
Ständig fuhr er mit dem Rad in der Gegend herum, immer auf Geschäfte aus, hatte er es eilig, aber die Geschäfte liefen ihm davon. Er hatte früher einen andern Beruf gehabt, jetzt war er ein Mann für alles. Dort hackte er Holz, da reparierte er einen Zaun, dann machte er Botengänge, brachte überflüssige Hunde an den Mann und vieles andere. So recht und schlecht konnte er alles, aber damals war die halbe Welt arbeitslos.
Später ist er zutraulich geworden und oft zu mir ins Haus gekommen, immer mit dem Fahrrad und der hängenden Schulter. Ich habe ihm kleine Pfuschereien machen lassen und für die Frau etwas mitgeschickt.
Noch einige Worte über den Mann. Er hatte einen kleinen Fehler — wer hat keinen? —, er brauchte hie und da einen Schluck Schnaps. Er hat es mir auch erklärt.
„Wissen Sie, Herr Hochwürden, ganz langsam steigt mir der Jammer empor, er droht, mir die Gurgel zusammenzudrücken, dann ein Quartierl und ich übertauche die Krise, es geht wieder.“
Betrunken war er nie.
Er war der treueste der Männer, die ich getroffen habe. Ach, ihr Männer könnt so charakterlos gegen eure Frauen sein, wenn ihnen etwas fehlt, so lieblos und gemein. Wollen wir nicht drüber reden, wir wissen Bescheid.
Aber dieser Gute ist ein Ruhmesblatt. Den ganzen Tag fuhr er mit seinem Rad Geschäfte machen, irgendwann gegen Abend kam er heim, froh und munter, kochte und tat, was zu tun war, ohne zu klagen.
Freilich, mit der Zeit gewöhnt man sich an vieles, wenn man ein gutes Herz bat, auch an etwas Schweres, aber das mindert sein Verdienst nicht.
Später ist es mir ganz gemütlich in der Hütte vorgekommen. Wozu Teppiche, wozu Vorhänge, gestrichene Wände und Türen, vor 100.000 Jahren haben wahrscheinlich alle Menschen in ähnlichen Verhältnissen gelebt. Ich meine, auf das Menschenherz kommt es an, nicht auf die Zivilisation. Und die beiden hatten gute Herzen, die besten.
Und nun habe ich, lieber Leser, noch immer nichts von den Pantoffeln erzählt. Jetzt komme ich dazu und damit geht die Geschichte auch schon zu Ende.
Eines Tages ist die Gute einfach eingeschlafen. Der Mann brauchte ihr nicht einmal die Augen zuzudrücken. Sie war den Weg des armen Lazarus gegangen. Welche Wonnen mögen ihr bereitet worden sein, als sie in den Himmel einzog. Welch ein Glanz mag von ihr ausgegangen sein!
Und wir begruben sie. Die paar Leute von der Siedlung waren da und ihr Mann. Schönen Anzug hatte er keinen und die Tränen sind ihm im Bart hängengeblieben. Und ich war auch — sehr gerührt. Es war mir, als hätte ich eine Schwester verloren, so gern habe ich sie gehabt, die Arme und jetzt so Glückliche.
Einige Tage nach dem Begräbnis kam er zu mir und sagte:
„Die Leiche ist zu bezahlen.“
„Ist schon bezahlt“, sagte ich.
„Geld hätte ich eh keines gehabt“, antwortete er, „aber hier habe ich Ihnen etwas gemacht“, und er zog die Pantoffel hervor. „Zum Dank und zur Erinnerung“, sagte er.
Ich habe sie die ganze Zeit getragen. Sie waren kein Wunderwerk, das graue Oberleder sieht so aus, als wären damit einmal die Sitze in einem Auto überzogen gewesen. Wie halt ein Flickschuster es macht. Es tut mir leid, daß ihre Zeit um ist. Wie gesagt, auf Reisen nehme ich sie mit. Ich denke wieder an eine; eine große weite. Da werden sie mich begleiten und mir gute Dienste tun, und sie werden mich erinnern an die große Liebe zweier Menschen, deren Leben Armut, Elend und Not war.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!