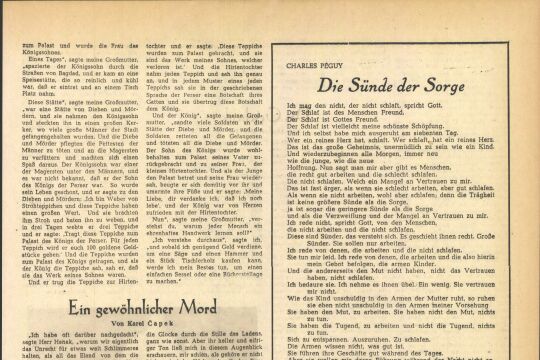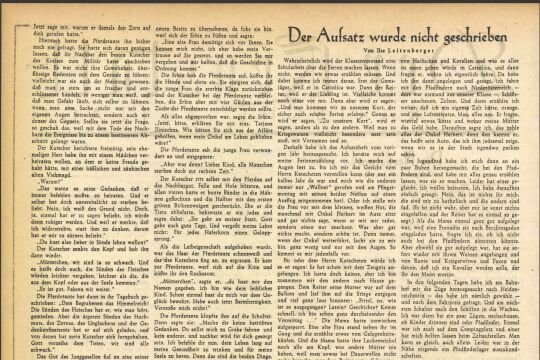Am Abend fand sie mich unter einer Baumgruppe, die vor dem Dorfe wuchs. Sie war mir nie sympathisch gewesen, und wenn ich sie hätte kommen gesehen, so hätte ich mich versteckt. Ich bin der festen Meinung, daß man ihr die Schuld für die Laster ihres Sohnes zuschreiben muß — wenn es Laster waren; doch bin ich weit davon entfernt, dies zuzugeben. Jedenfalls war er freigebig und niemals geizig, zum Unterschied von anderen Leuten im Dorf, die ich mit Namen nennen könnte, wenn ich nur wollte.
Ich starrte gerade unverwandt auf ein Blatt; sonst hätte sie mich gar nicht entdeckt. Das Blatt hing lose an einem Zweig; sein Stengel war entweder vom Wind oder von einem Stein, den eines der Dorfkinder nach ihm geworfen hatte, eingerissen worden, so daß nur die zähe grüne Außenhaut des Stengels das Blatt in seinem schwebenden Zustand festhielt. Ich betrachtete es ganz genau, weil eine Raupe über die Oberseite t des Blattes kroch und dieses in Schwingungen versetzte. Die Raupe steuerte auf den Zweig zu, und ich überlegte, ob sie ihn wohl heil erreichen oder ob das Blatt mit ihr ins Wasser fallen würde. Unter den Bäumen gab es nämlich einen Tümpel, dessen Wasser durch den schweren Lehm auf einem Grund immer rot er* schien.
Ich erfuhr nie, ob die Raupe den Zweig tatsächlich erreichte, denn, wie gesagt, das furchtbare Frauenzimmer entdeckte mich. Die erste Andeutung ihres Nahens war ihre Stimme unmittelbar hinter meinem Ohr.
Ich habe Sie in allen Gasthäusern gesucht“, sagte sie mit ihrer alten, schrillen Stimme. Es war kennzeichnend für sie, daß sie „in allen Gasthäusern“ sagte, wo es doch im ganzen Dorf nur zwei gab. Sie wollte immer Anerkennung für eine Mühe, die sie sich in Wirklichkeit gar nicht gemacht hatte.
Ich ärgerte mich und konnte eine gewisse Schärfe im Ton meiner Antwort nicht unterdrücken. „Sie hätten sich die Mühe sparen können“, sagte ich. „Sie hätten sich denken können, daß ich an einem so schönen Abend wie heute nicht im Wirtshaus sitzen würde.“
Die alte Keiferin. wurde ganz unterwürfig. Sie konnte recht manierlich sein, wenn sie etwas erreichen wollte. „Es ist ja für meinen armen Sohn“, sagte sie. Das hieß, daß er krank war. Wenn es ihm gut ging, dann hörte ich keine schönere Bezeichnung für ihn als „der verflixte Kerl“. Sie hatte es durchgesetzt, daß er jeden Abend der Woche wenigstens um Mitternacht daheim war — als ob man in einem kleinen Dorf wie dem unseren Unfug treiben könnte. Natürlich entdeckten wir bald, wie wir sie betrügen konnten; aber ich stieß mich an dem Grundsatz: ein erwachsener Mann von 30 Jahren ließ sich von seiner Mutter jeden Schritt vorschreiben, bloß weil sie keinen Gatten hatte, den sie hätte tyrannisieren könne. Wenn er aber krank war, mochte es sich auch nur um eine harmlose Erkältung handeln, dann war er gleich „mein armer Sohn“.
„Er stirbt mir“, sagte sie, „und weiß Gott, was ich ohne ihn anfangen werde.“
„Nun, ich sehe nicht, wie ich Ihnen helfen könnte“, entgegnete ich. Ich war zornig, weil er schon einmal um ein Haar gestorben wäre und sie bis auf das tatsächliche Eingraben alle Nötige veranlaßt hatte. Ich dachte mir, daß es sich diesmal wieder um dieselbe Art des Sterbens handelte, um die Art, über die man hinwegkommt. Erst die Woche zu-jror hatte ich ihn gesehen, wie er auf den Berg ging, um dort im Bauernhof ein Mädchen zu besuchen. Ich hatte ihm nachgeblickt, bis er wie ein winziges schwarzes Pünktchen aussah, das dann plötzlich vor einem viereckigen grauen Kasten mitten in einem Feld stehenblieb. Das war die Scheune, wo sie sich zu treffen pflegten. Ich habe sehr gute Augen und probiere oft zu meiner Unterhaltung, wie weit und wie deutlich ich sehen kann. Vor Mitternacht traf ich ihn wieder und war ihm behilflich, ohne Wissen seiner Mutter ins Haus zu gelangen; damals fühlte er sich noch ganz wohl; nur ein bißchen müde und schläfrig war er.
Doch das zänkische alte Weib legte schon wieder los. „Er hat nach Ihnen verlangt“, krächzte sie.
„Wenn er wirklich so krank ist, wie Sie behaupten“, antwortete ich, „dann täten Sie besser, nach dem Arzt zu verlangen.“
„Den Doktor haben wir ja geholt, aber er kann nicht helfen.“ Ich gebe zu, daß mir dies momentan einen Schrecken einjagte, bis mir der Gedanke kam: Der alte Gauner stellt sich nur krank. Er führt etwas im Schilde. Er war gescheit genug, sogar einem Arzt etwas vorzugaukeln. Ich hatte es miterlebt, wie er einen Anfall simulierte, der selbst einen Kenner getäuscht hätte.
„Um Gottes willen, kommen Sie doch“, rief sie. „Er hat anscheinend Angst.“ Es klang ganz echt, als bei diesen Worten die Stimme brach; auf ihre Art hatte sie ihn nämlich ganz gern. Ich mußte sie sogar ein wenig bemitleiden, weil ich wußte, daß er nie die leiseste Zuneigung für sie aufgebracht und sich auch nie bemüht hatte, ihr diese Tatsache zu verhehlen.
Ich verließ die Bäume, den roten Tümpel und die schwer ringende Raupe, weil ich wußte, daß sie mir nun, wo ihr „armer Sohn“ nach mir verlangt hatte, keine Ruhe mehr geben würde. Doch eine Woche vorher hätte sie noch alles getan, um uns voneinander fernzuhalten. Sie gab mir die Schuld für seinen Lebenswandel, als ob ein gewöhnlicher Sterblicher imstande gewesen wäre, ihn von einer Frau, die danach aussah, fernzuhalten, wenn ihm einmal der Appetit gekommen war.
Ich denke, es geschah jetzt zum erstenmal, seit ich vor zehn Jahren ins Dorf gezogen war, daß ich ihr kleines Häuschen durch die Vordertür betrat. Belustigt blickte ich zu seinem Fenster hinauf, weil ich auf der Mauer die Spuren der Leiter zu erkennen glaubte, die wir die Woche zuvor benützt hatten. Es war uns nicht ganz leicht gefallen, die Leiter gerade anzulehnen; aber seine Mutter hatte einen gesunden Schlaf. Er hatte die Leiter von der Scheune herab mitgebracht, und ich hatte sie wieder dorthin zurückgetragen, nachdem er wohlbehalten in sein Zimmer gelangt war. Aber man konnte seinen Worten nie trauen. Er belog oft seinen besten Freund; als ich die Scheune wieder erreichte, mußte ich entdecken, daß das Mädchen verschwunden war. Wenn er einen nicht mit dem Geld seiner Mutter bestechen konnte, dann tat er es mit den Versprechungen anderer Leute.
Kaum war ich im Haus, da wurde mir unbehaglich zumute. Es war nichts Ungewöhnliches, daß im Haus völlige Stille herrschte, weil die beiden nie Freunde bei sich hatten, obwohl die Mutter eine Schwägerin besaß, die nur ein paar Meilen entfernt wohnte. Aber das Geräusch der Schritte des Arztes, als er uns von oben herab entgegenkam, gefiel mir nicht. Er hatte uns zuliebe eine feierliche Miene aufgesetzt, als ob der Tod, selbst der Tod meines Freundes, etwas Heiliges an sich hätte.
„Er ist bei Bewußtsein“, sagte der Arzt, „aber es geht zu Ende. Ich kann es nicht aufhalten. Wenn Sie wollen, daß er in Frieden stirbt, dann sollten Sie wohl seinen Freund zu ihm hinaufgehen lassen. Er fürchtet sich vor irgend etwas.“
Er hatte recht. Das konnte ich erkennen, sowie ich mich unter der niedrigen Tür bückte und die Stube meines Freundes betrat. Er war von Kissen gestützt und heftete den Blick auf die Tür, weil er auf mein Kommen wartete. Die Augen waren glänzend und hatten einen erschrockenen Ausdruck, und das Haar hing ihm in klebrigen Strähnen über die Stirn. Es war mir noch nie zuvor bewußt geworden, was für ein häßlicher Mensch er eigentlich war. Er hatte listige Augen, die einen allzusehr von der Seite ansahen; aber wenn er sich normaler Gesundheit erfreute, dann war ein lustiges Funkeln in ihnen, so daß man die Verschlagenheit vergaß. Etwas Gewinnendes und Keckes sprach aus diesem Funkeln, als wollte er sagen: „Ich weiß, ich bin verschlagen und häßlich. Aber was tut's? Ich getrau mich was!“ Und ich glaube, es war dieses Funkeln in den Augen, das manche Frauen anziehend und erregend fanden. Aber jetzt, wo es aus seinem Blick verschwunden war, sah er nur mehr wie ein Schurke aus.
Ich hielt es für meine Pflicht, ihn aufzuheitern; also machte ich einen kleinen Witz. Er aber schien keinen Gefallen daran zu finden, und ich begann schon zu fürchten, daß sogar er sein bevorstehendes Ende vom religiösen Gesichtspunkt aus betrachtete, als er mich plötzlich aufforderte, mich zu setzen, um dann mit auffallender Schärfe zu sprechen.
„Ich sterbe“, sagte er und seine Worte überstürzten sich, „und ich möchte dich um etwas bitten. Der Arzt taugt nicht dazu — der glaubt höchstens, ich liege im Delirium. Ich habe Angst, alter Freund. Ich möchte beruhigende Gewißheit haben“ — und dann nach einer langen Pause — „von jemandem mit gesundem Menschenverstand.“ Er rutschte ein wenig von seinen hohen Kissen herab.
„Erst einmal bin ich wirklich ernstlich krank gewesen“, begann er wieder. „Das war noch, bevor du hieher kamst. Ich war nicht viel mehr als ein Bub. Die Leute behaupten sogar, daß man mich für tot gehalten habe. Sie trugen mich schon zum Friedhof hinaus, da hielt sie im letzten Moment noch irgendein Arzt auf.“
Ich hatte von zahlreichen ähnlichen Fällen gehört und sah deshalb keinen Grund, warum er mir jetzt davon erzählen wollte. Aber dann meinte ich seinen Gedankengang zu durchschauen. Schon einmal hatte sich seine Mutter nicht besonders bemüht, genau festzustellen, ob er wirklich tot sei, wenn ich auch nicht bezweifle, daß sie damals von ihrem Schmerz nicht wenig Aufhebens gemacht hatte — „mein armer Bub; ich weiß nicht, was ich ohne ihn anfangen werde“. Und ich bin überzeugt, daß sie damals genau so ihre eigenen Worte geglaubt hatte, wie sie es jetzt tat. Sie war keine Mörderin,- sie neigte nur zur Voreiligkeit.
„Schau, alter Freund“, sagte ich und bettete ihn auf seinen Kissen etwas höher. „Du brauchst dich nicht zu fürchten. Es ist noch nicht zum Sterben; und ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, daß ein Arzt eine Ader anschneidet oder sonst etwas tut, bevor sie dich hinaustragen. Aber das ist ja alles krankhafte Einbildung. Geh, ich würde mein letztes Hemd darauf wetten, daß du noch viele Jahre vor dir hast. Und noch viele Mädchen“, fügte ich lächelnd hinzu.
„Kannst du damit nicht aufhören?“ fragte er, und ich wußte, daß er fromm geworden war. Er sagte: „Wenn ich am Leben bleiben sollte, würde ich kein Mädchen mehr anrühren, nicht eines.“
Ich versuchte, über diese Worte nicht 2u lächeln, aber es fiel mir nicht leicht, ernst zu bleiben. Die moralischen Ansichten eines Kranken sind immer ein bißchen komisch. „Jedenfalls“, sagte ich, „brauchst du keine Angst zu haben.“
„Das ist es nicht“, erwiderte er. „Mein Lieber, als ich damals wieder zu mir kam, da meinte ich, ich 6ei schon tot gewesen. Es war gar nicht wie ein Schlaf oder wie ein Ruhen in Frieden. Es war jemand da — rund um mich war er —, der alles wußte. Von jedem Mädchen wußte er, das ich je gehabt hatte, sogar von der jungen. Das war noch vor deiner Zeit. Sie wohnte ungefähr eine Meile vom Dorf entfernt, wo jetzt Rachel wohnt; aber sie ist mit ihrer Familie epäter weggezogen. Sogar von dem Geld wußte er, das ich meiner Mutter wegnahm. Das nenne ich nicht stehlen. Es war ja in der Familie. Ich hatte nie eine Gelegenheit, die Sache zu erklären. Sogar die Gedanken, die ich gehabt hatte, wußte er. Der Mensch kann doch nichts für seine Gedanken.“
„Das war nur ein böser Traum“, beruhigte ich ihn.
„Ja, es muß wohl ein Traum gewesen sein, ein Traum, wie man ihn hat, wenn man krank ist. Und ich sah darin, was auch mir bevorsteht. Ich kann es nicht ertragen, daß man mir wehtut. Das war nicht gerecht. Ich wollte ohnmächtig werden und konnte nicht; weil ich ja tot War.*
„Im Traum“, entgegnete ich. Seine Furcht machte mich nervös. „Im Traum“, wiederholte ich.
„Ja, es muß wohl ein Traum gewesen sein, nicht wahr, weil ich danach aufwachte. Und das Merkwürdigste daran war, daß ich mich ganz wohl und kräftig fühlte. Ich erhob mich und stand mitten auf der Straße, und in einiger Entfernung war eine kleine Menschenansammlung, die dann etwas Staub aufwirbelten, als sie mit einem Mann davongingen — mit dem Doktor, der sie daran gehindert hatte, mich zu begraben.“
.Na ja“, sagte ich.
„Alter Freund, angenommen, es war wahr“, fuhr er fort. „Angenommen, ich war wirklich tot. Nachher glaubte ich es, weißt du, und meine Mutter glaubte es auch. Aber auf sie kann man sich nicht verlassen. Ein paar Jahre habe ich nach diesem Erlebnis anständig gelebt. Ich dachte mir, es wäre vielleicht so etwas wie eine zweite Gelegenheit. Aber dann ist alles wieder nebelhaft geworden und irgendwie... Mir ist das Ganze unmöglich vorgekommen. Es ist unmöglich. Natürlich ist es unmöglich. Gelt, du weißt, daß es unmöglich ist, nicht wahr?“
„Natürlich ist es unmöglich“, antwortete ich. „Wunder dieser Art geschehen heutzutage nicht. Und es ist auf jeden Fall unwahrscheinlich, daß sie dir passieren sollten; und ausgerechnet hier bei uns.“
Darauf sagte er: „Es wäre ganz grauenhaft, wenn es doch wahr wäre und wenn ich das alles noch einmal durchmachen müßte. Du weißt ja, was für Dinge mir In meinem Traum bevorstanden. Und jetzt wäre es noch viel Ärgeres.“ Er hielt inne und fügte nach einer kurzen Pause hinzu, als stelle er damit eine Tatsache fest: „Wenn man tot ist, dann hört das Bewußtsein nicht auf, in alle Ewigkeit nicht.“
„Natürlich war es nur ein Traum“, sagte ich zu seiner Beruhigung und drückte ihm die Hand. Seine Phantasievorstellungen flößten mir Angst ein. Ich wünschte, er würde schnell sterben, damit ich von seinen hinterlistigen, blutunterlaufenen und erschreckten Augen loskommen und etwas Fröhliches und Aufheiterndes sehen könnte, wie etwa die Rachel, von der ich schon sprach und die ungefähr eine Meile vom Dorf entfernt wohnte.
Ich sagte zu ihm: „Freilich, denn wenn sich ein Fremder hier aufgehalten und solche Wunder gewirkt hätte, dann hätten wir sicherlich auch noch von anderen Fällen gehört. Darauf kannst du Gift nehmen, selbst wenn wir in diesem gottverlassenen Nest stecken“, fügte ich hinzu.
„Es hat noch andere Fälle gegeben“, erwiderte er. „Aber die Berichte verbreiteten sich nur unter den armen Leuten, und die glauben ja alles. Es gab eine Menge von Kranken und Krüppeln, die er angeblich geheilt hat. Und dann war noch ein blindgeborener Mann da, und der Fremde kam und berührte bloß seine Augenlider, und er sah wieder. Das sind doch lauter Altweibergeschichten, nicht wahr?“ sagte er und stammelte dabei vor Angst. Mit einem Mal verstummte er und lag zusammengekrümmt an der Kante des Bettes.
Ich begann: „Natürlich sind das lauter Lügen“, aber dann hielt ich inne, weil meine Worte überflüssig waren. Ich konnte nichts mehr tun außer hinuntergehen und seiner Mutter sagen, sie möge heraufkommen und ihm die Augen zudrücken. Nicht um alle Schätze der Erde hätte ich sie berührt. Ich hatte nämlich schon lange nicht mehr an den Tag gedacht, der damals schon viele, viele Jahre zurücklag, und an dem ich eine kalte Berührung wie mit Speichel auf meinen Augenlidern verspürt, die Augen aufgeschlagen und gesehen hatte, wie sich ein Mann von mir entfernte, der wie ein Baum aussah und von anderen Bäumen umringt war.
Aus „Spiel im Dunkeln“, Copyright by Benziger-Verlag, Einsiedeln-Zürich-Kbln.