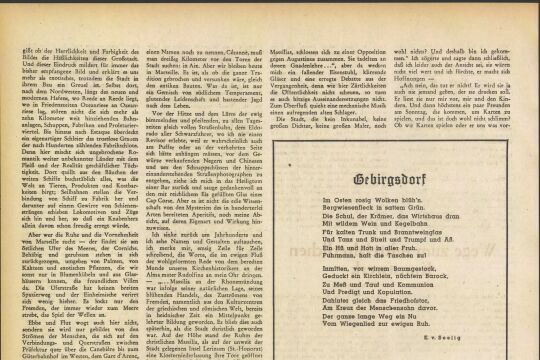Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Sorgenkind
Diese Geschichte ist erlebt, und gerade deshalb so schwer zu erzählen. Nur die vielen Briefe, die ich seit Jahren von Eltern erhielt, die ebenfalls ein Kind haben wie das meine, ließen in mir den Entschluß reifen, dies alles niederzuschreiben. In den Briefen wurden vor allem zwei Fragen gestellt: „Was sollen wir für unser Kind tun?“ und „Wie sollen wir den Gedanken Von Pearl S. Buckertragen, ein solches Kind zu haben?“
Die erste Frage beantworte ich am besten, indem ich erzähle, was ich selbst getan habe. Die zweite Frage allerdings ist schwer zu beantworten, denn das Erdulden von Unabwendbarem ist etwas, womit jeder selbst fertig werden muß. Aber mit dem Erdulden allein ist es nicht getan, da es verbittert und jede Lebensfreude tötet. Wir müssen die innere Bereitschaft haben, die traurige Wahrheit als Gegebenheit hinzunehmen, und wir müssen von dem Wissen beseelt sein, daß auch jedes Unglück seine positiven Seiten hat.
Mein Kind wurde in China geboren. Ich hatte mir schon immer Kinder gewünscht, und ich werde niemals jenes Gefühl grenzenlosen Glücks vergessen, das ich empfand, als mir die chinesische Krankenschwester mein Neugeborenes zeigte. Seine Züge waren klar und seine Augen erschienen mir klug und ausdrucksvoll.
Ich kann nicht sagen, wann und warum die geistige Entwicklung des Kindes in seinem Wachstum zu stocken begann. Es gab niemanden in unserer Ahnenreihe, durch den eine unglückliche Vererbung zu befürchten gewesen wäre. Keine junge Mutter konnte also diese schreckliche Entdeckung unvorbereiteter treffen als mich. Ich war wohl auch die letzte, die merkte, daß bei dem Kind irgend etwas nicht stimmte. Es war drei Jahre alt, als ich mich zu wundern begann, denn es konnte bis dahin immer noch nicht sprechen. Ich sprach zu meinen Freunden von meinen Befürchtungen, aber ihre Antworten waren alle beruhigend, fast zu beruhigend.
Mit vier Jahren begann es endlich, einige Worte zu sprechen, allein zu essen und sich anzuziehen. Aber die meisten seiner Wünsche und Gedanken mußte ich immer noch mehr oder weniger erraten. Als ich schließlich mit meiner Tochter eine Ärztin aufsuchte, wurden meine anfänglichen Befürchtungen bestätigt: das langsame Laufen, das langsame Sprechen und die ständige Unruhe, von der das Kind befallen war — dies alles waren Anzeichen einer schweren Störung. „Irgend etwas stimmt nicht", meinte die Ärztin abschließend. „Ich weiß nicht, was es ist, aber ich würde Ihnen raten, einen Spezialisten aufzusuchen."
Auch dieser konnte mir nur den Rat geben, das Kind nach Amerika zu bringen, um es dort nochmals genau untersuchen zu lassen.
Dann begann eine jener Reisen, deren unsägliche Mühsal nur diejenigen Eltern ermessen können, die ebenfalls solche Kinder ihr eigen nennen. Getrieben von der Hoffnung, jemanden zu finden, der mein Kind heilen könnte, überquerte ich den halben Erdball, aber nach jeder Untersuchung schrumpfte meine Hoffnung mehr zusammen.
Die letzte Station meiner Reise war die Mayo-Klinik in Rochester, Minnesota. Mehrere Tage dauerte hier die Untersuchung. Endlich erhielt ich die Diagnose. Vieles war recht erfreulich: mein Kind hatte mehrere bemerkenswerte Fähigkeiten, besonders in Hinsicht auf Musik. Hier zeigte es eine ungewöhnliche Begabung, die sich allerdings in ständigem
Kampf mit seinem körperlichen und geistigen Gebrechen befand. Die geistige Entwicklung aber war völlig unterbrochen. „Ist es vollkommen hoffnungslos?“ fragte ich.
Der Arzt war seiner Sache selbst nicht ganz sicher und antwortete deshalb ausweichend: „Ich glaube, Sie sollten die Hoffnung nicht ganz aufgeben.“
Und dann kam jener Augenblick, für den ich mein Leben lang dankbar sein werde. Als ich mit meinem Töchterchen durch die Gänge der Klinik schritt, trat ein kleiner, unscheinbarer Mann auf mich zu, derselbe, der kurz vorher dem Arzt den Untersuchungsbefund gebracht hatte. Er verbeugte sich höflich und fragte dann: „Sagte er Ihnen, daß das Kind geheilt werden könne?“ „Er — er sagte nicht, daß es hoffnungslos wäre“, antwortete ich. „Hören Sie mich in Ruhe an“, sagte er nun in einem fast befehlenden Ton. „Sie werden sich und Ihrer Familie das Leben unerträglich machen, solange Sie nicht den Mut haben, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Ihre Tochter wird niemals normal werden. Ich kenne diese Art von Kindern. Sie wird niemals richtig sprechen können, ebensowenig wie sie Lesen und Schreiben erlernen wird. Sie wird für Ihr Leben stets eine Last bleiben. Seien Sie bereit, diese Last auf sich zu nehmen, aber lassen Sie sich nicht von ihr erdrücken. Geben Sie das Kind in ein Heim, wo es glücklich sein kann. Ich sage Ihnen das alles nur, weil ich Ihnen helfen will.“
Es klang grausam, was er da zu mir sagte, aber heute weiß ich, daß es gut war. Es war eine schmerzhafte, aber gründliche Methode, die er anwandte, und dafür werde ich ihm immer dankbar sein.
Ich weiß nicht mehr, wann die große Wendung für mich kam. Der erste Schritt war wohl der, daß ich mich mit allem abzufinden begann. Ich sah ein, daß ich mich von meinem Kinde werde trennen müssen, obwohl ich überzeugt war, daß niemand es so verstehen könnte wie ich und daß keiner so viel für es tun konnte wie ich. Aber was sollte aus dem Kind werden, wenn ich vielleicht jung sterben sollte? Das Beste, was ich für meine kleine Tochter tun konnte, war also, sie in die Vereinigten Staaten mitzunehmen und sie dort in einem Heim unterzubringen. Ich konnte ihr dann durch häu- fiige Besuche helfen, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, ohne daß sie das Gefühl haben mußte, völlig von mir getrennt zu sein.
Bevor ich sie aber in fremde Hände gab, wollte ich mir noch einmal Gewißheit über alle ihre Fähigkeiten verschaffen, um so die richtige Wahl ihres zukünftigen Heims treffen zu können. Ich wollte versuchen, sie im Lesen, Schreiben und
— da sie Musik liebte — im Notenlesen zu unterrichten. Tatsächlich gelang es ihr, einfache Sätze zu lesen, mühsam ihren Namen zu schreiben und kleine Liedchen zu singen. Aber als ich merkte, welch ungeheure Anstrengung ihr dies alles verursachte, wie erlöst sie war, wenn sie nach einem derartigen Unterricht wieder zum Spielen gehen konnte, unterließ ich alle weiteren Versuche und fand mich mit ihrem Unvermögen ab.
Ich behielt meine Tochter bei mir, bis sie das neunte Lebensjahr erreicht hatte. Dann fuhren wir zusammen in die Vereinigten Staaten, um für sie eine endgültige Unterkunft ausfindig zu machen.
Meine Suche endete in einem Institut, dessen freundliches Äußere bereits etwas von der wohltuenden Atmosphäre verriet, die dort herrschte. Der Leiter der Anstalt
— Onkel Ed, wie ihn die Kinder nann-ton — war ein liebenswürdiger Mann, der jedes einzelne Kind beim Namen kannte, selbst mit ihnen spielte üftd lür jedes ein freundliches Wort bereit hatte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!