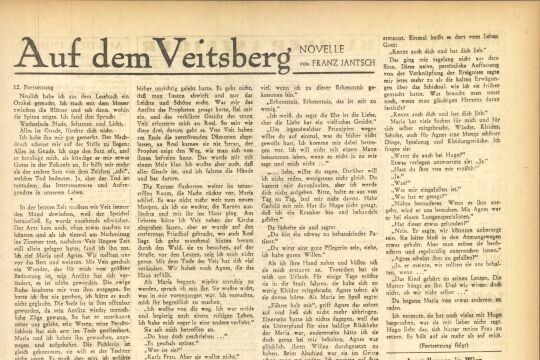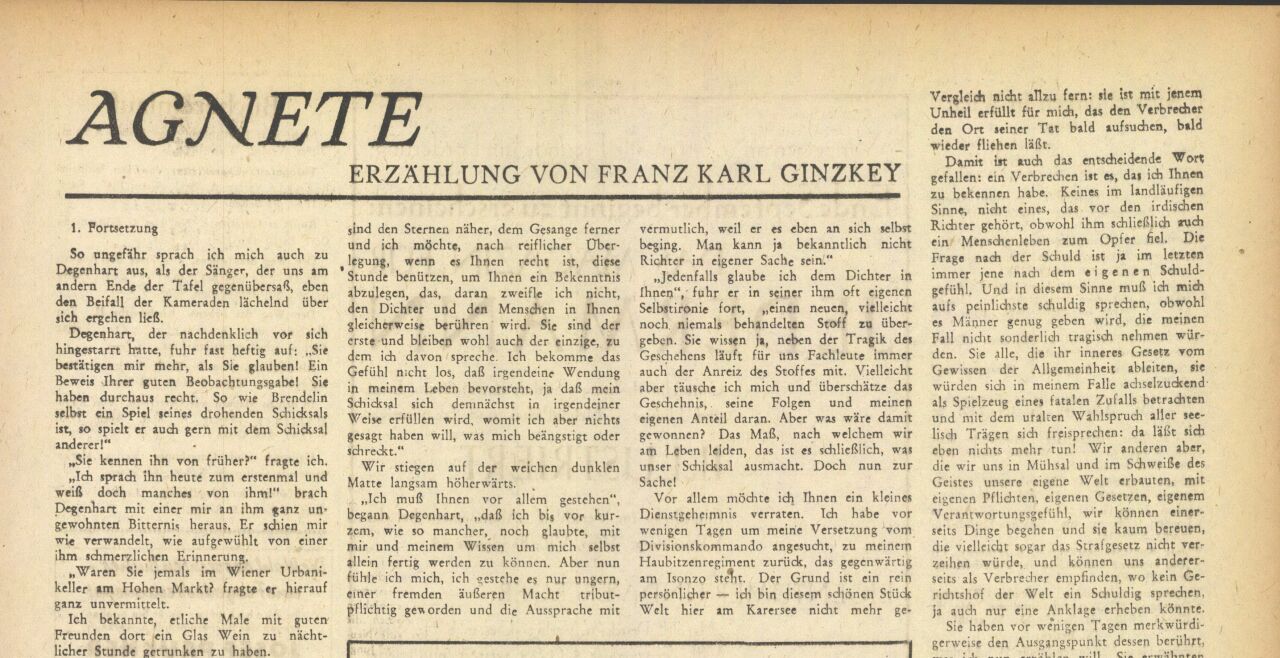
So ungefähr sprach ich mich auch zu Degenhart aus, als der Sänger, der uns im andern Ende der Tafel gegenübersaß, eben den Beifall der Kameraden lächelnd über sich ergehen ließ.
Degenhart, der nachdenklich vor sich hingestarrt hratte, fuhr fast heftig auf: ..Sie bestätigen mir mehr, als Sie glauben! Ein Beweis Ihrer guten Beobachtungsgabe! Sie haben durchaus recht. So wie Brendelin selbst ein Spiel seines drohenden Schicksals ist, so spielt er auch gern mit dem Schicksal anderer!“
„Sie kennen ihn von früher?“ fragte ich.
„Ich sprach ihn heute zum erstenmal und weiß doch manches von ihm!“ brach Pegenhart mit einer mir an ihm ganz ungewohnten Bitternis heraus. Er schien rnir wie verwandelt, wie aufgewühlt von einer ihm schmerzlichen Erinnerung.
„Waren Sie jemals im Wiener Urbani-keller am Hohen Markt? fragte er hierauf ganz unvermittelt.
Ich bekannte, etliche Male mit guten Freunden dort ein Glas Wein zu nächtlicher Stunde getrunken zu haben.
„Dort saß Brendelin Abend für Abend mit seiner Laute, wissen Sie, denn Wien war seine Friedensgarnison. Tch selbst war niemals im Urbanikeller, aber jemand, der — nicht mehr am Leben ist, hat ihn dort zu einer Stunde gehört, die entscheidend für ihn wurde. Doch — verzeihen Sie, ich erzähle Ihnen Dinge, die wirklich nicht zur Sache gehören.“
Die Schroffheit, mit der er mich solcherart von sich abdrängte, schien ihm aber gleich wieder leid zu tun. „Nichts für ungut, Herr Kamerad“, setzte er wehmütig lächelnd hinzu und hielt sein Glas an das meine.
Ich aber empfand, daß jetzt ein Wendepunkt in meinem Verhältnis zu Degenhart werde eintreten müssen. Ich sah, daß er irgendwie litt und fühlte plötzlich ein freundschaftliches Mitleid mit ihm, das mich ob seiner Stärke selbst verwunderte. Doch mahnte seine Scheu zur Vorsicht und so konnte ich nur beschließen, mich schweigend für ihn bereitzuhalten.
Unterdessen wurde die gute Laune an 'unserer Tafel immer allgemeiner. Brendelin sang nunmehr fröhliche Lieder mit Kehrreimen, in die alles begeistert einstimmte, was nur irgendwie bei Stimme war.
Degenhart aber hatte sich bald nach seinen letzten Worten erhoben und war nicht mehr auf seinen Platz zurückgekehrt. Ich dachte, er habe sich früh zur Ruhe begeben, wie es oft seine Art war.
Da ich selbst das Bedürfnis empfand, für eine Weile allein zu sein, trat ich auf den hölzernen Balkon hinaus, der die ganze Vorderseite des Hotels begleitete.
Wir hatten Neumond und die Gegend war nur dürftig von den Sternen erhellt, doch konnte man die scharfe gespenstige Silhouette des I.atemars deutlich vor dem tiefsamtenen Firmament erkennen. Der nächtlichen Ruhe hatte sich ein wunderbar würziger Hauch aus den uralten Fichten gesellt, etwas ungemein Großes, Reines, Befreiendes wehte durch die Kühle dieser heroischen nächtlichen Landschaft, in die sich der Chorgesang der Kameraden und der Lichtschein aus dem Saale nur dürftig und störend hinausstahl.
Als meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, bemerkte ich jemanden auf dem Wege auf und nieder gehen, der sich quer durch die dem Hotel vorgelagerte Wiese zog. Es mußte jemand sein, der die Einsamkeit suchte gleich mir. Als der Wandelnde auf einen Augenblick in den Lichtschein der Fenster geriet, glaubte ich Degenharts Gestalt und Gang zu erkennen.
Ich weiß nun selbst nicht mehr, was mich antrieb, mich aufzumachen und sogleich zu ihm hinabzugehen. Es war eine Stimme, die sagte: Versuche, ihm tragen zu helfen, was ihn quält, und wenn es auch nur die Kunde von einem Schicksal ist.
Und noch ehe ich'piir über das Passende oder Unpassende meines Entschlusses klar geworden war, stand ich auch schon an seiner Seite, der darüber keineswegs erstaunt schien.
„Es liegt heute etwas Wunderbares in der Nacht“, sagte er, als setzte er ein Gespräch fort, das er mit sich selbst begonnen. „Wenn es Ihnen recht ist, gehen wir ein Stück die Matte hinauf. Es weitet sich die Dunkelheit, indes wir höher steigen, wir sind den Sternen näher, dem Gesänge ferner und ich möchte, nach reiflicher Über-legung, wenn es Ihnen recht ist, diese Stunde benützen, um Ihnen ein Bekenntnis abzulegen, das, daran zweifle ich nicht, den Dichter und den Menschen in Ihnen gleicherweise berühren wird. Sie sind der erste und bleiben wohl auch der einzige, zu dem ich davon spreche. Ich bekomme das Gefühl nicht los, daß irgendeine Wendung in meinem Leben bevorsteht, ja daß mein Schicksal sich demnächst in irgendeiner Weise erfüllen wird, womit ich aber nichts gesagt haben will, was mich beängstigt oder scli reckt.“
Wir stiegen auf der weichen dunklen Matte langsam höherwärts.
„Ich muß Ihnen vor allem gestehen“, begann Degenhart, „daß ich bis vor kurzem, wie so mancher, noch glaubte, mit mir und meinem Wissen um mich selbst allein fertig werden zu können. Aber nun fühle ich mich, ich gestehe es nur ungern, einer fremden äußeren Macht tributpflichtig geworden und die Aussprache mit Ihnen bedeutet mir die leise Hoffnung auf die Erleichterung einer schweren inneren Last.“
„Ich will mich Ihres Vertrauens würdig erweisen“, entgegnete ich mit Wärme. Ich wußte in diesem Augenblick nichts Besseres zu sagen und fürchtete fast, an eine Phrase geraten zu sein. .
Er aber schien mich richtig zu verstehen. „Ich danke Ihnen“, sagte er herzlich und reichte mir die Hand.
„Sie dürfen mich nicht für einen Menschen halten, der dem leben bilhei nicht gewachsen gewesen wäre. Ich traue mir im Gegenteil, offen gestanden, die Kraft zu, so manches, was man ,Sünde' nennt, in seiner Nachwirkung zu ertragen; ich glaube, um es kurz zu sagen, ein ziemlich dehnbares Gewissen zu besitzen, und zwar aus der Kraft heraus, mich selbst zu absolvieren und mir gegebenenfalls auch die eigene Buße vorzuschreiben. Nunmehr aber bin ich, durch eine seltsam schmerzliche Schicksalsfügung, an ein Vergehen geraten, für das mein Geist keine Lossprechung weiß, vermutlich, weil er es eben an sich selbst beging. Man kann ja bekanntlich nicht Richter in eigener Sache sein.“
„Jedenfalls glaube ich dem Dichter in Ihnen“, fuhr er in seiner ihm oft eigenen Selbstironie fort, „einen neuen, vielleicht noch niemals behandelten Stoff zu übergeben. Sie wissen ja, neben der Tragik des Geschehens läuft für uns Fachleute immer auch der Anreiz des Stoffes mit. Vielleicht aber täusche ich mich und überschätze das Geschehnis, seine Folgen und meinen eigenen Anteil daran. Aber was wäre damit gewonnen? Das Maß, nach welchem wir am Leben leiden, das ist es schließlich, was unser Schicksal ausmacht. Doch nun zur Sache!
Vor allem möchte ich Ihnen ein kleines Dienstgeheimnis verraten. Ich habe vor wenigen Tagen um meine Versetzung vom Divisionskommando angesucht, zu meinem Haubitzenregiment zurück, das gegenwärtig am Isonzo stellt. Der Grund ist ein rein ptTM'inlicher — ich bin diesem schönen Stück Welt hier am Karersee nicht mehr gewachsen. Das wird Sie wundern, nicht wahr? Wie kann man in diesen Tagen, da Völkerschicksale sich auftürmen, da täglich Tausende der Besten mehr oder minder freiwillig ihr armes Leben zum Opfer bringen, um die Stimmung einer Landschaft bekümmert sein und sein Schicksal ihr unterordnen? Im Laufe meiner Erzählung wird Ihnen das klar werden. Es steht hier so mit mir: ich muß diese Landschaft fliehen, weil ein Geist in ihr webt und“ eine Anklage, die mein Innenleben aufs schwerste bedroht. Bisher war Natur für mich die große Befreierin, die reinigende Zuflucht vor aller irdischen Wahn-, Schuld- und Leidenschaftsüberlastung. Ich badete, um etwas abgebraucht zu sagen, die Seele in ihr gesund und frei. Nun aber versagt sie sich mir gerade hier, an diesem paradiesisdien Orte, wo jedermann glücklich wäre, zu weilen, hier weist sie mich ab von ihren seligen Offenbarungen^ hier ist sie erstarrt wie ein Bild ohne Gnaden, hier ist sie mir, ich empfinde es von Tag zu Tag immer deutlicher, geradezu feindlidi gesinnt. Und es liegt der Vergleich nicht allzu fern: sie ist mit jenem Unheil erfüllt für mich, das den Verbrecher den Ort seiner Tat bald aufsuchen, bald wieder fliehen läßt.
Damit ist auch das entscheidende Wort gefallen: ein Verbredien ist es, das ich Ihnen zu bekennen habe. Keines im landläufigen Sinne, nicht eines, das vor den irdischen Richter gehört, obwohl ihm schließlich uch ein Menschenleben zum Opfer fiel. Die Frage nach der Schuld ist ja im letzten immer jene nach dem eigenen Sdiuld-gefühl. Und in diesem Sinne muß ich mich aufs peinlichste schuldig spredien, obwohl es Männer genug geben wird, die meinen Fall nicht sonderlich tragisch nehmen würden. Sie alle, die ihr inneres Gesetz vom Gewissen der Allgemeinheit ableiten, ie würden sich in meinem Falle achselzuckend' als Spielzeug eines fatalen Zufalls betrachten und mit dem uralten Wahlspruch aller seelisch Trägen sidi freisprechen: da läßt sich eben nichts mehr tun! Wir anderen aber, die wir uns in Mühsal und im Schweiße des Geistes unsere eigene Welt erbauten, mit eigenen Pflichten, eigenen Gesetzen, eigenem Verantwortungsgefühl, wir können einerseits Dinge begehen und sie kaum bereuen, die vielleicht sogar das Strafgesetz nicht verzeihen würde, und können uns andererseits als Verbrecher empfinden, wo kein Ge-riditshof der Welt ein Sdiuldig sprechen, ja auch nur eine Anklage erheben könnte.
Sie haben vor we'nigen Tagen merkwürdigerweise den Ausgangspunkt dessen berührt, was idi nun erzählen will. Sie erwähnten mein Feuilleton in der „Wiener Zeitung“ über den Wert der Einsamkeit. Ich halte diesen Artikel tatsächlidi für eine meiner besten Arbeiten, und doch, ich wollte, ich hätte ihn niemals geschrieben!
Denn hören Sie: wenige Tage nach seinem Ersdieinen erhielt ich einen Brief von einer mir unbekannten Dame, worin mir in der bei Lesern üblidicn Art für meine Arbeit gedankt wurde; zuletzt aber nahm das Sdireiben eine eigentümliche Wendung. Die Dame schloß nämlich mit ungefähr folgenden Worten: Ich glaube, daß Sie der einzige sind, dem idi mein Leben beiditen könnte. Idi habe sonst nichts von Ihnen gelesen, aber diese wenigen Seiten genügen mir. Es liegt etwas in Ihren Worten, das mir großes Vertrauen einflößt. Darf ich Ihnen schreiben?
Sie können sidi denken und Sie wissen es wohl auch aus eigener Erfahrung, daß mein erster ärgerlicher Gedanke war: wieder einmal ein hysterisches Frauenzimmer! Gegen Briefe solcher Art gibt es nur ein einziges Mittel, man verziditet darauf, Kavalier zu sein, und beantwortet sie einfach nicht.
Das war zuerst meine Absicht auch in diesem Falle. Ich wollte den Brief sofort zerreißeA, tat es aber doch nicht. Warum, das ist mir heute noch nicht klar. Ich warf ihn in die Lade zu den erledigten Briefen, unter denen ich von Jahr zu Jahr immer ein großes Reinemachen vorzunehmen pflege.
Am nächsten Tage nun, ich glaube, was wir Zufall nennen, ist eben gar nicht vorr handen, nahm idi im Kaffeehaus ein Wiener Tagblatt zur Hand, das ich sonst fast niemals zu lesen pflege. Ich fand darin einen Aufsatz über den Sdiönbrunner Sdiloß-garten, der midi von Satz zu Satz' immer stärker fesselte, bis ich, von einer überraschenden Ähnlichkeit mit meiner eigenen Ausdrucksweise betroffen, den Namen des Verfassers am Sdiluß suchte. Und da entdeckte ich zu meiner nicht geringen Verwunderung den Namen der Briefschreiberin des gestrigen Tages.
Nun sah idi begreiflidierweise alles in anderem Lidite. Hinter diesem Briefe stand also ein Mensch, der mir Achtung und Mitgefühl abnötigte, es schien mir unmöglich, den Brief nidit zu beantworten. Und so gab idi denn in einigen Zeilen meine Bereitwilligkeit kund, das mir angekündigte Bekenntnis zu lesen, und fügte auch einige Worte warmer kollegialer Anerkennung über den Sdiönbrunner Artikel bei.
Zu bestellen hatte ich die Antwort, wie es der Wunsch der Dame war, an das Karerseehotel in den Dolomiten.
Ungefähr eine Woche später empfing ich das angekündigte Schreiben. Es war ein Brief von etwa dreißig Seiten. Ich entsinne mich noch, daß ich ihn mit der Frühpost erhielt, ihn aber zu meiner übrigen Abendlektüre legte, da idi ihn wie etwas Literarisches, aus geistigen Landen Kommendes behandeln und mir dazu mit einer mir in solchen Fragen innewohnenden Pedanterie eine vorurteilslose Beschaulichkeit zuredit-legen wollte. (Fortsetzung folgt)