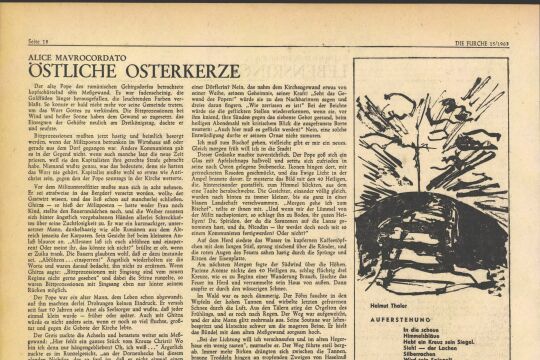Der Zigeunerwagen blieb auf dem Feldweg stecken, der die Katastergrenze zwischen zwei Gemeinden bildete. Ein Urteil war über das altet fahrende Geschlecht gesprochen: Die Zigeunerfamilien müßten dort seßhaft werden, wo sie sich eben befanden; und die beiden Dorfgemeinden haderten schon wochenlang, wer die neuen unerwünschten Bewohner aufgehalst bekomme.
Wie hätten auch die Dorfbewohner die merkwürdigen Menschen bei sich aufnehmen sollen? Soweit ihr. Gedächtnis reichte, hatten die Dörfbewohner beobachtet, wie die Züge dieser Nomaden in unregelmäßigen Zeitabständen auf den Wegen auftauchten, wie gehetzt von Trieben oder Bräuchen, die ebenso unberechenbar waren wie die Instinkte der Tiere oder der Zugvögel.
Im Gras in der Lindenallee beim Dorf schlugen sie ihr Lager auf, schirrten die langschwänzigen Pferde ab, schoben zwei, drei Steine zu einem Herde zusammen, zündeten ein Feuer an und hängten einen riesigen schwarzen Kessel darüber. Gott weiß, was sie darin so rasch zu bereiten vermochten. Kaum hatte die geflüsterte Nachricht, die Zigeuner seien da, die Runde durchs Dorf gemacht, so sperrte man auch schon Tür und Tor zu und schob die Riegel vor.
Zwei oder drei Tage hielten sie das Dorf so in Alarmzustand, allgegenwärtig, geheimnisvoll, frech und unzugänglich. Nur die Kinder freuten sich über die unerwarteten und gefährlichen Gäste. Für sie war das alles ein schönes Abenteuer, ein Durchbruch in eine Welt, in der man den Duft wilder Freiheit, ja geheimer und grausamer Zauberei atmete; eine Welt, die halb tierhaft und halb menschlich war, vielleicht sogar mehr als menschlich. Die Kinder entglitten der Aufsicht der Älteren und umschlichen das verbotene Lager, das sie bezauberte und ihnen doch zu gleicher Zeit Angst einjagte. Mit kugelrund staunenden Augen beobachteten sie die gebräunten Männer mit den buschigen Schnurrbärten, die seltsamen Weiber, die ohne Umstände die Bluse öffneten und einem kleinen, nackten Zigeunerkind die Brust reichten. Reglos, in unerklärlich faszinierter Angst starrten sie und horchten, wie die Zigeuner einander in ihrem heiseren Kauderwelsch anschrien, und liefen endlich Hals über Kopf davon, wenn ihnen eines der unverschämten Weiber grinsend die Zähne zeigte und sie zu einem zweifelhaften Schmaus atis dem großen Kessel einlud.
Als die jüngsten Katastrophen unseren Planeten erschütterten, da fanden sich auch die Zigeuner, die jahrhundertelang durch die Länder gezogen waren, ohne sich mit den Völkern zu vermischen, plötzlich in einem Gewirr aus Haß und Ketten, für das es ohne Zweifel in ihrem Denken keinerlei Formen und in ihrer Sprache keinerlei Ausdruck gab. Was wußten sie denn von Demokratie, von der Herrschaft Hitlers, von den Münchner Verträgen, vom Protektorat Böhmen und Mähren? Wie sprachen sie wohl über all das untereinander?
Wie dem auch sei; auch sie waren gezwungen, diese Dinge zu bedenken, an jenem Tage zumindest, da man ihnen bedeutete, sie hätten sich dort dauernd niederzulassen, wo sie der Stichtag der Verordnung traf. Und wenn sie die Verordnung gerade an der Grenze zwischen zwei Dorfgemeinden einholte, inmitten flacher und kahler Felder, auf einer kleinen, von allen Winden gepeitschten Anhöhe — um so schlimmer für sie.
Auch ich wohnte damals in jenem kleinen Dorfe: es schien mir damals wie ein Wrack, das unter fremden Sternbildern gestrandet und durch unüberbrückbare Weiten vom allernächsten Ort getrennt war. Die Pfade, die durch diese Landschaft führten, waren wie durch einen bodenlosen Abgrund von der übrieen Welt abgeschnitten. Die Menschen kauerten in den ererbten Anwesen, um dem bösen Gigantenauge zu entgehen, das unzählige Pupillen besaß und selbst in die verstecktesten Winkel und in die geheimsten Gedanken eindrang. Niemand war wirklich zu Hause, jeder fühlte sich von den spähenden Blicken verfolgt,
Band“ vermeiden, in Fahnen ausgesetzt, aber noch nicht. einmal umbrochen. Musils Arbeitsweise ist bekannt, und mein seufzender Lehrer Frisch war sich wohl bewußt, daß ihm noch ein langer Weg zu einem endgültigen Imprimatur bevorgestanden wäre. Ich finde meine Erinnerung in einem Brief, den mir Musil später nach Amerika schickte, bestätigt, und die betreffenden Zeilen sollen hier wiedergegeben werden:
Ge/, 5. September 1940
Ich bin sehr in Arbeit, hoffentlich in guter. Seit jenen „Fahnen“ habe ich die Geschichte zwanzigmal umgearbeitet, daß nichts mehr von ihr übrigblieb als die Ziegel, aus denen jetzt der Bau entsteht; es war ein garstiger (?) Prozeß.
Der Verlag blieb kurz unter kommissarischer Leitung und wurde dann von dieser geschlossen. Die Buchhandlung Löwith auf der Wollzeile hatte Arbeitsbewilligung erhalten und bekam in diesen Tagen eine Zufluchtsstätte für alle, die Literatur über Auswanderungsmöglichkeiten und ferne Länder suchten. Hier fand ich Anstellung, die mir ruheloses Zuhausebleiben ersparte. Meine Gedanken kehrten oft zu Robert Musil, und einmal wagte ich es, bei ihm telephonisch anzurufen. Freundlich erkundigte er sich nach meiner Tätigkeit und fügte dann hinzu: „Ich gehe jetzt wenig unter Menschen, lieber unter Bäume.“ Als eines Tages die Tür der Buchhandlung aufging, schaute Robert Musil herein. Weniges hätte mir damals mehr Freude bereiten können als sein Besuch. Auch diese Buchhandlung wurde eines Samstag nachmittags geschlossen und der Inhaber, Dr. Max Praeger, von den Gestapomännern fortgeschleppt. Es erschien mir ratsam, ein amerikanisches Visum nicht mehr in Wien abzuwarten, und es gelang mir, zu lieben Freunden in die Tschechoslowakei zu fliehen. Auf ein Lebenszeichen, das ich an Musil sandte, erhielt ich folgende Zeilen, die mich auch in die Neue Welt wie ein Leitstern begleiteten:
30. November 1938 Ich habe mich sehr über Ihr freundliches Gedenk- und Anhänglichkeitszeichen gefreut und wünsche aufrichtig, daß sich Ihr Leben trotz aller Katastrophen nach den Bestrebungen Ihres Geistes gestalten möge. Daß ich erst heute erwidere, hat seinen Grund darin, daß ich selbst mit vielen Schwierigkeiten zu tun habe.
und auch der von immerwährenden Alpträumen bedrängte Schlaf war nicht mehr unser.
Auf dem Wege in die Pfarrkirche pflegte ich frühmorgens am Zigeunerwagen vorbeizukommen. Er stand stumm und verlassen im herbstlichen Morgen, der noch über dem gepflügten Acker zögerte. Nach der Messe pflegte der alte Herr Pfarrer aus der Sakristei zu kommen und mir die trockene, heiße Hand zu reichen. Seine Herzkrankheit war schlimmer geworden, die Entfernung vorn Pfarrhaus zur Kirche schien ihm von Tag zu Tag größer. Nach jedem Schritt hielt er ein wenig inne und sah mit gequältem Bück auf den friedlichen und dennoch so drohenden Horizont und fragte mich mit stockender Stimme: „Ob einmal ein Ende kommt?“ Dann wies er mit einer Kopfbewegung auf den dünnen Rauchfaden hin, der aus dem Zigeunerwagen auf dem kahlen Hügel stieg. „Ja, sehen Sie, diese Einwohner meiner Pfarrgemeinde sind noch glücklicher als alle anderen.“
Gewöhnlich lud mich der alte Herr ein mit ihm im Pfarrhaus zu frühstücken. Es war ein altes, nach Norden gewandtes Gebäude, dessen riesige Ausmaße den wirtschaftlich-hygienischen Ideen unserer Zeit nur schlecht entsprachen. Es war schwer, darin einen freundlichen Winkel zu finden. Im übrigen dachte der alte und kranke Priester, der fühlte, wie ihn die Kräfte verließen, gar nicht mehr daran, eine gemütliche Wohnstube einzurichten. Als wir Kaffee getrunken hatten, wies er auf ein Fach der schwarzen und zersprungenen Kommode: „Vielleicht sehen Sie nach, ob wir noch etwas übrig haben?“ Immer war noch eine Flasche Slibowitz da, die ihm seine ehemaligen Pfarrkinder aus Südmähren zugeschickt hatten und an der sich jetzt nur mehr seine Gäste erfreuten.
„In meiner einstigen Pfarrgemeinde“, sagte er einmal, „hatte ich eine ganze Kolonie beisammen.“ Ich erriet sogleich, daß er von den Zigeunern sprach und daß der Gedanke an diese elenden Ausgestoßenen ihn nicht zu quälen aufhörte. „Was für seltsame Christen! Sie waren bereit, alles zu glauben. Um Kleinigkeiten scherten sie sich wirklich nicht: zwei oder fünf göttliche Personen, das ist ihnen kein Grund zur Aufregung. Sie waren imstande, ein Kind auch dreimal zur Taufe zu bringen, nur um jedesmal ein Geschenk von einem anderen Taufpaten zu ergattern. Nicht einen einzigen Gedanken vermochte ich ihnen einzutrichtern. Manchmal fragte ich mich, ob sie überhaupt ein menschliches Gewissen haben oder ein natürliches Gefühl. Und doch, welch ein Geheimnis ...“ Sein Blick ging zum Fenster hinaus, hinter dem der stille Tanz der ersten Schneeflocken begann. Sie versteckten den Rauch, der aus dem Nomadenwagen aufstieg, wie mit einem leichten Gitterwerk. „Und doch sind es Geschöpfe Gottes und haben eine unsterbliche Seele“, begann er wieder mit schwankender Stimme. „Wie kann man sie dort nur darben lassen? Ich hab' schon an den Bezirkshauptmann geschrieben, an die Bürgermeister und den Gemeinderat der beiden Gemeinden. Der Winter wird streng. Auf dieser Wegkreuzung, wo sich die Füchse ,gute Nacht' sagen..
Dann heftete er seinen seltsamen blauen und zärtlichen Blick auf mich. „Haben Sie das Kruzifix gesehen? Zehn Schritte weit von ihrem Wagen ragt es in die Höhe... In der Nacht sehe ich manchmal den unendlich hellen Schatten...“ In die Stimme des Greises mischte sich ein leises Schluchzen.
Ich schauderte und wandte meine Augen ab. Einen Augenblick später hüstelte der Pfarrer, und, als schäme er sich, wies er mit einem allzu deutlichen Versuch, fröhlich zu sein, auf mein leeres Glas. „Noch einen Tropfen?“ Ja, er lachte sogar ein wenig. „Stellen Sie sich vor, sie können einfach nicht begreifen, daß jemand ihre Sprache erlernen könnte! In meiner ehemaligen Gemeinde hatte ich einen Pfarraachbarn, der seine Zerstreuung darin suchte, die Grammatik der Zigeunersprache zu studieren. Einmal begegnete ich ihm auf dem Heimweg von der Schule. Wir gingen auf dem Pfad, der ein Stück neben der Landstraße einherlief. Dort zog ein Zigeunerhaufen einher.
Männer und Weiber. Sie stritten miteinander wie die Teufel, wurden tätlich und zerrten einander an den Haaren. Zuerst konnten sie uns hinter dem Gebüsch nicht sehen. Da rief ihnen mein Gefährte etwas in der Zigeunersprache zu. Mein Lebtag hab' ich keine so bestürzten Leute gesehen I Es war fast Enteetzen wie vor einer zauberischen Erscheinung, wie vor etwas Überirdischem. Sie standen wie versteinert mit aufgerissenen Augen voller Grauen da. Ein hellhäutiger Mensch, ein Priester sogar, der die Zigeunersprache redet! Das war niederschmetternd. Ich selbst begann ein Unbehagen zu spüren, als hätte mein Nachbar ein Sakrileg begangen, und auch er bereute wohl seine Dreistigkeit.“
*
Klirrende Fröste und endlose Sternenhimmel umklammerten die Erde. Die Schreckensherrschaft ließ den Herzschlag stocken. Man sprach nur noch von den Siegen des Feindes, von Verhaftungen und Hinrichtungen. Wir fühlten, daß wir weder Herren unserer. Körper noch Gebieter unserer Seelen waren. Wir hielten den Atem an und lauschten in die Nacht, nach dem Rattern des Autos, das plötzlich ins Dorf jagte, nach dem Knirschen der Schritte im verkrusteten Schnee. Undurchdringlich trennten uns die Verdunkelungsvorhänge von der Welt und voneinander und konnten doch nirgends eine Sphäre freundlicher Friedlichkeit schaffen. Wir fürchteten, daß jeden Augenblick
jemand ans Fenster oder an die Tür klopfen könnte, daß eine rohe Stimme in fremden Worten zu uns spräche.
Nur der Zigeunerwagen stand weiter an der Wegkreuzung, sehn Schritte weit von dem am stillen Holze aufgespannten Heiland, den Stürmen ein Ziel, gepeinigt von weißem und von violettem Frost. Die Gendarmen, die ihre Augen überall hatten, gingen an dem Zigeunerwagen vorbei und sahen ihn nicht.
*
Als ich einmal früh zur Kirche kam, sah ich den Pfarrer vom Friedhof kommen. Der Kirchendiener, der eine schwankende Laterne trug, begleitete ihn und dazu noch zwei oder drei dunkle Gestalten. Der Pfarrer grüßte mich mit einem kaum wahrnehmbaren Kopfnicken. Beim Frühstück war er wunderlich schweigsam und noch trauriger als sonst. „Heute haben wir schon ein Begräbnis gehabt“, sagte er endlich. „Ein Säugling aus dem Zigeunerwagen. Die Kälte war wohl schuld. Das Kind ist einfach erfroren.“ Keiner von uns beiden war allzu gesprächig, und so verließ ich den Pfarrer an jenem Tage sehr bald.
Dieses Ereignis zwang die Behörden, endlich einzugreifen. Bald darnach sahen wir die Zigeunerfamilie ins Dorf einfahren; die Männer hatten sich vor die Deichsel gespannt, die Weiber schoben von hinten, und die Kinder liefen daneben und schlitterten im Schnee oder steckten die zerzausten Köpfe zum winzigen Fenster hinai:s. Man gab ihnen, Männlein und Weiblein, eine Herberge in zwei halbzerfallenen Anwesen am Ende des Dorfes, wo der Wald begann, und die Dorfbewohner ließen tiefe Seufzer hören. Sie hatten in jüngster Zeit schon so viel erlebt, weiß der Himmel, was ihnen jetzt noch alles bevorstand!
Nichtsdestoweniger ließ man die neuen Dorfbürger nicht lange in Frieden. In jener Zeit wurde von Amts wegen eine
Art Religion der Arbeit eingeführt; man erklärte den Arbeitseinsatz aller fürs Reich zur heiligen Pflicht. Die Arbeitsämter wüteten. Und so sah man eines Tages diese freien und unordentlichen Geschöpfe, wie sie an den Straßengräben und an den Eisenbahnböschungen wie angeekelt den Spaten und den Krampen hoben und den Rücken bei der ungewohnten Arbeit krümmten. Man wäre versucht gewesen, zu lachen, hätte der Anblick nicht auch wieder Mitleid hervorgerufen und ein Frösteln der Angst. Daß ein Zigeuner wie alle anderen arbeiten sollte, das war ebenso gegen die Natur, wie wenn ein schönes, wildes Tier Lasten tragen oder den Göpel drehen müsse. Das war aber nicht das Ende der Tragödie. Auch in unserem Teile der Welt wütete die Rassentheori. und prägte ihren Weg mit Tränen, Blut, Leichenhaufen und <!em himmelschreienden Samen Kains...
Umrahmt von einem zögernden Frühling, kam die Passionswoche heran, rnit dem jungen, zarten Blätteiwerk an den Bäumen, den zerbrechlichen Grashalmen, die am Wegrande, jeder von ihnen mit einem Tautropfen geschmückt, hervorlugten, wenn frühmorgens das süße Lied der Lerchen über die offenen Ackerfurchen stieg. Dieses zarte, beginnende Leben mischte sich wunderlich mit der Angst, die die Herzen zusammenpreßte, und alle Farben erschienen wie auf dem Hintergrund eines dunklen, drohenden Schattens. Man ging nur vorsichtig aus dem Haus, denn man konnte jeden Augenblick jemandem begegnen, der da fragte: „Was machst du hier? Du arbeitest nicht? Bei welchem Arbeitsamt bist du eingetragen?“
Die Karfreitagsliturgie sprach mit besonderer Bedeutung zu den Gläubigen und drang in die Tiefe der gequälten Herzen. Schluchzend fielen die Menschen vor dem Grabe in die Knie, in dem der Leib des Heilands ruhte, von fünf klaffenden Wunden nach dem härtesten aller Kämpfe gezeichnet; jenen Wunden, die die geheimnisvollen Quellen unserer Erlösung sind.
Auf dem Weg von der trauerumwehten Kirche kam ich am Pfarrhause vorbei. Seit ein paar Tagen stand es sehr übel um den Pfarrer. Er lag auf einem schmalen und harten Sofa, sein Gesicht war verfallen und fahl. Als er mich eintreten sah, versuchte er aufzustehen, doch es gelang ihm nicht. „Aber hier haben Sie es doch nicht bequem“, sagte ich, „warum legen Sie sich nicht ins Bett?“
„Ach, ich mag mich nicht ins Bett legen“, antwortete er mit trockener und so veränderter Stimme, daß ich sie kaum wiedererkannte. „Wenn man sich einmal ins Bett legt, steht man nicht wieder auf. Es ist das erste Mal in meinem Leben, daß ich krank bin. Es ist grausam, nicht einmal beten kann ich. Heute hab' ich zum erstenmal nicht mein Brevier gebetet...“ Er mußte innehalten, ein Husten überfiel ihn und erschütterte seinen Leib, so daß die Wangen dunkelblau anliefen.
Als er ein wenig ruhiger geworden war, begann er wieder leise und in abgerissenen Sätzen: „Seltsam, ich irre fortwährend in meine Kindheit zurück... Immerfort drängen sich mir Jugendbilder auf, ganz greifbar und lebendig... Plötzlich spricht meine Mutter zu mir; sie steht an der Schwelle unseres Hauses, und ich komme vom Gymnasium in die Ferien heim. Sie sagt .Heinrich' und streichelt mein Haar. Und ich antworte ihr ganz laut und vergesse, daß das alles nicht wahr ist... Ich spüre ihre gestärkte Schürze unter den Fingern, die Feiertagsschürze, die sie umgebunden hat mir zuliebe ... Aus der Küche duften Buchteln und Kaffee, der Bach unter unserem Garten rauscht, und die Drossel schlägt ganz nah—“
Zutiefst beunruhigt hörte ich den Worten des Priesters zu, dann wandte ich mich ab, damit er meine Tränen nicht sähe.
„Ich sage mir“, fuhr er fort, „so kommt der Tod. Ich kann es kaum glauben. Es ist so einfach und doch, Sie verstehen, doch so schrecklich ... Etwas drängt sich ans Tageslicht... vom tiefsten Grunde her, eine reißende Wehmut...“
Er hatte gewiß meinen angstvollen Gesichtsausdruck entdeckt und wandte mir die Augen zu, seine schönen, jugendfrischen Augen, die seltsam groß schienen, und seine Lippen formten ein Lächeln: „Nur keine Angst, ich weiß, wie's um mich steht... Ich habe Pater Josef rufen lassen, er hat mir die letzte Ölung erteilt... Nur dieser armselige Leib spielt mir wunderliche Streiche...“
Auch ich versuchte zu lächeln, gern hätte ich ihm etwas gesagt; aber wie sollte ich Worte finden angesichts dieses großen, rührenden und feierlichen Blickes, den schon mehr als menschliche Visionen beunruhigten?
Ich rückte mit dem Stuhl, als wollte ich aufstehen, aber seine wieder verklärte Stimme hielt mich zurück: „Eilen Sie nicht so, ich weiß, es ist nicht sehr kurzweilig, zu sehen, wie es mit dem alten Gaul zu Ende geht. Ich find' es auch nicht kurzweilig... Wenn man das alles mit einem Anlauf überspringen könnte ..., um mit einem einzigen Sprung auf der anderen Seite zu landen ... Aber Gott fordert von uns, daß wir diese Not, diese Erniedrigung leiden; Er selbst ist ja dem Tode auch nicht ausgewichen ... Aber was hilft's, lieber Freund, wenn das alles immer ein wenig zu früh kommt...? Wir fassen es am falschen Ende an. Erst wenn wir den letzten Atemzug tun, da erkennen wir, daß wir so vieles versäumt, so vieles schlecht gemacht haben... Und dann, wer wollte diese armselige Welt gerade in dem Augenblick verlassen, da alles drunter und drüber geht? Finsternis überall und Blut und Schrecken... All die armen Menschen, die nicht einmal mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht und wo sie das Herz haben... Sie zittern vor dem kommenden Tag und schnappen dennoch nach dem Heute, diesem armseligen Fetzen und wollen ihn nicht fahren lassen. Und morgen zerfleischen sie einander wieder mit den Zähnen und besudeln den Gekreuzigten mit ihrer Gier ... Was sind wir doch alle für eine elende Herde .. .“
Der Wind, durchtränkt vom Dufte warmen Lehms, des Grases und der Veilchenblüten, kam durchs Fenster hereingeweht. Plötzlich fragte der Priester, ohne die Augen zu öffnen: „Und wie steht es mit meiner schwarzen Pfarrgemeinde, mit meinen Zigeunern?“
Als ich nicht antwortete, öffnete er die Augen, drehte mir den Kopf zu und versuchte, sich auf die Ellbogen zu stützen. „Wollen Sie es mir nicht sagen?“
Ich wagte nicht, ihn anzusehen. Im Geiste sah ich wieder die armselige Gruppe an meinem Fenster vorbeiziehen, Gendarmen mit aufgepflanzten Bajonetten begleiteten sie zu beiden Seiten. Eine Frau schob einen Kinderwagen mit einem schlafenden Säugling vor sich her, und die anderen Zigeunerkinder trabten neben den Erwachsenen. Man führte sie zur Eisenbahnstation, wo man sie in Viehwagen verlud. Eine halbe Stunde später kam der Gemeindediener zurück, den Kinderwagen hatte er hinten an sein Fahrrad gebunden.
„Man hat sie abtransportiert“, sagte ich endlich, „die unreine Rasse, die Reichsfeinde. Es gibt ihrer heute ja so viele ... Sie wissen...“
Sein Kopf fiel zurück auf das harte Kissen. „Ja, ich weiß.“ Wieder war seine Stimme nicht zu erkennen. „Ich weiß es, aber sie wissen es nicht...“ Eine große Stille breitete sich im Zimmer mit den fast kahlen Wänden aus. Ein langer Sonnenstrahl durchflog den Raum von einem Winkel zum anderen, zitterte einen Augenblick lang in den Ritzen des alten Fußbodens und verlosch.
Ich trat an das Lager des Kranken. Er atmete heftig, seine Stirne triefte von Schweiß. Ich nahm mein Taschentuch und wischte die Schweißtropfen ab. Er hielt meine Hand fest zwischen seinen beiden heißen und feuchten Handflächen. Seine Lippen zuckten. „Christus wird auferstehen ...“, sagte er mit geschlossenen Augen. Regungslos stand ich vor ihm, beugte mich dann über seine Hand und küßte sie. Darauf ging ich schnell hinaus.
*
Am nächsten Tage, am Nachmittag des Karsamstags, ging ich ein wenig im Garten auf und ab. Von Zaun und Gebüsch verborgen, wurde ich dort Zeuge einer eigentümlichen Szene.
Zwei Gendarmen, der Bürgermeister, der Gemeindediener und einige Dorfbewohner, zumeist neue deutsche Kolonisten, die man in die den tschechischen Bauern weggenommenen Höfe gesetzt hatte, umstanden einen Haufen von Säcken, Lumpen, Töpfen und Pfannen. Auch der Kinderwagen und ein Kinderroller waren zu sehen.
Die Gendarmen sprachen leise auf den Bürgermeister ein, der sichtlich verlegen mit der Versteigerung begann.
Zuerst ging es um den Kinderwagen. „Hundert Kronen zum ersten!“ rief der Bürgermeister. „Hundertzehn“, bot einer der deutschen Kolonisten. „Hundertzehn Kronen zum ersten!“ rief der Bürgermeister und wandte sich verstohlen um. Niemand bot mehr. „Hundertzehn Kronen zum zweiten!“ Wieder ließ sich niemand hören. „Hundertzehn Kronen zum dritten!“
Der Deutsche bemächtigte sich des Kinderwagens. Die Dorfbewohner senkten den Blick und traten einen Schritt, zwei Schritte zurück.
Der erste Gendarm trat an die Zigeunerlumpen heran, fischte einen noch halbwegs brauchbaren Topf aus dem Haufen, wies ihn den Umstehenden vor und rief: „Hier gibt es auch noch gute Sachen! Ihr wollt doch nicht das alles auf den Mist werfen? Was bietet ihr für diesen Topf?“
Die Umstehenden, denen eine immer größere Verlegenheit anzumerken war, antworteten mit starrköpfigem Schweigen. Der Bürgermeister fühlte, daß die Lage peinlich wurde, und wandte sich zu dem versöhnlich scheinenden Gendarmen. Eine kurze Verhandlung zwischen den beiden Männern in Uniform folgte. Der erste Gendarm gab endlich nach und ließ den Topf ärgerlich zwischen die Lumpen zurückfallen. Er wandte sich heftig ab, als wollte er mit der Gruppe der Dorfbewohner nichts mehr zu tun haben, und sagte, zum Bürgermeister gewendet: „Jetzt gehen wir das Protokoll schreiben!“ Dann rief er dem Gemeindediener herablassend zu: „Sie haften mir dafür, daß hier nichts verschwindet!“
Schweren Herzens ging ich durch den Garten zurück, legte den Rock an und ging zur Auferstehung. Der junge Kaplan aus der Nachbargemeinde kam im weißen Pluviale aus der Sakristei geschritten, vor ihm trugen sechs Männer den gefalteten Baldachin. Als er vor dem Gottesgrab unter der mit Weißem Tüll verhüllten Monstranz niederkniete, trat der Kirchendiener, der sich irgendwo verspätet haben mußte, a,u| ih^^Ztt, beugte sich“ sichtbar'erregt zu ihm nieder und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der junge Priester senkte den Kopf. \iri$%eii-weilte einen Augenblick kniend. Es war, als ob sich sein tiefes Schweigen durch das ganze Kirchenschiff entfalte. Endlich erhob er sich, nahm die Monstranz in die Hände und zog den weißen Schleier zur Seite. Dann wandte er sich zu den Gläubigen und begann, den alten Triumphgesang zu intonieren, den unvergeßlichen Schrei der christlichen Hoffnung, die Jahrhunderte erfüllt und in die Ewigkeit strömt: „Er ist auferstanden!“ Zwei Tränen liefen ihm die blassen Wangen hinab.
Das feierliche Dröhnen der Glocken und der Orgel antwortete ihm; der strahlende Baldachin begann seinen Weg durch
das blumengeschmückte Schiff, an den leidvollen Menschen vorbei, die noch einmal unsterbliche Freude fühlten.
Ich sah, daß mich der Kirchendiener mit den Augen suchte, und näherte mich ihm, während die Prozession dahinschritt.
„Der Herr Pfarrer ist gestorben“, sagte er mir.
„Ich weiß“, antwortete ich.
Aus „Zelt und Wiederkehr'. b/Wer aus Böhmen and Mähren von Jan Cep Herder-Verlag, Wlen-ftctburt-Basel.