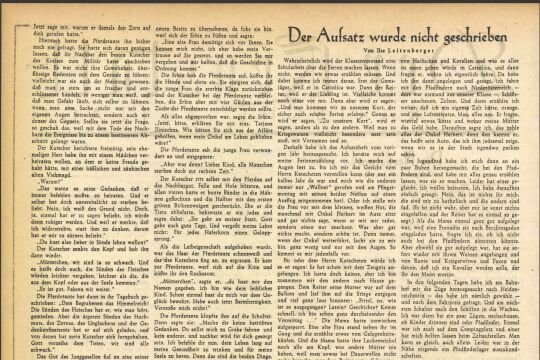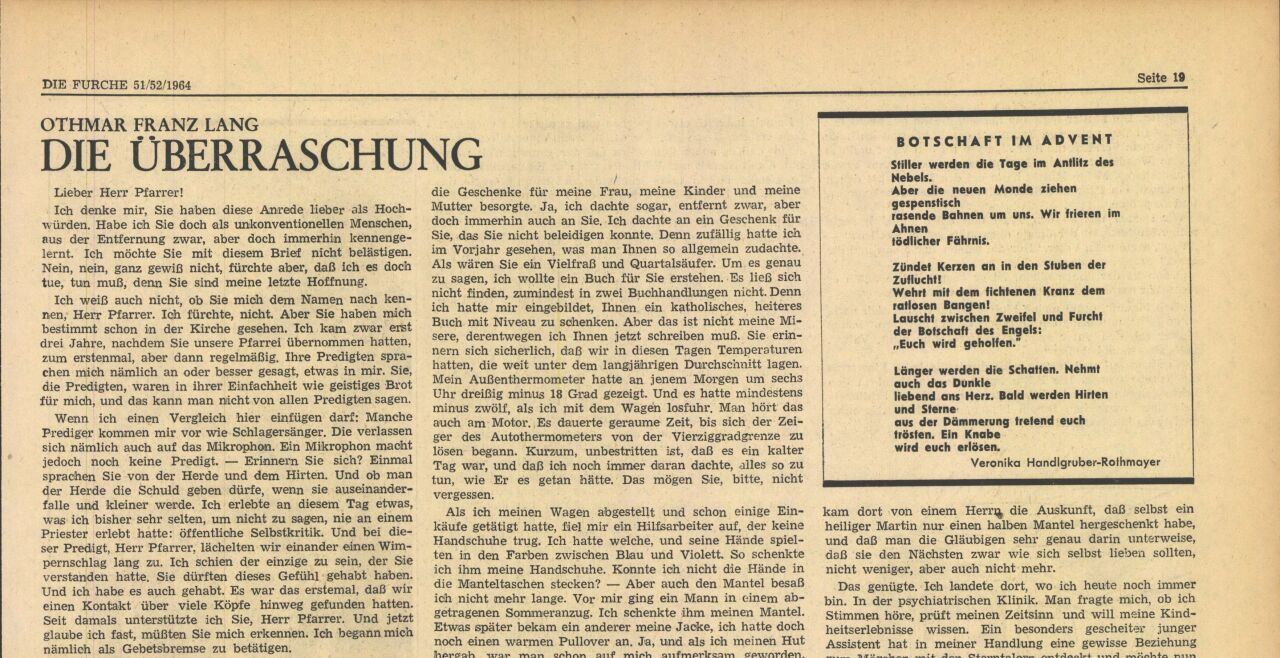
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
DIE ÜBERRASCHUNG
Lieber Herr Pfarrer!
Ich denke mir, Sie haben diese Anrede lieber als Hochwürden. Habe ich Sie doch als unkonventionellen Menschen, aus der Entfernung zwar, aber doch immerhin kennengelernt. Ich möchte Sie mit diesem Brief nicht belästigen. Nein, nein, ganz gewiß nicht, fürchte aber, daß ich es doch tue, tun muß, denn Sie sind meine letzte Hoffnung.
Ich weiß auch nicht, ob Sie mich dem Namen nach kennen, Herr Pfarrer. Ich fürchte, nicht. Aber Sie haben mich bestimmt schon in der Kirche gesehen. Ich kam zwar erst drei Jahre, nachdem Sie unsere Pfarrei übernommen hatten, zum erstenmal, aber dann regelmäßig. Ihre Predigten sprachen mich nämlich an oder besser gesagt, etwas in mir. Sie, die Predigten, waren in ihrer Einfachheit wie geistiges Brot für mich, und das kann man nicht von allen Predigten sagen.
Wenn ich einen Vergleich hier einfügen darf: Manche Prediger kommen mir vor wie Schlagersänger. Die verlassen sich nämlich auch auf das Mikrophon. Ein Mikrophon macht jedoch noch keine Predigt. — Erinnern Sie sich? Einmal sprachen Sie von der Herde und dem Hirten. Und ob man der Herde die Schuld geben dürfe, wenn sie auseinanderfalle und kleiner werde. Ich erlebte an diesem Tag etwas, was ich bisher sehr selten, um nicht zu sagen, nie an einem Priester erlebt hatte: öffentliche Selbstkritik. Und bei dieser Predigt, Herr Pfarrer, lächelten wir einander einen Wimpernschlag lang zu. Ich schien der einzige zu sein, der Sie verstanden hatte. Sie dürften dieses Gefühl gehabt haben. Und ich habe es auch gehabt. Es war das erstemal, daß wir einen Kontakt über viele Köpfe hinweg gefunden hatten. Seit damals unterstützte ich Sie, Herr Pfarrer. Und jetzt glaube ich fast, müßten Sie mich erkennen. Ich begann mich nämlich als Gebetsbremse zu betätigen.
Mir ging schon immer das Vaterunser nicht mit jener wieselflinken, Worte verstümmelnden, mechanischen Behendigkeit von den Lippen, die damals noch in unserer Pfarre gang und gäbe war und die auch Sie schmerzte. Jawohl, ich merkte es. Und so begann ich gegen den Strom zu beten. Es war eine mühsame Sache, aber sie lohnte sich. Trug sie mir zunächst so manchen Puffer christlicher Nächstenliebe ein, so manchen Zischer, der Höllenfeuer zum Verflackern gebracht hätte, und Blicke erst, die Gott gewiß im Zorn nicht fertig bringt; eines Tages, Sie wissen es, war ich nicht mehr der Nachhall der Masse, nicht mehr der einsame, zu spät beim „Amen“ Ankommende; eines Tages war die Sucht, das Vaterunser in Rekordzeit zurückzulegen, zu Ende, eines Tages war plötzlich die Würde des Gebetes und der Betenden wiederhergestellt.
Kennen Sie mich nun? Ich hoffe, ja. Denn ich brauche Sie. Ich bin in großer Not. Und nur Sie können mir helfen.
Es begann damit, daß Sie am ersten Adventsonntag von dem ganz anderen Weihnachten sprachen, das wir endlich wieder einmal feiern sollten. Sie sprachen davon, daß wir uns endlich wieder einmal selbst überraschen sollten beziehungsweise daß wir uns von uns selbst überraschen lassen sollten. Sie fanden, wenn wir in dieser Zeit unser Leben nach Christus ausrichteten, ihm wirklich nacheiferten, dann würden wir manches Mal von uns diese Überraschung erleben.
Ich gestehe hier gerne, daß ich es versucht habe. In meiner Familie zunächst und im Büro, und ich habe damit wirklich so manche Überraschung ausgelöst. Ja, ich bin nicht nur von den anderen, sondern sogar von mir überrascht worden. — Sieh, dachte ich mir, so einfach ist das, wenn man sich immer nur kurz überlegt, was würde Er in meiner Situation getan haben. Ich war seltsam glücklich dabei, Herr Pfarrer. Ich kam mir fast wie ein guter Mensch vor. Etwa so wie damals, als ich ein Junge war und Überzeugungen hatte. Aber leider, es kam anders als ich dachte. Es konnte nicht gut gehen. — Ich hatte mit den anderen nicht gerechnet, mit den Normalen nicht und nicht mit den Anständigen. Ich habe das Mittelmaß überschritten, und muß nun dafür büßen.
Es war am Vormittag des Heiligen Abends, an dem ich die Geschenke für meine Frau, meine Kinder und meine Mutter besorgte. Ja, ich dachte sogar, entfernt zwar, aber doch immerhin auch an Sie. Ich dachte an ein Geschenk für Sie, das Sie nicht beleidigen konnte. Denn zufällig hatte ich im Vorjahr gesehen, was man Ihnen so allgemein zudachte. Als wären Sie ein Vielfraß und Quartalsäufer. Um es genau zu sagen, ich wollte ein Buch für Sie erstehen. Es ließ sich nicht finden, zumindest in zwei Buchhandlungen nicht. Denn ich hatte mir eingebildet, Ihnen ein katholisches, heiteres Buch mit Niveau zu schenken. Aber das ist nicht meine Misere, derentwegen ich Ihnen jetzt schreiben muß. Sie erinnern sich sicherlich, daß wir in diesen Tagen Temperaturen hatten, die weit unter dem langjährigen Durchschnitt lagen. Mein Außenthermometer hatte an jenem Morgen um sechs Uhr dreißig minus 18 Grad gezeigt. Und es hatte mindestens minus zwölf, als ich mit dem Wagen losfuhr. Man hört das auch am Motor. Es dauerte geraume Zeit, bis sich der Zeiger des Autothermometers von der Vierziggradgrenze zu lösen begann. Kurzum, unbestritten ist, daß es ein kalter Tag war, und daß ich noch immer daran dachte, alles so zu tun, wie Er es getan hätte. Das mögen Sie, bitte, nicht vergessen.
Als ich meinen Wagen abgestellt und schon einige Einkäufe getätigt hatte, fiel mir ein Hilfearbeiter auf, der keine Handschuhe trug. Ich hatte welche, und seine Hände spielten in den Farben zwischen Blau und Violett. So schenkte ich ihm meine Handschuhe. Konnte ich nicht die Hände in die Manteltaschen stecken? — Aber auch den Mantel besaß ich nicht mehr lange. Vor mir ging ein Mann in einem abgetragenen Sommeranzug. Ich schenkte ihm meinen Mantel. Etwas später bekam ein anderer meine Jacke, ich hatte doch noch einen warmen Pullover an. Ja, und als ich meinen Hut hergab, war man schon auf mich aufmerksam geworden. Mütter zogen ihre Kinder an sich, als müßten sie sie vor mir in Schutz nehmen, ja, als wäre meine Nähe gefährlich oder nur mein Anblick. Ich stand plötzlich in einer Schar von Gaffern, zum Teil gut gekleideten, bürgerlichen, wohlhabenden Gaffern, und man wich vor mir zurück, als hätte ich den Aussatz. Ich begriff nicht, wie das so kommen konnte. Ich hatte doch nur einmal versucht das zu tun, was ER in meiner Lage getan hätte. Und nun war, wie ich aus den wirren Gesprächen entnehmen konnte, sogar schon die Funkstreife meinetwegen unterwegs.
Ich wurde festgenommen, Herr Pfarrer. Begründung: Ich hätte mich verdächtig gemacht. Als ich bei der Polizei zu Protokoll gab, warum ich es getan hätte, sagte ein Polizist: „Sie halten sich wohl selber für ihn, nicht?“
„Nein“, entgegnete ich, „ich weiß doch, wer ich bin.“ Da lachten sie mich aus.
Ich wurde dem Arbeiter, dem ich die Handschuhe, den Männern, denen ich Mantel, Rock und Hut geschenkt hatte, gegenübergestellt. Und sie wiesen mit den Fingern auf mich und sagten: „Ja, der war es!“
Was meine Lage später in einem milderen Licht erscheinen ließ, war lediglich der Umstand, daß sie übereinstimmend bekundeten, ich hätte nichts von ihnen verlangt.
Dann gingen die Männer.
Ich mußte bleiben. Ich versuchte den Polizisten mein Verhalten klarzumachen. Ich sagte viel und erklärte auch, daß ich seit Johannes XXIII. es einfach nicht mehr fertig brächte, der gleiche Christ zu bleiben wie bisher. Aber das verschlechterte nur meine Lage.
„Wir sind auch von ihm angetan“, sagten Polizisten, „oder meinen Sie, wir wären Unmenschen? Aber schenken wir deswegen unsere Mäntel her?“
Und so hörte ich es zum erstenmal. Weil sie nicht die Mäntel hergeschenkt hatten und ich schon, war ich nicht normal. In der- ganzen Stadt hatte niemand einen Mantel auf der Straße hergeschenkt, also war ich verdächtig.
Man rief, und das war ein Entgegenkommen, denn es war ja Weihnachten, eine höhere geistliche Dienststelle an und be kam dort von einem Herriį die Auskunft, daß selbst ein heiliger Martin nur einen halben Mantel hergeschenkt habe, und daß man die Gläubigen sehr genau darin unterweise, daß sie den Nächsten zwar wie sich selbst lieben sollten, nicht weniger, aber auch nicht mehr.
Das genügte. Ich landete dort, wo ich heute noch immer bin. In der psychiatrischen Klinik. Man fragte mich, ob ich Stimmen höre, prüft meinen Zeitsinn und will meine Kindheitserlebnisse wissen. Ein besonders gescheiter junger Assistent hat in meiner Handlung eine gewisse Beziehung zum Märchen mit den Sterntalern entdeckt und möchte nun immer wissen, welche Assoziationen dieses Märchen in meiner Kindheit in mir hervorgerufen habe. Man möchte erfahren, wie ich zu meinem Vater und zu meiner Mutter stand und ob ich meine Lehrer haßte. Kurzum, man sucht nach komplizierten Erklärungen, wo es nur eine ganz simple gibt.
Ich wollte mich nämlich ändern. Ich wollte spontan etwas Gutes tun. Ich wollte nicht nur christliche Predigten anhören. Ich wollte Konsequenzen ziehen. Ich habe in meinem Schrank daheim fünf, sechs Mäntel hängen, ich besitze mindestens ein halbes Dutzend Hüte, und die Handschuhe, die ich herschenkte, waren absolut nicht neu. Und ich bekomme immer wieder Handschuhe zu Weihnachten geschenkt. Vom Christkind, wie man so sagt. Ich hatte ein ganzes Jahr gut verdient, mehr, als ich gehofft hatte.
War, in diesem Lichte gesehen, meine Tat so abwegig?
Manche werden einwenden, und sie haben es schon getan, daß ich aus persönlicher Eitelkeit so handelte. Das stimmt nicht, denn ich wußte ja nicht, daß ich Zuschauer hatte. Ich nahm nicht an, daß man meine Tat in einer belebten Großstadtstraße bemerken würde. Ich konnte ja nicht ahnen, daß selbst die Beschenkten Mißtrauen gegen mich faßten.
Ich bitte Sie daher, daß Sie mir helfen. Sie wissen, wie mein Handeln gedacht war und welche Wurzeln es hat. Denn, um es ehrlich zu sagen, ich habe das leise Gefühl, daß sogar meine Frau mich mit einem nur schwer unterdrückten Grauen betrachtet, wenn sie mich besucht. Und meine Kinder, die immer von mir forderten, ich möge endlich weniger bürgerlich sein, sind böse, weil ich ihnen durch meine Handlung den Weihnachtsabend verdorben habe. Durch meine, wie ich annehme, unbürgerliche Handlung, die ihnen ein durchaus bürgerliches Beschenktwerden nicht ermöglichte.
Wie dem auch sei. Es wurde wirklich ein ganz anderes Weihnachten für mich. Ich wurde überrascht. Und ich werde viel nachzudenken haben. Ich weiß nicht, ob der Rest meines Lebens dazu reicht.
Kommen Sie?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!