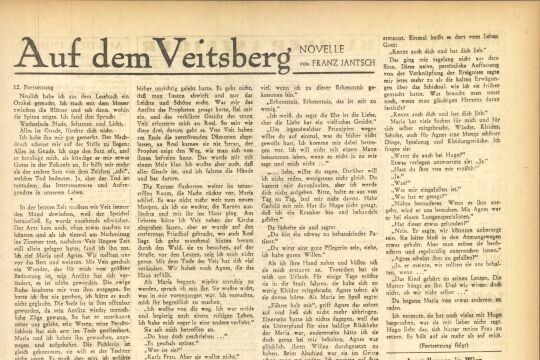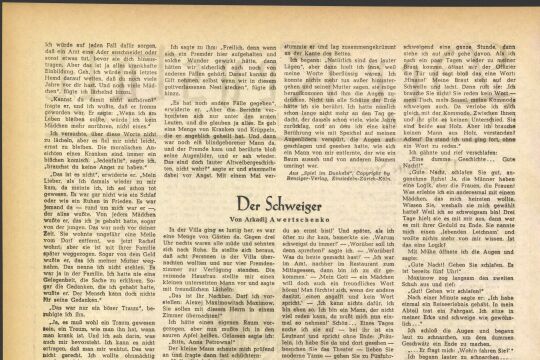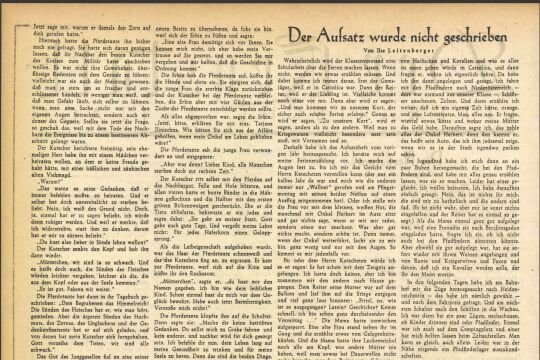Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Freundschaft beginnt
Ich will nicht von den Freundschaften reden, die nicht zustandegekommen sind, sondern von meiner Freundschaft mit Ingrid Barhaupt. An einem Freitagabend kam sie mit ihrem Mann. Warum Raimund gerade dieses Ehepaar eingeladen hatte, verstand ich nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß Werner Barhaupt, ein biederer Durchschnittsmann mit steifen Manieren, ihm als Arbeitskollege so angenehm war, daß ihn der Wunsch gepackt haben konnte, auch sein privates Leben durch ihn zu bereichern. Er führte diesen exemplarischen Kleinbürger wohl eher mir zu.
Der Besuch begann mit dem üblichen Höflichkeitsritus, der zwischen Harry und mir längst beseitigt war. Der Mann überreichte mir Blumen in Klarsichtpackung. Die Frau gab mir lächelnd die Hand und schaute mich neugierig an.
Wir tranken den üblichen Aperitiv vor dem Essen. Es wäre an Raimund gelegen, die Stimmung zu heben, denn nur ihm war wenigstens Werner Barhaupt nicht fremd. - Doch er tat nichts dergleichen, Er benahm sich so würdevoll, so tadellos langweilig, daß mir ein Licht aufging. - Er wollte gar nicht, daß sich der Abend gut anließ. Der sollte eine müde Angelegenheit sein, ein Wettgähnen, Sesselwetzen und Augen-verdrehen mit flehentlichen Blicken auf die Uhr, und damit meine erste Lektion, wie es war, wenn man sich befreundete Ehepaare heranzog. Schon der erste Versuch sollte sich als Fehlschlag erweisen. - Wenn das stimmte, war er gemein und sollte es büßen.
„Ich hielte es für richtig", sagte ich, „uns gegenseitig einmal ganz ungeniert zu betrachten. Dann bekommen wir eine Vorstellung voneinander. Ich weiß zum Beispiel schon, daß Frau Barhaupt neugierig ist."
Diese letzte Bemerkung war provokant, denn Neugier wird höchst unterschiedlich bewertet, je nach dem Gegenstand, auf den sie sich richtet. Doch Ingrid Barhaupt lachte mich zustimmend an und erklärte, sie sei nicht gierig nach Neuem, sie sei sogar süchtig danach.
Ich bemerkte, daß sie sehr klare Augen hatte. Sie waren, zumindest an der Oberfläche fast farblos und anscheinend dazu eingerichtet, möglichst viel in dieses Persönchen hineinzulassen, das recht klein war, aber den Eindruck machte, auch energisch und klug und vorurteilslos zu sein. Schon fand ein verschwörerischer Blickwechsel statt, der unsere Befangenheit dahinschwinden ließ.
„Von Ihnen", sagte Ingrid, „weiß ich auch allerhand. Sie getrauen sich eine Menge. Das imponiert mir."
Ich verstand ihre Anspielung nicht sofort. Ingrid klärte mich auf, indem sie verriet, daß Raimund im Büro verkündet hatte, seine Frau habe anläßlich eines wissenschaftlichen Vortrags allen Skeptikern einige Grundwahrheiten gesagt. Ihr Mann habe es zu Hause weitererzählt, und sie habe ihn gleich einmal mit der Bemerkung geärgert, sie hätte an meiner Stelle das gleiche getan. Doch die Liebe in ihren Augen war un-geheuchelt, als sie ihn ansah und sagte: „Er ist nämlich auch so ein Hohlkopf".
Ich erwartete, daß er aufbrausen werde. Aber er sagte geduldig und gönnerhaft, wobei er sich an mich wandte, nicht an Ingrid: „Sie kann sich nicht vorstellen, was es bedeutet hat, das wissenschaftliche Denken einzuführen, zu einer Zeit, in der es nur Spekulationen gegeben hat. Man denke an Galilei, der die Jupitermonde entdeckt hat. Willst du ernstlich behaupten, daß er ein Hohlkopf war?"
Diese letzte Frage war wieder an Ingrid gerichtet, die mich die ganze Zeit beobachtet hatte. Noch immer hielten mich ihre Augen in Bann. Sie waren jetzt nicht mehr farblos wie zu Beginn, aber immer noch so durchsichtig klar, daß man scheinbar in Ingrid hineinschauen konnte, und es war, als würde der Unmut sichtbar, der sich in ihr zusammenzurotten begann.
„Das ist ja der Denkfehler, den ich dir nicht ausreden kann. Damals waren die Leute, die logisch gedacht haben, selten. Sie waren tatsächlich mutig. Jetzt sind sie es nicht mehr. Sie sind zahlreich wie Spatzen und plusten sich auf und wollen nicht wahrhaben, daß es jetzt urngekehrt zugeht. Sie nehmen noch immer das gleiche in Schutz, was in früheren Zeiten neu und kühn war. Nur ist es heutzutage alt und gesichert. - Sie sind nicht weniger stur als diese Gelehrten, die nicht in Galileis Fernrohr schauen wollten, weil sie dann die Jupitermonde gesehen hätten und glauben hätten müssen, daß es sie gibt."
Das war der Augenblick, in dem Raimund aufstand. Er sagte: „Das wird ja ein Glaubenskrieg. Da muß Daniela an ihrer Kanone sein. Also trage ich inzwischen die Suppe auf."
Als wir dann bei Tisch saßen, stellte ich eine Frage, die mich vor verhaltener Erregung zittern ließ. Ich fragte Werner Barhaupt, was er wohl dächte, wenn jemand ihm sagte, er habe einen Toten erweckt. - Die Antwort kam sicher und freundlich: „Ich würde ihm sagen, er spinnt."
Er bewirkte damit, daß ich heftig zusammenzuckte, und daß mir der Löffel in den Teller fiel. Alle schauten mich an, und ich schämte mich gründlich. Nur vor Ingrid schämte ich mich seltsamerweise nicht. Da sie mir bei Tisch gegenübersaß, schaute ich senkrecht in ihre Augen, und da bemerkte ich in ihnen ein seltsames Glimmlicht. Es kam aus tiefen Regionen herauf und ließ mir die Botschaft zukommen, daß dort etwas wach war. Sie war schweigsam und schaute mich unbeirrt an, und ich konnte mich nicht von dem Gedanken befreien, daß ich das Glimmen ihrer Gedanken sah. Da faßte ich den Entschluß, mich ihr anzuvertrauen.
Am nächsten Abend, an dem ich allein war, rief ich sie an und fragte sie, ob sie nicht Lust hätte, mich zu besuchen. Nach einer Stunde läutete sie an der Tür, und schon im Vorzimmer, als sie noch im Mantel vor mir stand, sagte ich: „Ich habe Raimund von den Toten erweckt."
„Wie wunderbar!", rief sie aus und erglühte vor Neugier.
Dann saß sie mir gegenüber und hörte mich an. Als ich fertig erzählt hatte, sagte sie, ich hätte ihr ein Geschenk gemacht, das sie von der Angst vor dem Sterben befreit. Denn was sie soeben gehört habe, sei der Beweis, daß die Welt nicht ungeistig und sich selbst überlassen sei. Er sei die Entscheidung über Leben und Tod, die endlich zugunsten des Lebens ausfiel. Nun sei ihr die UnVergänglichkeit zugesagt worden.
Ich fragte: „Haben Sie nicht den Verdacht, ich könnte aus irgendwelchen Gründen gelogen haben?"
„Nein, das war keine Lüge", sagte sie abwehrend und fast schroff. „Sie sind nicht so zynisch, daß Sie mir vorlügen könnten, was für einen schrecklichen Tod ihr Mann gehabt hat. Sie wären dazu nicht imstande, obwohl er lebt. Wenn Sie die Absicht gehabt hätten, mich zu belügen, hätten Sie sich etwas anderes ausgedacht."
Für mich war in dieser Antwort mehr Konsequenz als im Denkmechanismus von manchen logischen Schlüssen. Es war ein gerades, irgendwie ökonomisches Denken, das sehr menschlich, sehr fraulich und sehr freundlich war.
An diesem Abend haben wir lange Gespräche geführt. Doch von meinem gelegentlichen Ärger mit Raimund erzählte ich nichts. Es paßte nicht dazu, war nicht wichtig genug und hätte uns nur unnötig Zeit weggenommen.
Was sie über sich selbst erzählte, war auch nicht gerade gewöhnlich, wenn auch längst nicht so provozierend wie mein Bericht. Sie hatte ein paar Semester Biologie studiert, weil sie gehofft hatte, etwas über das Leben zu erfahren, und hatte aufgegeben, weil sie enttäuscht worden war. Denn gerade die Biologie, die das Leben erklären wollte, sei zur Wissenschaft der Glaubenslosen geworden. Sie habe gespürt, daß sie etwas in Sicherheit bringen müsse, das dort, in den Hörsälen der Universität bedroht worden war.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!