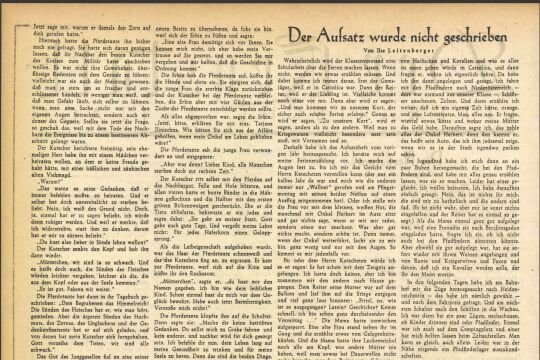Die großen Abenteuer, selbst wenn sie gut ausgehen, füllen den Magen nicht. Nach wenigen Tagen waren die Kartoffeln, die ich im Austausch gegen meinen Anthrazit erhalten hatte, verbraucht, Und der Streik dauerte an. Ich sah von neuem, wie meine Mutter ihren Anteil an der Mahlzeit zurückwies mit dem Bemerken, sie habe keinen Hunger. Und bald konnte sie selbst diese List nicht mehr anwenden; es war nichts Eßbares mehr da. Wieder fing meine Mutter zu weinen an, und ich quälte mich ab. Am Ende der Woche würde die Miete fällig sein. In dieser Frage war der Hausherr unerbittlich: fünfundzwanzig Franken. „Nach dem Streik, wenn du wieder arbeiten wirst, ziehen wir aus, diesmal bestimmt!“ versicherte meine Mutter. Ach ja, man würde sich nicht weiter in dieser Weise bestehlen lassen...
Aber in der Zwischenzeit mußte etwas gefunden werden, um das Essen und den Zins zu bezahlen.
Ich wollte nicht mehr stehlen gehen. Der dicke Polizist hatte es mir wohl erklärt! ich riskiere zu viel dabei. Und ich hatte auch den Mut nicht mehr dazu, mein Abenteuer hatte mir zu viel Angst eingejagt.
Aber ich hatte die Unvorsichtigkeit begangen, bei uns getreulich die Worte des Polizisten zu berichten. Er hatte gesagt: „Man stiehlt nicht, man bittet die Leute...“ Das hatte meine Schwester Suzanne erschreckend gut behalten. Sie erzählte:
„Der Polizist hat Denise recht gut erklärt, sie braucht nur zu den Reichen zu gehen, da wird man ihr zu essen geben.“
Das brachte mich in Wut. „Nie im Leben!“ schrie ich. „Geh selber, wenn du willst I Aus mir werdet ihr keine Bettlerin machen!“
Aber meine Mutter geriet am Ende selbst in Zorn: „Was soll man tun, wenn du nicht gehen willst?“ sagte sie. „Du willst doch schließlich nicht, daß wir alle vier hier umkommen? Betrachte Didi ein wenig. Er ist nur noch Haut und Knochen. Es ist sehr schön, die Hochnäsige zu spielen, aber besser wäre es vielleicht, ein wenig mehr Herz zu haben.“
„Ich werde nicht wagen, betteln zu gehen“, erwiderte ich.
„Das beweist, daß du ein großer Feigling bist“, triumphierte meine Schwester. „Du liebst deine Mutter nicht.“
Man stritt mehrmals darüber in den folgenden Tagen. Ich blieb hart. Aber man hatte immer mehr Hunger. Vor allem meine Mutter und ich, die wir, ohne es uns zu sagen, in einem stillschweigenden Ubereinkommen zugunsten der Kleinen verzichteten. Seitdem habe ich „Hunger“ von Knut Hamsun gelesen. Ich habe darin nicht wiedererkannt, was ich selbst durchgemacht habe. Bei ihm waren es drei, vier fürchterliche Tage völligen Fastens. Danach war es für einen Monat vorüber. Bei uns war es ganz anders, mehr chronisch. Niemals genug essen, immer ein Loch im Magen haben: Dabei gibt es keine intellektuellen Überlegungen, keine Träume, kein Irrereden, keine fieberhafte geistige Überaktivität. Viel eher den Hunger eines Tieres, das ununterbrochene, konstante, dauernde Bedürfnis, essen zu gehen. Das begann am Morgen, wenn ich erwachte. Ich knabberte eine Scheibe Brot, die einzige des Tages, mit einer unendlichen Langsamkeit, damit sie länger dauere. Dann schleppte ich mich im Zimmer herum und versuchte, nicht an das Büfett zu denken. Nichts zu machen! Es zog mich an, es besaß mich. Man hatte geglaubt, daß es den ganzen Platz in der Küche einnehme, dieses Büfett. Ich sah nichts außer ihm. Ich ging hin, ich öffnete die beiden Türen mechanisch, ich warf einen Blick in die Fächer. Von vornherein wußte ich, daß nichts darin war, nichts mehr seit Wochen. Aber es hätte sein können, daß ich vielleicht doch noch etwas ausfindig gemacht hätte, in irgendeiner Ecke. Ich schloß das Büfett wieder. Ich begab mich wieder an meine Hausarbeit. Doch bereits fünf Minuten .später fand ich mich vor diesem Wunschträume erregenden Schrank wieder, ohne selbst daran zu denken, und untersuchte mit unbewußtem Blick von neuem ein Fach nach dem andern.
Es war noch Kaffee da. Ich trank eine Tasse davon, zwei Tassen. Ich leerte die Kanne. Ich ging zur Wasserleitung. Ich trank Wasser, drei, vier große Gläser. Von neuem umschlich ich dieses verzweifelt leere Büfett. Es war noch Brot in der oberen rechten Schublade. Ich nahm es, betrachtete es, das Wasser lief mir im Muhde zusammen. Ich maß den Teil, den ich davon morgen früh haben würde. Ich kratzte einige Krümel davon ab. Zu wissen, daß es bis morgen warten hieß, mit dieser Leere im Magen, mit dieser irren, sinnlosen und süchtigen Lust, mich auf diesen Brotrest zu stürzen, ihn hinabzuwürgen, ihn zu verschlingen! Bis morgen so leben müssen! Ich legte schnell das Brot an seinen Platz zurück. Ich fühlte, daß ich nachgeben würde, wenn ich es so in meinen Händen behielt.
Einmal habe ich nicht widerstehen können. Ich habe das Messer genommen und eine dünne, dünne Scheibe abgeschnitten, und ich habe sie gegessen. Ich hatte kein Recht dazu, es ging auf Kosten der andern. Als sie nach Hause kamen, sagte ich ihnen nichts. Und am nächsten Tag nahm ich meinen Teil an wie sie. Ein Diebstahl, den ich da begangen hatte an meiner Mutter, Suzanne und Didi. Eine schmutzige Erinnerung in meinem Innern. Man liebt es nicht sehr, an solche Sachen zu denken.
In diesem Zimmer jedoch gab es keine
Möglichkeit, an etwas anderes zu denken als Essen, Essen, Essen ... Man weiß nicht recht warum, aber die Besessenheit war hier größer als überall. Es war besser, wegzugehen. Ich ließ alles stehen und ging. Draußen gab es Leben, Bewegung, Zerstreuung, der Geist war beschäftigt, man spürte den Hunger weniger. Und dann findet man! Es ist unglaublich, was man zu essen finden kann, so aus Zufall, am Weg. Einen Haufen Dinge, die man gewöhnlich gar nicht wahrnimmt. Ich ging zum Beispiel nicht in die Stadt. Zu viel Auslagen, Bäckereien, Metzgereien, Konditoreien! Ein Martyrium. Und all dieser Duft von frischem Brot, von Küche, Suppe, gerösteten Zwiebeln, Braten steigt dir in die Nase, steigt bis in den Magen herab und verdreht dir die Augen. Selbst der Gestank gekochten Krautes, ja sogar der Geruch von Spülwasser, der von einem
Ausguß aufsteigt, werden zu einem Genuß. Man versteht die Schweine. Man gerät letztlich in Wut gegen diese Dinge, gegen alle die Leute, die einem solche Sachen unter die Nase und die Augen legen und Geld dafür wollen.
Ich mußte nun doch den ganzen Tag betteln gehen. Meine Schwester läutete an den Haustüren. Danach lief sie fort und ließ mich allein mit Didi vor der Tür stehen. Didi war zu jung, er verstand die Scham noch nicht. Wenn meine Schwester von weitem sah, daß die Leute mich warten hießen und nicht wegschickten, dann kam sie schnell herbei. Sie war es, die geschwind ihren Sack öffnete, um das Brot zu empfangen. Ich sagte fast überall dasselbe, ich erklärte: „Gnädige Frau, ich bin in Streik, ich habe meinen kleinen Bruder, meine Schwester zu ernähren, und meine Mutter ist krank. Wenn Sie etwas für mich tun könnten ...“
Ich erhielt kaum etwas. Viele Leute, viele Bürger hassen in Zeiten des Streiks den Arbeiter, den Streikenden. Und dabei mußte man doch sehen, daß ich keine Berufsbettlerin war. Heute weiß ich, daß ich das entsprechende Auftreten nicht besaß. Mit siebzehn Jahren fällt man kaum so tief. Man hätte denken müssen, daß eine ungewohnte Not vorliegen mußte. Aber es war falsch, sofort zu sagen, daß ich in Streik sei. Das erweckte augenblicklich den Haß. Man hörte mich nicht mehr weiter an, man schlug mir die Tür vor der Nase zu. Die Leute warfen mir an den Kopf:
„Sie brauchen ja nur zu arbeiten!“
„Ich verlangte nichts Besseres“, antwortete ich. „Wenn ich eine Arbeit hätte... Aber ich finde keine.“
Denn wahrhaftig, im Grunde war das immer meine große, nicht eingestandene Hoffnung: daß sie mich beim Worte nähmen, daß sie mir eine Stellung anböten, eine Arbeit, und mir das Leben retteten. Aber sie zogen eine andere Schlußfolgerung:
„Sie müssen sich nur durchwinden! Sie sollten sich schämen!“
„Gehen Sie nach Fourmiesl“ sagt mir eine Frau. „Da gibt es Fabriken. Dort werden Sie Arbeit bekommen.“
„Ich habe kein Geld. Wenn ich welches hätte...“
Ich besaß die Naivität, mit verbitterten und wütenden Menschen zu diskutieren und zu glauben, sie ließen sich überzeugen. Trotzdem, einmal unter fünfzehn hieß man mich warten und brachte mir Brot. Viele Krusten. Wir ließen sie in unseren Sack gleiten. Und wenn er sich zu füllen begann, mußte man aufpassen, ihn nicht gar zu sehr zu zeigen, die Leute hätten sonst nichts mehr gegeben.
Alle Reichen müßten einmal betteln gehen. Sie würden dann besser lernen, Almosen zu geben. Mit ein wenig mehr Fürsorge, Zuvorkommenheit, Respekt und Liebe. All das Brot: Sicher, ich war zufrieden, es zu haben, ich verlangte nicht mehr. Aber uns fehlten so viele andere Dinge! Wie arm man auch sei, man lebt nicht nur von Brotkanten. Man muß auch seine Miete bezahlen und die Kohlen. Man braucht eben auch Geld. Doch darum kümmerte man sich nicht. Man hatte Angst, betrogen zu werden. Man sagte sich ohne Zweifel: „Wenn sie wirklich Hunger hat, dann soll sie Brot essen. Wenn sie uns belügt, wenn sie versuchen sollte, uns zu betrügen, so legt sie sich nur selbst hinein.“
Es war eine Art Falle, letzten Endes, die man mir stellte, eine richtige Falle. Man wollte mich drankriegen. Als ob es möglich wäre, betrogen zu werden, wenn man gibt! Als ob man nicht immer für sich selber gäbe! Als ob der Gewinnende nicht immer der Geber wäre!
Ich fühlte das alles nicht, ich ahnte es nicht. Ich war schon zu glücklich, wenn eine mitleidige Geste mir die schreckliehe Bitterkeit linderte, die darin lag, die Hand ausstrecken zu müssen. Erst später, in Gedanken daran, habe ich verstanden, wie die Dinge liegen und daß man niemals za einem Wesen sagen darf: „Ich gebe dir nur gerade das Recht, nicht Hungers zn sterben.
Und diese Dienstboten, die härter waren als ihre Herrschaft! Diese großen Herrensitze, wo aufgeregte, überlastete Dienstmädchen schon dadurch gereizt waren, daß man sie mitten in der Arbeit störte; sie kamen uns die Tür öffnen und jagten uns zum Teufel. Die Herrschaft wußte es nicht. Ich sehe es heute, die Mehrzahl von ihnen weiß nichts von diesen Dingen. Sie würden gut sein, sie sind auch gut, wenn man dazu kommt, ihr Herz zu rühren. Aber sie können sich nicht damit amüsieren, so werden sie mir antworten, selbst bei jedem Klingelzeichen an die Tür zu gehen. Ich weiß. Aber ich weiß auch, daß es ganz in meinem Innern heute eine Faulheit gibt, einen Egoismus, eine duckmäuserische Feigheit, die es zu besiegen gilt, um nicht in meinem Haus den Empfang eines Armen den Dienstboten zu überlassen. Es ist so bequem, auf die Schultern eines andern die Güte des Gebens oder die Grausamkeit des Verweigerns abzuwälzen. Und wenn wir davongingen, wieder einmal abgewiesen, so fühlten wir sehr wohl, daß es nicht so sehr die Schuld des Dienstboten war, meist eines armen Mädchens, das durch dies dauernde Schellen außer sich gebracht war, einer. Arbeiterin wie wir, deren Mühe wir nicht respektiert hatten, sondern daß die Herrschaft im Grunde die Verahtwortlichen waren, der Reiche, der uns nicht erlaubte, bis zu ihm vorzudringen und die letzte Hilfsquelle, die letzte Waffe zu gebrauchen, die uns blieb, um das Herz der Glücklichen zu rühren: unsere Blöße, unser Leiden, die nackte Wahrheit unseres Elends.
Aus dem Roman „Femmes a l'encan, deutsch von C. A. Weber. Abgedruckt in „Dichtung der Gegenwart. Frankreich.“ München, W. Weismann; Kommissionsverlag Abendlandverlag, Innsbruck.