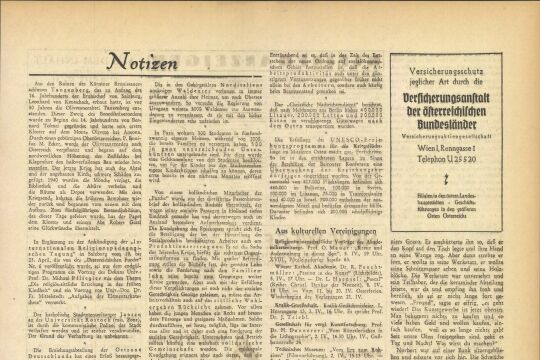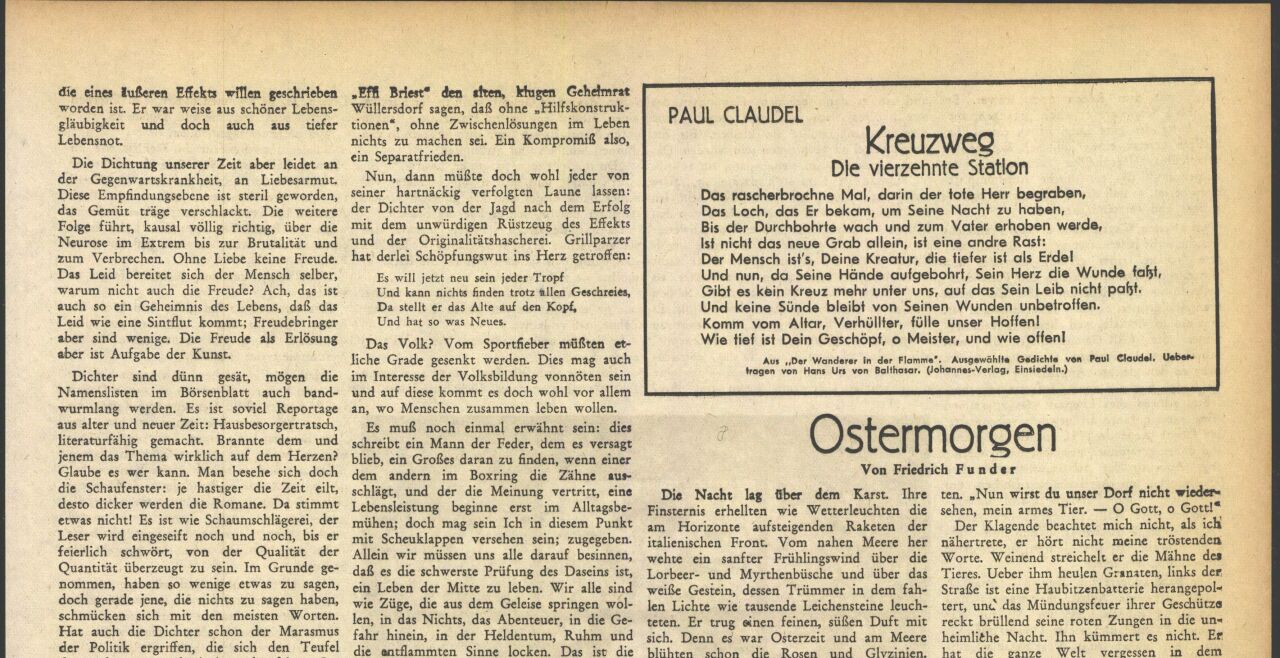
Der Titel ist schon richtig. Das heißt, er stimmt als Etikett. Lese ich „Die Waise von Balaklawa“, so fällt mir jene Nacht vor zehn Jahren ein. Nicht die Fährt von Bukarest ins Donaudelta, nicht das Vogelparadies, nichts von dem, wonach die Leute später wohl gefragt haben mochten oder worüber ich erzählte.
Luigi D. war.damals Sekretär, aber schon in jenem Frühjahr, wie gesagt, vor genau zehn Jahren, gab es niemand zwischen Calea Victoriei und Boulevard Bratianu, der ihm nicht eine große diplomatische Karriere prophezeit hätte, noch dazu, wo er beson- deren Wert darauf legte, beim Protokoll zu verbleiben. Daß er es dafür einfach in sich hatte, bewies dann auch das Telephongespräch. „Fahren Sie mit nach Välcov“, hieß es in einem Rumänisch, das den Blajer Sprachreformatoren des vergangenen Jahrhunderts ihren Latinitätsoptimismus bestätigt hätte. „Ich garantiere Ihnen eine nette Gesellschaft. Alle möglichen Leute. Einmal fischen und zum andern Brehms Tierleben statt Siegesmeldungen am laufenden Band. Das Delta ist unser. Feiern wir es, bevor es Abend wird.“
Im Telephon knackte es.
„Hören Sie — fuhr Luigi, der geborene Diplomat fort — hören Sie, man bedient sich der Abhörmethoden der Achse. Man modernisiert sich auch bei der Sigurantza. Man tut, was man kann. Man siegt mit. Man hört mit ab.“
In der Tat: es war eine nette Gesellschaft. Bis Constantza redete außer Luigi niemand. Das Protokoll war schuld. Neben Luigi selbst saß Hauptmann B. vom Büro des deutschen Luftwaffenattaches, erst seit kurzem in Bukarest, vorher in Paris, zwischen beiden im Lazarett, Schuß durch den Mund. Bei ihm ging’s mit dem Reden noch schwer. Bei Reinhold Sch. wäre es schon gegangen, aber den hatte der gute Luigi neben einen Ehemaligen gesetzt, einen jüdischen Kollegen in Petroleumangelegenheiten sozusagen, der immer noch das rumänische Außenministerium beriet, so daß das Mißtrauen ein beiderseitiges und verständliches war.
Im zweiten Wagen stand es nach Frantiseks Gesicht nicht besser. Der grinste nämlich über dem Volant seines grünen Mercedes und blinzelte der Dame zwischen den Petroleumkollegen zu. Die wiederum wußte, daß, wenn Frantisek grinste, es sonst sicher niemand tat, ganz einfach deshalb, weil ehemalige Kammerdiener der CSR-Gesandtschaft, die nun Fahrer des kroatischen Gesandten waren, nicht an den gleichen Angelegenheiten Gefallen finden wie der neue Chef, ein sehr verliebtes schwedisches Ehepaar, das zusammen keine vierzig Jahre alt gewesen sein dürfte, der Conte Rene de l’H., ein Ovid-Forscher und daher gezwungen gewesen, Anno vierzig nach Abbruch der rumänisch-französischen Beziehungen um Asylrecht anzusuchen, um Bibliotheken und Fundatia Carol nahezuzubleiben, und Wally schließlich, der irgendwo zwischen Wirtschaftsabteilung und deutscher Abwehr seit drei Jahren täglich seine Einberufung erwartete.
Die Lage änderte sich aber in Constantza. Luigi hatte eine Autokarte vergessen und brauchte Frantisek, der im Verlauf der Kleinen Entente und vieler Donaukonferenzen die Zufahrt zum Vogelparadies auswendig wußte. Bis sie sich endlich geeinigt hatten, stellten die verliebten Schweden fest, daß es kalt sei, worauf Frantiseks Chef meinte, man müsse dann eben etwas trinken, wozu der Conte nur nickte, der kleine deutsche Hauptmann aber ein deutliches „Jawohl, das müssen wir!“ seiner neuen Mundpartie entrang, in der Bodega schließlich nur ein Tisch war und die heiße Tzuica es innerhalb einer kurzen Stunde fertigbrachte, Luigis nette Gesellschaft zu verwirklichen.
Välcov wurde erreicht. Das Rasthaus entpuppte sich als über alles Erwarten anziehend, Und da es zu Fisch- und Vogelstudien an diesem Tag zu spät geworden war, versammelte sich die nette Gesellschaft alsbald im Speisesaal und war bereit, eine nette Gesellschaft zu bleiben, hätte es nicht das Radio gegeben. Im Radio aber gab es einen Heeresbericht, einen deutschen, einen rumänischen, einen italienischen, sehr viele Kommentare zu irgendwelchen Konferenzen, sehr viele Glückwunschtelegramme, und da mußten alle zuhören, weil jeder von jedem dachte, daß er zuhörte, wobei alle wiederum vergaßen, wie neu ihre nette Gesellschaft war, und Luigi glaubte, alles retten zu müssen dadurch, daß er seinen Telephonsatz, bei dem es knackte, wiederholte, nämlich den, daß man das Delta feiern müsse, bevor es Abend würde.
Damit aber war es um den Frieden geschehen. Die Kollegen vom Petroleum fragten: „Wie meinen Sie das?“, wenn auch mit verschiedenem Tonfall. Der kleine Hauptmann begann mit der Gabel auf dem Tischtuch den Rußlandfeldzug zu beenden, der Conte nickte entschlossen zu seinen Daten, weil er für Constantza und damit Ovids Verbannung hier zu nicken seit langem entschlossen war, Frantiseks Chef aber, der dalmatinischen Rotwein besser als Tzuica vertrug, erinnerte sich mit schweifendem blauem Blick seines nicht zu unterdrückenden slawischen Erbguts, Wally mahnte ihn mit dem Stichwort Ragusa zur Ordnung, was aber nichts half, und die verliebten Schweden machten alles nur schlimmer, weil sie neutrale Fragen stellten, die der Aufklärung unbedingt bedurften.
Als es längst Mitternacht, genauer drei vorüber war, fielen die verliebten Schweden mit dem Wort „This horrible war“ ins Englische und gingen bald darauf schlafen. Die Dame aber hatte Kopfschmerzen vom Tzuicadunst und Zigarettenqualm, vor allem von den mit Luigi tapfer zweigeteilten Bemühungen, gemeinsame Gesprächsfäden nicht abreißen zu lassen; sie vergewisserte sich also seines tadellos gezogenen Scheitels, des gleichfalls untadeligen Krawattenknotens und damit seiner weiteren Aktionsfähigkeit und verließ die nette Gesellschaft.
Und damit, erst damit geht die Geschichte uns an, beginnt die Geschichte „Die Waise von Balaklawa“.
Der dichte Nebel zeigte das Morgengrauen an. Ihre schmalen Absätze trafen auf Bretter. Das träge Wasser des Donauarms war nahe zu hören. Der Pelz beschlug sich an den Rändern der Kapuze, aber die Kälte drang nirgends durch. Irgendwo war dann das Boot. Sie streifte mit der Hand an der Kette und sah es dann bei dem Flämmchen des Streichholzes flach vor sich liegen. Eine Zigarette lang wollte sie bleiben. Bis die ersten Vögel zu vernehmen sein würden. Das Boot wiegte sich ein wenig, dann lag es still.
„Montag ist Lazarett“, dachte sie. „Um sechs Uhr früh... Ich werde müde sein. Ich darf nicht vergessen, den roten Lack von den Nägeln wegzumachen.“ Die Oberschwester wollte das. Und vor allem: der arme Ingolstädter hatte auf einmal seinen Brief nicht weiterdiktieren können, an seine Mutter, als er ihrer Hand beim Schreiben zusah. In den Briefen nach Hause spielte es keine Rolle. Es gab sie selten. Es war auch kompliziert zu schreiben: der Schwester in ihr Frontspital vor Leningrad, dem Bruder in die Gefangenschaft, Ort unbekannt, der Mama — die hatte nicht einmal Zeit zum Lesen mit ihrer Truppenbetreuung am Bahnhof, der Papa noch weniger in der Fabrik. Und umgekehrt? Was kam dann schon: „Danke für das letzte Paket... Diesmal brauchen wir dringend ...“ Oder: „Vetter Paul ist im Osten gefallen.“ Oder: „Elisabeths Verlobter ist vermißt. Hoffentlich kommt er wieder. Er ist der letzte von vier Brüdern, sein Vater fiel als Regimentskommandeur ...“ Oder: „Fränz- chen, erinnerst Du Dich, er war siebzehn bei der Matura, hat auf der Krim das EK I bekommen...“
„Nächste Woche zwei Tage Wien“, ging es ihr weiter durch den Kopf. „Und dann wahrscheinlich Istanbul. Oder Berlin? Oder Sofia? Gut, daß man diese Deltafahrt noch machte. Dieser unmögliche Luigi:bevor es Abend wird.“
Sie hatte den Alten nicht kommen gehört, weil er barfuß ging. Sie hatte aber auch keine Zeit, zu erschrecken, als er plötzlich riesenhaft vor ihr stand im ersten Frühlicht, guten Morgen wünschte und gleich darauf „Bleib sitzen“ sagte.
Er setzte sich ihr gegenüber, noch immer riesenhaft groß, und als er seine selbstgedrehte gelbe Zigarette anzündete, konnte sie erkennen, daß sein Gesicht fast zur Gänze von einem wilden Bart bedeckt war. Einen Augenblick lang glänzte es unter seinen Brauen auf.
„Bleib sitzen“, wiederholte er, bedächtig, in einem fremdartigen Rumänisch, wohl dem der Lipovenen hier.
„Bleib sitzen. Ich fahre nicht aus. Ich schlafe nur wenig. Ich komme früh aber immer als erster hierher’. Meine Enkel fahren aus. Wir haben sechs Boote. Mit diesem fährt der Mann von Zoe, Jancu.“
Auch sie nahm eine Zigarette, aber das Streichholz erlosch, weil ihre Hand zitterte. Erst das zweite blieb brennen.
Nun hatte der Alte Zeit gehabt, sie zu sehen: das weiße Gesicht, klein in der Kapuze, einen Strähn des hellen Haares, die langen roten Nägel. Er sah dann ihre Füße an in den dünnen Schuhen und Strümpfen.
„Du mußt frieren“, sagte er, „warte.“
Er stand umständlich auf, kniete vor seiner Bank nieder und zog einen Schafspelz darunter hervor, den er über sie breitete.
Da fing sie an zu erklären, merkte, daß sie von selbst in sein langsames Reden fiel, und dann, daß sie plötzlich Furcht hatte, er möchte sie nicht verstehen.
Als er wieder ein Streichholz anbrannte, sah sie erstaunt an der hellen Reihe seiner Zähne, daß er lachte.
Er lachte und unterbrach sie mitten in einem Satz:
„Ich habe auch mit der Zeitung zu schaffen gehabt“, sagte er dann, noch bedächtiger als vorhin, aber irgendwie stolz. „Ich kann nicht lesen, aber die Leute haben es mir oft erzählt. Obwohl es schon lange her ist. Ich habe nämlich einen Namen. Ich heiße ,Die Waise von Balaklawa’. Jedenfalls soll es in der Zeitung gestanden sein.“
Sie hörte ohne zu denken zu. „Orfanul de Balaklawa“ ... Es sagte ihr nichts.
„Ich war nämlich dabei damals. Mein Vater nahm mich mit. Einfach, weil die Mutter gerade gestorben war und wir niemand hatten in Chilia. Ich durfte meistens fahren, aber Marschieren gab’s auch schon. Ich weiß nichts mehr sonst, als daß die Fahrt sehr lange war. Und daß wir besiegt worden sind. Der Vater ist gestorben am Fieber, und deshalb kam ich schon bald wieder zurück.“
Sie starrte den Alten an.
„Balaklawa“, klang es irgendwo in ihrem Kopf. Und dann sprang irgend etwas an wie ein braver Motor: Balaklawa 1854. Krimkrieg. Seminar für russische Geschichte. Balaklawa ... Vetter Paul im letzten Sommer ... Ja? Aber nein, Balaklawa 1854...
Weil nun jeder seine Gedanken hatte, schwiegen sie beide. Dann war es der Alte, der wieder anfing.
Wieder glänzten seine Zähne. Wieder begann er zu lachen.
„Ich weiß, woher du bist“, begann er plötzlich.
Da horchte sie auf, erleichtert, auf einmal wach und fast neugierig.
„Von der guten Donau“, sagte er laut.
„Von der guten Donau, das höre ich am Reden. Ich weiß das. Ich weiß überhaupt sehr viel, weil ich älter bin und weil ich mehr Zeit habe als die Leute, die lesen und schreiben.
Von der Donau weiß ich noch mehr. Ich sammle Treibholz. Du könntest es bei Tag anschauen. Schöne Stücke. Auch von der schnellen Donau. Die meisten von der guten Donau. Ja, sie kommen durch beim Eisernen Tor. Bei euch fängt die gute Donau an.“
Was hätte sie sagen sollen?
Wieder funktionierte ihr Gehirn wie im Hörsaal. Balaklawa 1854. Wie alt mochte er da sein? Da fiel ihr ein, daß man sie überall für eine Siebenbürgerin hielt wegen ihres Akzents. Die Franzosen hatten einen anderen, wenn sie Rumänisch sprachen. Luigi hatte einen anderen. Aber der Alte ließ ihr keine Zeit.
„Was macht der gute Kaiser?“ fragte er weiter.
Erst verstand sie ihn nicht. Sein Wort für Kaiser war ihr fremd. Es war ein altes slawisches Wort, das nicht genau Kaiser meinte; sie erriet es mehr.
„Hast du ihn gesehen? Wir sagen hier so: der gute Kaiser, weil er von der guten Donau ist. Wir sagen auch: Der schwarze Kaiser, das ist der Zar. Sein Bild hängt im Haus bei Zoes Ikonen. Viele sagen, er wäre tot, aber niemand weiß, wie der jetzige heißt, darum bleibt das Bild an seinem Platz. Von uns hat den guten Kaiser niemand gesehen. Aber wir reden manchmal von ihm, die paar Alten, die noch da sind. Auch wenn ihn niemand gesehen hat. Er versteht alle Sprachen, heißt es bei uns. Niemand außer ihm versteht alle Sprachen.“
Sie rührte sich nicht. Auf einmal spürte sie, wie ihre Kehle eng wurde. Sie wollte etwas sagen, aber sie brachte kein Wort heraus. „Nein, ich habe ihn nie gesehen“, wollte sie sagen. „Das war doch nicht möglich. Als er starb, lernte der Vater gerade die Mama kennen. Als ich auf die Welt kam, war er schon tot.“
Der Alte hatte ein Netz, das zum Trocknen aufgespannt war, ins Boot gezogen, aber er ließ es dann auf seinen Knien liegen.
„Jetzt bist du müde“, sagte er dann. „Geh in dein Haus, vielleicht kannst du noch schlafen. Du schaust krank aus.“
„Ja“, sagte sie darauf heiser. „Ich gehe schon. Und — stand sie wieder im Seminar?: es tut mir leid, daß ich nichts weiß vom Kaiser, daß ich ihn nicht gesehen habe. Ich weiß nicht einmal, daß er alle Sprachen verstanden hat.“
Als sie aufstand, half ihr der Alte auf den Steg.
Sie reichte ihm bis an den kurzen Pelz, gerade bis zu den langen, schmutziggrauen Fransen seines Bartes. Er schien sie aus seinen kleinen Augen anzusehen, aber im Grunde nicht zu bemerken. Er murmelte nun unverständliche Worte, besann sich aber dann plötzlich, trat den Schritt ins Boot zurück, die Hände in den Aermeln seiner Jacke vergraben.
„Jaja“, sagte er, wieder in seinem langsamen, unsicheren Rumänisch: „Wir paar Alten, die noch leben, wir sagen es oft, wenn wir einander treffen: Gutes kommt für uns nur die Donau herab ...“
Sie sah das Haus kaum hundert Meter entfernt am Ende des Steges liegen. Die ersten Vogelstimmen meldeten sich. Der Nebel war durchsichtig geworden. Die Tür war offen, ihr Zimmer warm, das Bett lag unberührt. Sie öffnete das Fenster, zog sich einen Sessel davor und schaute hinaus auf die Weiden und das dunkle Wasser, bis ihr die Augen zufielen. Halb im Schlaf hörte sie ihre eigene Stimme, erstaunt, wie von weit her, die langsam, nun in ihrer Sprache, die letzten Worte des Alten wiederholte ...