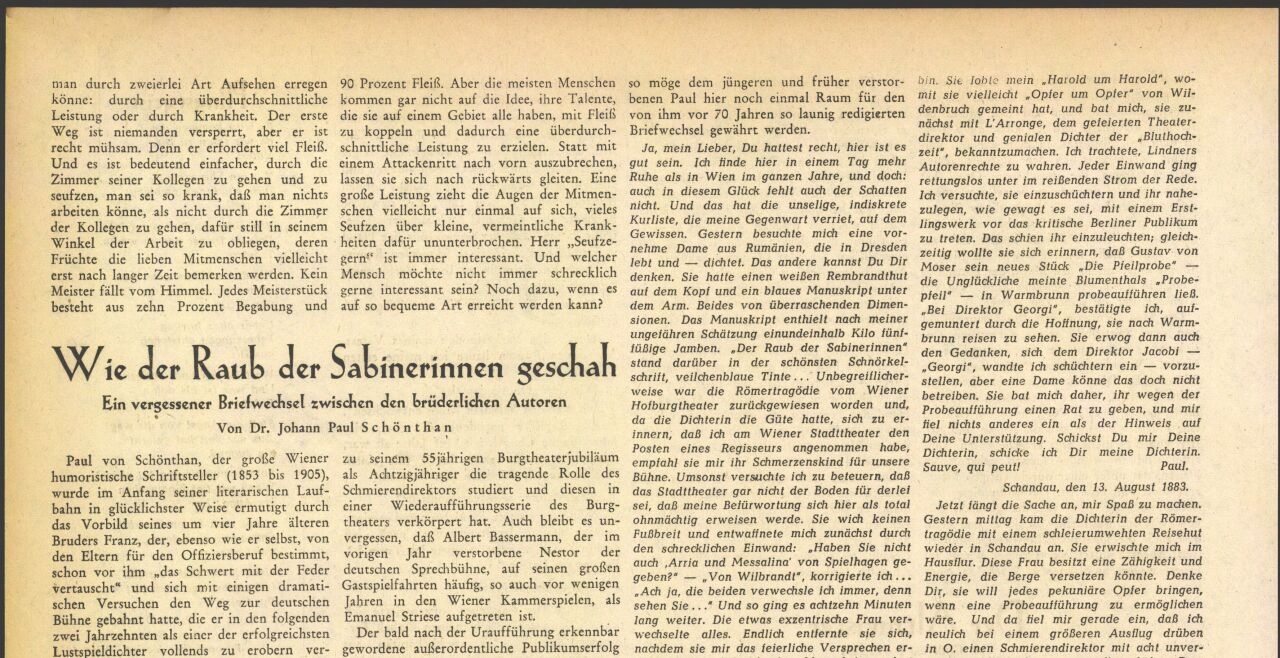
Paul von Schönthan, der große Wiener humoristische Schriftsteller (1853 bis 1905), wurde im Anfang seiner literarischen Laufbahn in glücklichster Weise ermutigt durch das Vorbild seines um vier Jahre älteren Bruders Franz, der, ebenso wie er selbst, von den Eltern für den Offiziersberuf bestimmt, schon vor ihm „das Schwert mit der Feder vertauscht“ und sich mit einigen dramatischen Versuchen den Weg zur deutschen Bühne gebahnt hatte, die er in den folgenden zwei Jahrzehnten als einer der erfolgreichsten Lustspieldichter vollends zu erobern vermocht hat. Während also der ältere Franz das ihm mit dem jüngeren Paul gemeinsame Erbteil — den liebenswürdigen Humor und den sicheren Blick für das Komische — sehr bald ausschließlich für die Schaffung heiterer Bühnenstücke nutzte, hat sich Paul in klarer Erkenntnis der seiner Begabung gesteckten Grenzen vorwiegend auf dem Gebiet der humoristischen Erzählung betätigt, im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts auch dem Feuilleton, der für den Tag geschriebenen Plauderei, der Theater- und Kunstkritik gewidmet. Indessen bewog ihn sein rastloser Fleiß gelegentlich auch zur Schaffung kleinerer Bühnenwerke, z. B. von einigen teilweise recht erfolgreichen Einaktern und Operettenbüchern, das eine oder das andere Mal auch zum Zusammenarbeiten mit seinem Bruder.
Das eine Mal hat gerade diese Gemeinschaft zum ganz großen Erfolg geführt, als nämlich die „dichtenden Brüder“ sich Anno 1883 über einem gemeinsamen Einfall zusammengesetzt und — den „Raub der Sabinerinnen“ geschrieben haben. Dieser bald nach seiner Uraufführung in Berlin (am 27. September 1884) über alle deutschen Bühnen gehende, dort unendlich oft gespielte, in andere Sprachen übersetzte und später auch mehrmals verfilmte Schwank hat seine Verfasser bisher um rund 40 Jahre überlebt, und es scheint so, als sei dem jetzt schon als „klassisch“ bezeichneten Schwank ein noch längeres Leben beschieden.
Die ungewöhnliche Langlebigkeit des „Raub der Sabinerinnen“ ist nicht zuletzt aus der in seinem Mittelpunkt stehenden und, wie es scheint, unsterblichen Gestalt des wandernden Komödiantenvaters Emanuel Striese zu erklären. Außer dem allerersten „Striese“ des zu jener Zeit in Berlin ungemein beliebten Komikers Emil Thomas mögen hier als spätere Darsteller dieser überaus dankbaren Rolle auf Wiener Bühnen beispielsweise Felix Schweighofer, Friedrich Mitterwurzer und Hugo Thimig genannt sein. Man erinnert sich ferner, daß vor zwei Jahren Otto Treßler zu seinem 55jährigen Burgtheaterjubiläum als Achtzigjähriger die tragende Rolle des Schmierendirektors studiert und diesen in einer Wiederaufführungsserie des Burgtheaters verkörpert hat. Auch bleibt es unvergessen, daß Albert Bassermann, der im vorigen Jahr verstorbene Nestor der deutschen Sprechbühne, auf seinen großen Gastspielfahrten häufig, so auch vor wenigen Jahren in den Wiener Kammerspielen, als Emanuel Striese aufgetreten ist.
Der bald nach der Uraufführung erkennbar gewordene außerordentliche Publikumserfolg des „Raub der Sabinerinnen“ hatte im November 1884 eine deutsche Zeitschrift veranlaßt, an die Autoren eine Anfrage nach der Entstehungsgeschichte ihrer gemeinsamen dramatischen Arbeit zu richten. Paul von Schönthan hat diese Anfrage durch die Mitteilung eines ein Jahr zuvor mit seinem Bruder geführten Briefwechsels beantwortet. Da dieser nun sowohl eine erstaunliche Gleichstimmung als auch die innige Freundschaft erkennen läßt, welche die Brüder Schönthan Zeit ihres Lebens verbunden hat,so möge dem jüngeren und früher verstorbenen Paul hier noch einmal Raum für den von ihm vor 70 Jahren so launig redigierten Briefwechsel gewährt werden.
Ja, mein Lieber, Du hattest recht, hier ist es gut sein. Ich finde hier in einem Tag mehr Ruhe als in Wien im ganzen Jahre, und doch: auch in diesem Glück fehlt auch der Schatten nicht. Und das hat die unselige, indiskrete Kurliste, die meine Gegenwart verriet, auf dem Gewissen. Gestern besuchte mich eine vornehme Dame aus Rumänien, die in Dresden lebt und — dichtet. Das andere kannst Du Dir denken. Sie hatte einen weißen Rembrandthut auf dem Kopf und ein blaues Manuskript unter dem Arm. Beides von überraschenden Dimensionen. Das Manuskript enthielt nach meiner ungefähren Schätzung einundeinhalb Kilo fünffüßige Jamben. „Der Raub der Sabinerinnen“ stand darüber in der schönsten Schnörkelschrift, veilchenblaue Tinte ... Unbegreiflicherweise war die Römertragödie vom Wiener Hofburgtheater zurückgewiesen worden und, da die Dichterin die Güte hatte, sich zu erinnern, daß ich am Wiener Stadttheater den Posten eines Regisseurs angenommen habe, empfahl sie mir ihr Schmerzenskind für unsere Bühne. Umsonst versuchte ich zu beteuern, daß das Stadttheater gar nicht der Boden für derlei sei, daß meine Belürwortung sich hier als total ohnmächtig erweisen werde. Sie wich keinen Fußbreit und entwaffnete mich zunächst durch den schrecklichen Einwand: „Haben Sie nicht auch ,Arria und Messalina' von Spielhagen gegeben?“ — „Von Wilbrandt“, korrigierte ich... „Ach ja, die beiden verwechsle ich immer, denn sehen Sie ...“ Und so ging es achtzehn Minuten lang weiter. Die etwas exzentrische Frau verwechselte alles. Endlich entfernte sie sich, nachdem sie mir das feierliche Versprechen erpreßt hatte, daß ich das Manuskript sofort lesen und ihr noch heute meine Ansicht darüber mitteilen werde.--Bis hierher hatte
ich geschrieben, noch immer in der glücklichen Meinung, daß es sich nur um eine vorübergehende Ruhestörung handeln werde. Aber soeben war die Dichterin wieder da. Diesmal bedeckte ihr Haupt ein blaues Federbarett. Sie introduzierte sich mit dem Ausruf: „Mein Manuskript!“ Niemand konnte schneller damit bei der Hand sein als ich. „Wissen Sie, was ich damit machen will?“ rief sie, und ehe ich noch meine Ahnungslosigkeit aussprechen konnte, wies sie mir eine Nummer der „Dresdner Nachrichten“ vor, in der die Rede von der noch immer nicht definitiv festgesetzten Eröffnungsvorstellung des Deutschen Theaters in Berlin war. Die aulgeregte Dame betrachtete die unschuldige Notiz als einen Wink vom Himmel und wälzte mir einen Stein von der Brust, indem sie ausrief: „Ich überlasse mein Stück dem Deutschen Theater — ich reise sofort nach Berlin!“ In einem Atem bat sie mich aber angesichts ihrer vollständigen Hilflosigkeit um Empfehlungen. — Diese Frau hat trotz allem eine Art, daß man ihr nicht gut etwas abschlagen kann. Wem soll ich sie aber aul den Hals hetzen, ohne ju befürchten, mich ewig mit ihm zu verfeinden? Das kann höchstens der Bruder dem Bruder verzeihen. Ich nannte ihr Deine Adresse. Sie wird Dich aufsuchen ... Es war ein Schritt der Verzweiflung. Am Ende ist sich jeder selbst der Nächste! Franz.
Berlin, den 11. August 1883.
... Frau von W. erschien heute in einem schottisch-bunten Ninichehut bei mir. Ich weiß nicht, wie sie darauf verfiel, mich für Wildenbruch anzusehen, der doch einen viel stärkeren Schnurrbart trägt und erfolgreiche Trauerspiele schreibt, während ich dramatisch unbescholten bin. Sit lobte mein „Harold um Harold“, womit sie vielleicht „Opfer um Opfer“ von Wildenbruch gemeint hat, und bat mich, sie zunächst mit L'Arronge, dem geleierten Theaterdirektor und genialen Dichter der „Bluthochzeit“, bekanntzumachen. Ich trachtete, Lindners Autorenrechte zu wahren. Jeder Einwand ging rettungslos unter im reißenden Strom der Rede. Ich versuchte, sie einzuschüchtern und ihr nahezulegen, wie gewagt es sei, mit einem Erstlingswerk vor das kritische Berliner Publikum zu treten. Das schien ihr einzuleuchten; gleichzeitig wollte sie sich erinnern, daß Gustav von Moser sein neues Stück „Die Pieilprobe“ — die Unglückliche meinte Blumenthals „Probe-pleil“ — in Warmbrunn probeaufführen ließ. „Bei Direktor Georgi“, bestätigte ich, aufgemuntert durch die Hoffnung, sie nach Warmbrunn reisen zu sehen. Sie erwog dann auch den Gedanken, sich dem Direktor Jacobi — „Georgi“, wandte ich schüchtern ein — vorzustehen, aber eine Dame könne das doch nicht betreiben. Sie bat mich daher, ihr wegen der Probeaufführung einen Rat zu geben, und mir fiel nichts anderes ein als der Hinwels auf Deine Unterstützung. Schickst Du mir Deine Dichterin, schicke ich Dir meine Dichterin. Sauve, qui peut! Paul.
Schandau, den 13. August 1883. Jetzt längt die Sache an, mir Spaß zu machen. Gestern mittag kam die Dichterin der Römertragödie mit einem schleierumwehten Reisehut wieder in Schandau an. Sie erwischte mich im Hausllur. Diese Frau besitzt eine Zähigkeit und Energie, die Berge versetzen könnte. Denke Dir, sie will jedes pekuniäre Opfer bringen, wenn eine Probeaufführung zu ermöglichen wäre. Und da fiel mir gerade ein, daß ich neulich bei einem größeren Ausflug drüben in O. einen Schmierendirektor mit acht unversorgten Mitgliedern angetroffen habe. Dem Manne kann geholfen werden! Heute nach der Table d'höte bin ich mit Frau von W. hinübergefahren und habe sie mit dem Direktor bekanntgemacht. Der vielgewanderte Mann begriff sofort die Situation und behandelte meinen Schützling mit dem Respekt, den ihre Opferbereitschaft verdient. Die Verhandlungen wurden im Gasthof, wo die Mimen das Hauptquartier aufgeschlagen haben, geführt, und als ich den armseligen Speisesaal verließ, saß sie schon am gedeckten Tisch, umgeben von den acht Mitgliedern, die sich sofort, angesichts der nahenden fetten Jahre, wie ein Mann Gänsebraten mit Gurkensalat bestellt hatten. Sie hatte das Manuskript aus der Tasche gezogen und begann, dem Direktor, der ihr mit einem unsäglich dummen, aber seligen Gesicht zuhörte, vorzulesen. Ich schlich mich durch den Garten davon. Die Frau Direktorin drückte mir beim Tor gerührt die Hand. O göttliche Dichtkunst, so tröstest du die Bedrückten, erquickest die Hungernden!... Franz.
Berlin, den 21. August 1883.
... Die Aufhebung der Entfernungen durch die Eisenbahnen ist ein Fluch. Frau von W. ist schon wieder in Berlin. Sie scheint wirklich von der Probeaufführung in O. etwas zu halten. Was begehrt diese Frau von mir? Ich soll den Generalintendanten von Hülsen zu bewegen suchen, hinüberzufahren! Der „Raub der Sabinerinnen“ soll in O. bereits lleißig probiert worden sein. Allein zum ersten Akt wurden zehn Proben mit Requisiten gehalten. Es ist dies nämlich der Akt, in welchem das Gastmahl beim König Titus Tatius vorkommt. Alles au! Kosten der Verfasserin! Vergeblich suchte ich die Abneigung Sr. Exzellenz des Herrn von Hülsen gegen das Reisen als eine unbezwingliche hinzustellen. Endlich ließ sie sich unseren Intendanten ausreden. „Dann müssen aber Wilbrandt und Laube dabei sein!“, drohte sie. Wenn ich sie recht verstanden habe, will sie den Titus Tatius dem Wilbrandt auf den Leib geschrieben haben! Wenn alle Weichen richtig gestellt sind, ist sie morgen ungefähr um neun Uhr abends wieder in Schandau, wo sie Dich dringend bitten will, Laube und Wilbrandt nach O. zu bringen. Sie hält dies für die notwendige Konsequenz Deiner Bemühungen um die Probeauflührung. Gott, was hat diese Frau heute wieder für einen Hut getragen! Paul.
Telegramm aus Schandau.
Emplange soeben Deinen Brief und sehe meine einzige Rettung in der Flucht. Benutze nächsten durchkommenden Kurierzug nach w“en. Franz.
Postkarte aus Wien. Sonnabend Irüh.
Soeben glücklich angekommen. In der Nacht habe ich einen guten Einfall gehabt. Diese ganze Geschichte mit Frau von W. und ihrer Römertragödie ist ja eigentlich ein süperber Lustspielst o I f. Ich setze mich morgen hin und sehe, was daraus zu machen ist. Franz.
Postkarte aus Berlin. Sonnabend Irüh.
Diese Rumänin mit ihrem „Raub der Sabin-nerinnen“ hat mich aul die Idee gebracht, ein lustiges Stück mit Bezug aul die komischen Ereignisse zu schreiben. Will dieser Tage an die Arbeit gehen Paul.
Telegramm. Berlin, Sonntag früh.
Unsere Karten haben sich gekreuzt, unsere Ideen begegnet. Ich lasse Dir das Vorrecht und trete zurück. Paul.
Telegramm. Wien, Sonntag abend.
Kein Gedanke; wir schreiben das Stück zusammen. Titel: „Der Raub der Sabinerinnen.'
Franz.
zierend. Noch spätabends gab es Kriegsspiel der Offiziere. Der Ausdruck „Spiel“ ist da fehl am Platze, es waren eigentlich recht unangenehme, fortgesetzte Prüfungen. Josefstadt hieß deshalb auch der „taktische Kurort“. Ueber all dies hinweg half aber die Jugend und — der Humor.
Und nun weiter, nach dem „fernen Osten“, nach Galizien. Nicht jeder konnte im altehrwürdigen Krakau oder im modernen, großstädtischen Lemberg zugeteilt sein. Bös war es in den kleinen Garnisonsorten, und kalt überlief es den Armen, der seine Einteilung dorthin erfuhr. So Czortkow an der russischen Grenze. Marschieren in Sand, Staub, Kot oder Schnee, sibirische Kälte. Sehr schwierig war die Ausbildung; denn bei der ruthenischen Mannschaft gab es über 50 Prozent Analphabeten; deutsch konnten kaum die Unteroffiziere. Und abends — abgesehen von der Offiziersmesse und einer östlichen Kaffeespelunke — nichts, aber schon gar nichts in jenen Stunden, in denen glücklichere Kameraden anderswo geistige Anregung in Theatern, Konzerten und Vorträgen finden konnten. Schon gar nicht durfte man daran denken, daß man jetzt im Offiziersstehparterre der Wiener Hofoper oder des Burgtheaters sein könnte — für bloß zehn Kreuzer Eintrittsgebühr.
Und nun nach dem Süden!
Ich möchte hier eine Episode schildern, die in ihrer ganz besonderen Eigenart weitab lag von jedem normalen Garnisonsleben.
In der herrlichen Bocche di Cattaro liegt in einer verträumten, stillen Meeresbucht R i s a n o. Oberhalb dieser malerisch gelegenen, einstigen Kompaniestation erblickt man die steil aufsteigenden Berge der Krivosije. Mehrere Bergspitzen in rund tausend Meter über dem Meere waren gekrönt von unseren kleinen Forts entlang der montenegrinischen Grenze. Ein Tag auf solcher einsamen Bergwacht? Ein steiler, spitzer, kahler Bergkegel. Darauf ein winziges Fort mit einem jungen Offizier, dreißig Mann und zwei Geschützen. Nur Befestigungen ringsum, keine Gehöfte. Hirtenvolk, armselige Steinhütten, wo sich an kalten Bora- und regnerischen Schirokkotagen — in einem einzigen Raum zusammengepfercht — Mensch und Tier um das offene Feuer lagern. Ein herrlicher Rundblick auf die blaue Adria von Ragusa bis tief nach Süden gegen Antivari. Tief unten an den von Wellen bespülten Ufern tropische Vegetation, Bäume unter der schweren Last der Orangen und Zitronen, Olivenhaine; höher hinauf immer mehr und mehr Karst, dann überhaupt im weiten Umkreis nur nacktes, scharfkantiges Gestein; oben, auf dem Plateau der Krivosije, etwas Laubwald und in den Dolinen einiger Bodenbau.
Strahlend steigt die Sonne und wirft ihre ersten Lichtgarben über die fernen Albaner Berge. Bald aber erfüllt eine Helle, wie sie nur der Süden kennt, auch die übrige, wilde Bergwelt, den Hang, das weite Meer.
Die Zugbrücke des Forts rasselt nieder und heraus tritt, von Wachhunden freudig umsprungen, ein Jagdgewehr über den Schultern, der Kommandant, der Leutnant, ungeachtet seiner jungen Jahre hier Repräsentant höchster Staatsgewalt. Blühende Jugend und volle Sorgenfreiheit lassen den Glücklichen noch nicht die Schattenseiten des Lebens sehen. Freiheit in der herrlichen Natur! Das ganze Jahr, das man hier oben verbringt, keinen Exerzierplatz! Der Hauptmann hat nur monatlich, der Bataillonskommandant nur vierteljährlich einmal hier zu inspizieren. Gottvoll! Trotzdem wird gewissenhaft der Wachdienst versehen, die Grenze abpatrouilliert, werden Wege angelegt, wird Unterricht gehalten. Jeder Mann stellt selbst nachts den Gewehraufsatz richtig für jede vermutliche Einbruchsstelle.
Den Schlangenweg herauf kommt eine alte Montenegrinerin. Lange vor Tagesanbruch verließ sie ihr Dorf, stieg bergab, bergauf, um hier endlich ihre dürftige Ware, ein paar Eier, eine Kanne Milch, magere Hühner, anzubringen. Sie erbittet für alles etwas Mehl, Reis, Salz, besonders Salz, das kostbare Gut, das ja dem ganzen Balkan fehlt.
Fern am Horizont taucht die Rauchwolke eines Schiffes auf. Der Zeit nach kann es nur der Eildampfer von Triest sein, der heute mittag in Cattaro einläuft. Er bringt auch zwei Kameraden, die zum Bataillon einrücken und auf dem Wege dorthin morgen hier oben eintreffen. Nirgends ist ein Gast so willkommen und gerne bewirtet als hier in der Einsamkeit. Also werden alle Schätze des Landes und des ganzen großen Reiches — alle direkt bezogen — aufgewartet: Schinken aus Prag, Speck aus Ungarn, Gurken aus Znaim, Butter und Käse aus Tirol, Bier aus Pilsen, Wein aus Lissa, Maraschinolikör aus Zara, Obst aus dem nahen Castelnuovo, Tabak aus Montenegro. Geld hat man ja hier oben — Kordongebühren! — und der Koffer birgt sogar ein für einen Leutnant seltenes Ding: ein Sparkassenbuch!
Es gibt auch Tafelmusik. Das Nachbarfort hat unter der Mannschaft böhmische Musikanten. Diese stecken in das Telephon einen großen papierenen Trichter, setzen sich vor diesen und musizieren — die Gäste hier nehmen die Hörer an die Ohren. Radio von Anno dazumal!
Am Spätnachmittag gibt es ein sich allwöchentlich wiederholendes Schauspiel: Unter den monotonen, langgezogenen Tönen der Guzla — einer einsaitigen Geige — bewegt sich eine bunte Karawane von 200 Tragtieren, vorne und rückwärts von berittenen österreichischen Finanzern begleitet, zur Grenze. Das lebensmittelarme Montenegro kauft seinen Bedarf an der österreichischen Küste und schafft nun alles nach Hause. Ein origineller Anblick, hohe, edelgewachsene Montenegriner, in malerischer Tracht, rauchend zu Pferde, daneben, schwer bepackt, zu Fuß: das Weib. Orient!
Nun noch das Marinefernrohr auf Cattaro gerichtet. Man sieht den schönen Korso, erkennt einzelne Personen und — hat man sie auch während des ganzen Tages nicht empfunden —, so fühlt man jetzt die Vereinsamung.
Ein halbes Jahrhundert ist seither vergangen. Viele ehemalige altösterreichische Garnisonen sind in ' Vergessenheit geraten und vieles aus dem militärischen Leben jener Zeit erscheint heute fast unwirklich, mehr Dichtung als tatsächliches Erlebnis.




































































































