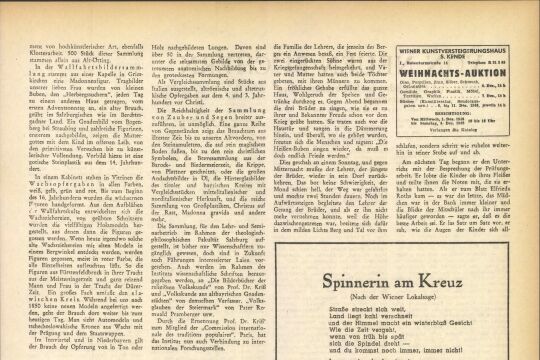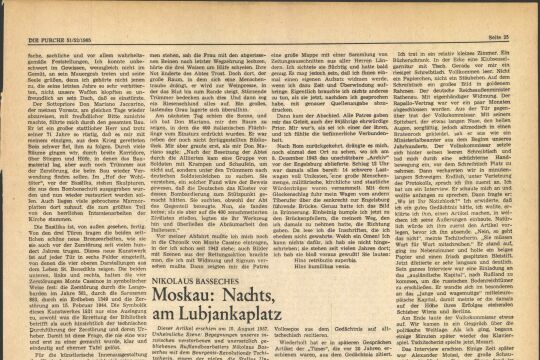„Die österreichische Furche" setzt im folgenden die Veröffentlichung der Erinnerungen ihres Herausgebers und Chefredakteurs Dr. Friedrich Funder fort. Der Verfasser erzählt seine Schulzeit in Löbfau und Dresden.
Nach dem vierten Jahrgang der Volksschule sollte ich — wie es der Vater wollte — das Gymnasialstudium beginnen. Doch der Klassenlehrer riet ab. In meiner Schulbildung sei einiges versäumt worden, mit so schwachen Kenntnissen in der Grammatik könne es nicht gewagt werden. Also noch ein Jahr Volksschule.
Da ich nun schon im elften Jahre stand, beschloß mein Vater, mich nebenher privat unterrichten zu lassen, damit ich mit überspringen der „Sexta“ die Aufnahmsprüfung in die „Quinta" machen und also den Zeitverlust wettmachen könne. Der Volksschullehrer Paul Pech wurde als mein Lehrmeister ausersehen. Der ehemalige katholische Theologiestudent war ein dünnes, etwas melancholisches Männchen, das den Eindruck machte, seinen Namen nicht umsonst zu tragen. In seinerį Wohnung empfing ich fortan dreimal wöchentlich Lateinstunden. Ich kann nicht sagen, daß das Verbum „amo, amas“ in der affirmativen oder in der Frageform meinerseits eine Bestätigung oder Bejahung gefunden hätte. Nein, ich liebte es samt seiner sprachlichen Sippe gar nicht. Es war eine ganz widerwärtige Behelligung. Zudem mangelte die Zeit dafür. Beide Eltern standen in der Waffelbäckerei in Arbeit, die Mutter, um für den einfachen Haushalt und die erhöhten Ausgaben für ihren Ältesten zu dem kleinen Gehalt des Vaters beizu- trageq. Und es war eine harte Arbeit, das Hantieren mit dem schweren, langarmigen Backeisen und der Schnitt der fertiggebackenen Waffel. Erst abends kamen sie heim. Inzwischen hatte ich daheim, wenn ich von der Schule zurückkam, neben dem jungen Dienstmädchen nach dem Rechten zu sehen. Zur Familie waren in dem letzten Jahr zwei Geschwister gestoßen, eine Schwester und ein Brüderl. Wenn mich auch zuweilen das Gewissen drückte, so fand ich schließlich das liebevolle Befassen mit den beiden passender, als mit der Grammatik und ihren nach damaliger Methode in Versen gefaßten Regeln.
Zu Ostern 1884 kam der kritische Tag meiner Aufnahmsprüfung für die Quinta (zum Unterschied von. der österreichischen Zählung, die das Anfangsjahr als „erste Klasse" bezeichnet, steigt in Deutschland die Bezeichnung von der Sexta bis zur Oberprima aufwärts) des städtischen Wettiner Gymnasiums. Ein ödes, unfreundlich anmutendes Gebäude, das als Waisenhaus abgedankt hatte und als provisorische Unterkunft für die jüngere, erst fünf Jahre alte Mittelschule diente, nahm mich auf. Zugleich mit mir harrten ein paar andere Altersgenossen ängstlichen Blickes dem nahenden Schicksal entgegen.
Es kam schlimm genug. Wenigstens für zwei von uns. Der prüfende Lehrer, der mir sofort einen gefährlichen Eindruck machte, zeigte sich über unsere Lateiparbeit entrüstet. Und gerade Latein war das erste, stundenreiche Hauptfach, das alle anderen an Bedeutung überragte. Zwar fanden wir gnadenweise Aufnahme, aber wir hatten — ich als der 41., mein Leideftsgenosse als der 42. Schüler der nach ihren Leistungen gereihten Klasse — auf der Bank vor dem Katheder unseren Platz einzunehmen. Diese Sperrsitze in der vordersten Reihe waren aus mehreren Gründen unangenehm. Mein Vater war unglücklich über meinen Mißerfolg, aber ich nicht so sehr. Als ich in den ersten Sommerferien zwei Wochen bei einem Landwirt in dem Dorfe Pennrich bei Dresden verbringen durfte, beneidete ich die Knechte, die im Sonnenbrand auf den Feldern das Getreide schnitten und nicht Latein zu lernen brauchten, noch dazu unter einem Lehrer, der keinen Spaß verstand.
Der Vater fragte mich, ob er mich in eine Lehre geben solle. Das sollte eine Drohung sein. Sie verfing nicht. Schlimmer als dies Gymnasium mit seinem furchterregenden Lehrer konnte es nicht werden.
Nach den ersten Ferien nahm ich einmal meine Zuflucht zu meinem gewesenen Lateinlehrer und bat ihn, mir in einer Hausaufgabe zu helfen. Das Ergebnis war verblüffend. Ein splitternacktes „Ungenügend". Der gute, liebe Pech hatte zu meinem Pech meinen eigenen lateinischen Sprachdefekten ein paar eigene Fehler bei der Anwendung des Ablativus absolutus hinzukorrigiert. Er war halt doch schon zu lange weg von seinem einstigen Latein.
Am 17. Oktober 1884 erfolgte in Anwesenheit des Königs Albert die Einweihung des in der Wettiner Straße gelegenen stattlichen Neubaus des Gymnasiums. In dem schmucken, neuen Klassenzimmer saß ich vorne, nahe der Türe. Eines Tages veranstaltete ich in der Pause ein „Schweineschlachten“. In eine weißlich-rosafarbene Wasserrübe wurden vier Hölzer als Füße und ganz kleine als Augen gesteckt und dann durfte jeder Teilnehmer an dem Schlachtfest mit seinem Taschenmesser der Reihe nach dem Opfer einen Hieb versetzen. Was er absäbelte, durfte er verzehren. Wir waren an meiner Bank mitten im Betrieb, als plötzlich Klassenlehrer Doktor Gustav Eichler, der Lateinprofessor mit der unheimlichen Stimme, unter der Türe erschien. Er stellte mich sofort als Veranstalter fest. Ich war bei ihm schon tief in der Kreide. Klassenarrest und eine lange Strafarbeit bildeten den Abschluß des fröhlich begonnenen Schlachtfestes.
Zu Weihnachten kam eine Mahnnote wegen schlechter Leistung an die Eltern. Der Vater hatte für mich eine schöne, fünfbändige Schiller-Ausgabe als Geschenk gekauft. Er zeigte sie mir, aber zur Strafe bekam ich sie nicht. Sie wurde an einem sicheren Ort eingesperrt. Aber es ist mir bald gelungen, in heimlichen Stunden sie wie der Prinz die weggezauberte Prinzessin aus ihrem Versteck hervorzuholen und bis zu ihrem letzten Blatt in geheimer Begeisterung zu lesen.
Dann kam noch ein Schlag. Die katholischen Feiertage wurden von den Eltern streng eingehalten. Die Eltern waren von Steiermark her gewohnt, den Tag des Landespatrons, des hl. Josef, am 19. März als gebotenen Feiertag zu begehen. Da die kleinen Kinder nicht alleingelassen werden konnten, mußten abwechselnd Vater, Mutter oder ich zu Hause bleiben. Zur katholischen Kirche war fast eine Stunde Weges. Diesmal war ich an der Reihe, bei den kleinen Geschwistern zu bleiben.
Als ich am nächsten Tag die schriftliche Entschuldigung meines Vaters brachte, erhob der Klassenlehrer Dr. Eichler Anstand. Die Sache schien ihm verdächtig, da ein anderer katholischer Schüler von dem angeblichen, in der Tat für Sachsen nicht bestehenden Feiertag nichts wußte. Auf die Frage, ob ich die Kirche besucht, bekannte ich wahrheitsgemäß den Sachverhalt. Also nicht in der Schule, aber auch nicht in der Kirche. Darum Eintragung ins Klassenbuch wegen ungenügend entschuldigter sechs Schulstunden. Strafarbeit und eine schlechte Sitten- und eine noch schlechtere Fleißnote ins Zeugnis. Das war schlimm, denn mit dieser Note verlor ich auch die entfernteste Anhoffnung auf die Ermäßigung des Schulgeldes. Als österreichischer Staatsbürger hatte der Vater das doppelte Schulgeld zu bezahlen, eine Ausgabe, die ein Zwölftel seines Monatseinkommens verschlang.
Die schlechten Noten in Sitten und Fleiß beschatteten mich nun wie eine finstere Wolke. Die Blitze sammelten sich, sobald es in der Klasse schwül wurde, auf meinem Haupte. Um mich herum spürte ich Geringschätzung und Mißtrauen. Ich biß die Zähne zusammen und konnte die Aufnahme in die Quarta erreichen als der 25. Schüler im Klassen-- rang.
Der Vater hatte dabei mitgeholfen. Täglich sperrte er mich in seiner Kanzlei, die sich in dem Werkhaus unter den Fenstern unserer Wohnung befand, ein. Dort hatte ich nach der Schule meine Arbeiten zu machen. Abends nach Arbeitsschluß prüfte mich der Vater auf das Gelernte. Da war es mit ihm nicht gut Kirschen essen. Zu meinem Trost machte ich eine Entdeckung in der an die Kanzlei anschließenden Kammer. Einige große Kisten waren mit Bonbonsmustern verschiedenster Art gefüllt. Meine Annahme war, daß sie in diesem halbdunklen Raume vergessen worden waren. Sobald ich allein war, nahm ich mich dieser netten Erzeugnisse an und stopfte mir die Taschen voll. Ich fand, daß sie während eines trockenen Pensums eine bekömmliche Abwechslung boten. Beim Abendessen hatte ich dann zuweilen wenig Appetit. Die gute Mutter sagte mitleidig: „Der Bub ißt vor lauter Schulsorgen schon gar nichts mehrl“
Dieser Zustand hielt wochenlang an, bis eines Tages die Lage mehr als brenzlich wurde, als es Vater plötzlich in den Sinn kam, nach Bonbonsmustem in den Kisten zu forschen. Fortan saß ich zwischen zwei verschlossenen Türen.
Der Vater gab in jenen schlimmen Zeiten die Hoffnungen für mein Studium nicht auf. Er nahm noch ein neues, schweres Geldopfer auf sich. Während der Semesterferien in der Quarta ließ er mir von einem Probelehrer des Gymnasiums für ein ansehnliches Honorar Privatstunden in Latein geben.
Nun kam ich in diesem wichtigsten Lehrgegenstand doch auf die Füße. Die Aufgabenzensuren gerieten in die Zone der Note 3a, „gut—genügend". Der kleine erreichte Fortschritt ermunterte mich. In den sogenannten Kartoffelferien, die uns um Michaeli 14 Tage schulfrei gaben, stürzte ich mich, von der Klausur in der väterlichen Kanzlei befreit, auf das Latein, wie ein zu allem entschlossener Krieger auf den Feind. Verbissen kämpfte ich mit Grammatik und unregelmäßigen Verben täglich von früh bis spät. Einige Tage nach Wiederbeginn des Unterrichts gab es eine Schularbeit. Als einer der ersten war ich fertig.
Als Klassenlehrer Dr. Eichler in der nächsten Woche die korrigierten Hefte verteilte, begann er: „Zu meiner Überraschung hat diesmal Funder eine der besten Arbeiten geliefert." Unter der Arbeit stand mit roter Tinte „1“ („Sehr gut"). Von da an wich ich nicht mehr zurück. Die Erfolge mehrten und festigten sich. Um Ostern 1886, beim Aufstieg in die Untertertia, die vierte Gymnasialklasse, war aus dem früheren Schüler auf dem vorletzten Platz der 17. von 41, im folgenden September zu Michaelis der 12. geworden.
Der gestrenge Klassenlehrer, einst der Schrecken meiner Tage und der Angst-
träum meiner Nächte, war wie verwandelt. Sein Lob ermunterte, sein Wohlwollen machte froh. Unvermerkt wurde man ihm anhänglich mit der Hingabe der Jugend an einen geliebten Freund.
Als ich am 31. März 1887 vom Wettiner Gymnasium schied, mit einem Abgangszeugnis für die Obertertia, hatte ich nach österreichischer Praxis ein Vorzugszeugnis und war der 8. unter 41 im Klassenrang. Der Rektor Prof. Dr. Meltzer, der als Neuherausgeber des zu hunderttausenden verbreiteten, geschichtlichen Handbuches Plötz damals im ganzen deutschen Sprachgebiet bekannt war, schrieb außerhalb der Norm eigenhändig in das Zeugnis: „Wir entlassen diesen wohlgesitteten und fleißigen Schüler mit den besten Wünschen für seine fernere Zukunft.“
Um der Wahrheit zu entsprechen, hätte bei diesem Vermerk dabeistehen müssen, wieviel den trefflichen Lehrern dieses Gymnasiums zuzuschreiben war. Ihre Erziehung war streng und darauf gerichtet, aufrechte, wahrheitsliebende, fleißige Menschen heranzubilden. Man verlangte Offenheit und Disziplin, gab uns am ehesten straffrei, wenn wir eine Missetat tapfer und ohne Zögern bekannten, und stählte im Lehrzimmer, wie auf dem Turn- und Spielplatz durch Unnachsicht- l'chen Anspruch auf unsere Leistung un-
seren Körper und unseren Willen. Das Wort des Dichters „Mein Sohn, sei immer treu und wahr, du bist ein deutsches Kindl“ wurde in dieser Erziehung mit Leben erfüllt. Anzeiger verfielen der „Klassenschande“ und wurden außerhalb der Anstalt verprügelt. Jeden Montag vor Unterricht vereinigten sich alle Lehrer und Schüler unter Vorsitz des Rektors in der Aula zu einem gemeinsamen kurzen Gebet und einer Ansprache. Das Deutschlandlied pflegte diese Versammlungen und jeden Festakt zu beschließen. Es war in allem eine christliche Grundhaltung in der Erziehungsarbeit dieses Gymnasiums, dessen Lehrer und Schüler fast alle Protestanten waren. Nur einer, Dr. Ludwig Poland, der Lehrer für deutsche Sprache, war Katholik. Als ich einmal in der Quarta eine Tierfabel verfaßt hatte, in der ich mir die Erzählerart des Alemannen Johann Peter Hebel zum Vorbild genommen hatte — ich kannte meinen Hebel halb auswendig —, verlas Dr. Poland vor der Klasse die Arbeit und fügte lächelnd an: „Das hört sich an, als ob der Funder einmal Journalist werden würde.“
Wir wenigen katholischen Schüler hatten den in der Schulordnung vorgeschriebenen Besuch des Religionsunterrichts durch ein Zeugnis des Pfarramtes der katholischen Hofkirche nachzuweisen. Der gute, alte Pfarrer Bude, der in meiner Quintanerzeit als Katechet zweimal wöchentlich acht bis zehn Mittelschüler um sich zu diesem Religionsunterricht versammelte, hat mit mir sicherlich keine Freude gehabt. Er schrieb mir zu Ostern 1885 die Note „3b" ins Zeugnis, also „minus Genügend“. Schlechter hätte sie kaum mehr sein können. In den folgenden zwei Schuljahren besserten sich Eifer und Erfolg. Zu Schulschluß der Untertertia hatte ich mir zu Ostern 1887 durch ein 1b in Religion die Note „fast Sehr gut“ erworben.
Aus der Hand des Bischofs von Meissen, Dr. Schäfer, habe ich am 2. Mai 1885 glückselig die erste hl. Kommunion und durch denselben edlen Hirten ein Vierteljahr darauf die Firmung empfangen.
Ich war voll himmelstürmender Vorsätze.
Die Eltern hatten schon lange den Plan gefaßt, in die steirische Heimat zurückzukehren. Gegen Ende 1886 begannen sie mit ernsten Vorbereitungen. Käufer für den schönen, alten Hausrat, Vaters Stolz, wurden ermittelt, die Spargroschen behoben, allerlei Spezialwerkzeug für Waffelbäckerei eingekauft. Für die Übersiedlung wurden auch in Graz Vorbereitungen eingeleitet. Auch für mich wurde vorgesorgt. Da es der sehnlichste Wunsch meiner Mutter war, mich einmal als Priester zu sehen, dieser Wunsch auch vom Vater gebilligt und von meiner jugendlichen Phantasie unterstützt wurde, war meine Aufnahme in das Grazer fürstbischöfliche Knabenseminar eingeleitet worden. Der Ordinarius der Nachbardiözese, Fürstbischof Dr. Peter Funder in Klagenfurt, entstammte derselben Familie meiner Kärntner Vorfahren. Des Fürstbischofs Fürwort bei seinem Oberkämtner Landsmann, dem Direktor des Grazer Knabenseminars, Dr. Joseph Kahn, seinem späteren Nachfolger auf dem Gurker Bischofssitz, eröffnete mit Erfolg die Verhandlungen.
An einem sonnigen Apriltag 1887 trug der Zug unsere fünfköpfige Familie und ihr bescheidenes Gepäck zum Dresdner Bahnhof hinaus. Hinter mir lag der Abschied von meinen Lehrern und den Schülern des Wettiner Gymnasiums, ein Abschied zwischen Lachen und Tränen. Drei Kameraden, die „offiziell“ im Namen der Mitschüler gekommen waren, hatten vom Bahnsteig noch die letzten Grüße nachgewinkt. Drüben, weit hinter dem Erzgebirge, wartete in der Feme die steirische Heimat. Der Elbe entlang, vorüber an den Steintürmen der Sächsischen Schweiz, pustete der Zug den böhmischen Ebenen zu. Ein langer Tag. Ein blanker Mond warf seine Lichter auf die Gewässer der Wittingauer Seenplatte, als ich in meiner Ecke einschlief…
Nebelschleier hoben sich über Wien. Aus dem Morgengrau stiegen die Türme der Stadt und weiß mit blinkenden Fenstern die Bauten auf dem Kahlen- und Leopoldsberg. über der Donau quirlte Rauch aus den Essen großer Dämpfer, als der Zug über die Brücke dem Nordbahnhof zurasselte. Es war alles wie ein Märchen mit Schlössern und Prinzen, dieser Gang zu Fuß durdi die in der frühenSonne prangende Stadt, die noch eine Kaiserstadt war. Am Tegetthoff-Denkmal vorbei — o ich kenne die Geschichte von Lissa — und da steigt schon im rosigen Schimmer des frühen Tages das silbergraue Wunder des Stephansturms über der Praterstraße empor. Ehrfürchtige Andacht im Dome, freundliche Menschen, die uns weisen und eine weiche, anheimelnde Sprache reden, am Graben oben an den Fenstern stattlicher hoher Häuser Kammermädchen in weißen Häubchen, die — na, in Dresden hätte es dafür Polizeistrafe gegeben — die Betten an der Sonne lüfteten. Mich umfing hier ein neues, undefinierbares Etwas, das gemütlich, heiter und behäbig-vornehm war. Das Staunen wuchs mit jedem Schritt über den Kohlmarkt und durch die Burg zum Ring, von dem her eben ein Zug kaiserlicher Gardisten, den wehenden Roßschweif um den Helm, hellebardenbewehrt, hallenden Schrittes über den Heldenplatz zog.
Das erste Erlebnis der alten Kaiserstadt ist mir bis ins Alter nicht verblaßt. Dieses Wien war wie das gedankenvolle Lächeln einer schönen, graziösen Frau …
Die Fahrt über den Semmering in dem billigen „gemischten Zug“, in dem Personen- und zahllose Lastwagen zusammengekoppelt waren, wollte kein Ende nehmen. Der Semmering war eine Enttäuschung, da die von mir hier schon erwarteten blauen Sterne des Enzians nichtzu sehen waren. Nach einem Erholungstag bei einer befreundeten Familie in dem Mürztaler Markte Kindberg trafen wir in der steirischen Hauptstadt ein. In dem alten Funder-Haus in der Jungferngasse, das dem7 älteren Bruder meines Vaters, Ernst Funder, gehörte, fand ich für einige Tage freundliche Aufnahme. In der Stadt wurde ich des Schauens nicht müde. Die stattlichen Patrizierhäuser, darüber der Schloßberg mit seinem sonderbaren Uhrturm, dessen Ziffernblatt wie das Auge eines riesigen Wächters in das Land hinaussah, die efeuumsponnenen Bastionen, die alten Kirchen — wie war das alles anders als in dem sächsischen Fabriksdorfl In mir sang und klang der Preis Hämmerlings: „Sei mir gegrüßt, Du schöne, Du reizende Grazienstadt, Du ruhst wie ein prangender Falter auf einem Lorbeerblatt.“
Schon nach wenigen Tagen durfte ich in das Knabenseminar in der Vorstadt „Am Graben“ einziehen. Ade, ihr Eltern und Geschwister und du, Studentenmütze in den Farben Schwarz und Gold des sächsisch-königlichen Hauses der Wettiner, die ich stolz getragen. Der Schwierigkeiten und bitteren Sorgen, welche die Eltern zu überwinden hatten, um mit ihren geringen Mitteln ein neues Heim zu gründen und eine Waffelerzeugung einzurichten, bin ich nur aus Entfernung gewahr geworden.
Ich war in eine andere Welt versetzt. Sie war in allem fremd. Aber sie zeigte sich freundlich. Die neuen Vorgesetzten, diese geistlichen Herren, die alle in langen schwarzen Talaren einhergingen, interessierten sich für den Schülert derwohlempfohlen aus Deutschland kam. Er erregte ihre Neugier. Der neue, fünfzehnjährige Zögling, dessen sächsischer Dialekt die Herren verstohlen lächeln machte, gebrauchte auch im Lateinischen und im Griechischen eine andere Aussprache. Alles in allem zeigte sich aber an dem fremden Vogel der Erweis eines ganz anderen Schulsystems, eine sattelfeste Vorgeschrittenheit in den Sprachen, die richtige Hochzüchtung der alten, humanistischen Tradition der damaligen Gymnasien in Deutschland. Die Kehrseite offenbarte sich in den Realfächern: ein himmelweiter Rückstand, zumal in Mathematik. Von Arithmetik hatte der für die Obertertia ausgezeichnet Qualifizierte nur entfernte Vorstellungen. Vergeblich plagte sich Dr. Lampel, der große Mathematiker '’es fürstbischöflichen Gymnasiums, in seinen freien Stunden, dem Jungen das Mitkommen zu ermöglichen. Es war umsonst. Sein großer Vorsprung in den Sprachen nützte nichts. Er mußte in die dritte Klasse zurück. Keiner der ineuen Lehrer wollte sie, aber die Demütigung war bitter und unvermeidlich. Das Seminaristenvolk rundum verhehlte den Eindruck, den der neue Kamerad aus Sachsen machte, natürlich weniger als die Vorgesetzten. Sein Dialekt rief unter dieser Jugend, die fast durchaus bäuerlicher Herkunft war und verschwenderisch freigebig von ihren verschiedenen Landschaftsdialekten Gebrauchmachten, Lachkrämpfe hervor. Er konnte nicht alle in Faustkämpfen besiegen, obwohl dafür in dem schönen, großen Institutsgarten reichlich Gelegenheit war. Deshalb bemühte sich der Sachse eiligst, ein Steirer zu werden. Die sprachliche Mischung, die dabei in den ersten Monaten herauskam, wirkte auf die Umgebung noch erheiternder. Die Plage mit dem Steirischen war für ihn größer als mit der Sprache Herodots oder des Tacitus.
Nicht nur das Lehrsystem, auch die Erziehungsweise wich von der bisherigen ab. Man merkte es zumal in der Turnstunde. Der Vergleich hat mich in kommenden Jahren oft beschäftigt. Die österreichische Jugenderziehung gab damals weniger auf körperlichen Drill, die Heranbildung zu Wissen und Geschmack war die dominierende Aufgabe. Die Leistungen nach der kulturellen Seite hin waren im ganzen genommen größer, aber die gewisse Weichheit, die gerade für die Erziehung der gebildeten Jugend charakteristisch war, hat Schaden gebracht und auch die seelischen Energien nachteilig gestreift. Man hat später die gegenteiligen Extreme mit noch größerem Schaden erlebt.
Die religiösen Übungen des Seminars, das den jungen Priesternachwuchs der Diözese vorzubereiten hatte, waren frei von pietistischen Übertriebenheiten. Selbst ein so räudiges Schäflein, wie ich es war, fand den Übergang aus dem protestantischen Milieu nicht schwer. Die ersten geistlichen Exerzitien kamen über mich wie der Adler über Ganymed.