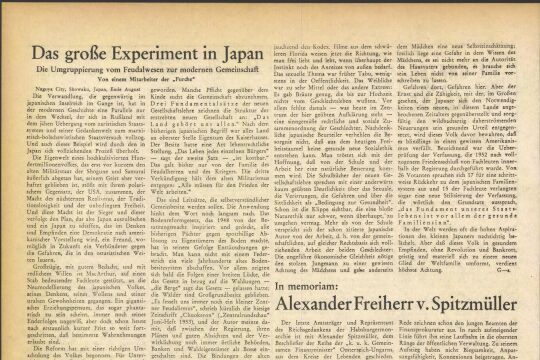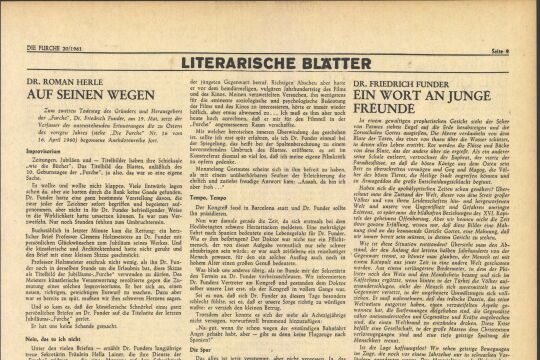Dieser Artikel erschien zum sechzigjährigen Berufsjubiläum Dr. Friedrich Funders im Haus Herold am 9. Mai 1956. Er erschien anonym, heute darf der Name seines Verfassers, der inzwischen gestorben ist, verraten werden: Otto Forst de Battaglia. Eine brilionte Feder schrieb über eine brillante Feder, ein Polyhistor über einen leidenschaftlichen Journalisten und bekenntnisfrohen Österreicher.
Irgendwo unter den zahllosen geistreichen Formeln, mit denen die Franzosen alles und nichts, viel und wenig zu sagen verstehen, findet sich auch die von der Literatur als der durch dais Prisma eines Temperaments besehenen Wirklichkeit. Friedrich Funder — ein Schriftsteller von der Kraft eines Görres und Veuillot, doch beileibe kein Literat — ließe sich, in seiner eindrucksamen Mannigfalt und in sedner monumentalen Wesenseinheit, vielleicht am besten als ein Temperament definieren, das, durch das Prisma seiner Ideenwelt mit besonderer Sehschärfe begabt, auf die Wirklichkeit blickt. Doch da zaudere ich. Sollte man ihn nicht eher ein Temperament heißen, das durch das Prisma der betrachteten Wirklichkeit sehnsüchtig, hoffend, mitgestaltend, wenn es sein muß, seines momentanen Scheiterns bewußt, nach den ihm als leitende Sterne am Horizont funkelnden großen Ideen Ausschau hält?
Ein wandelndes Temperament, ein streitbarer und doch im Herzensgrunde friedfertiger, den Frieden erstrebender Mensch, ein nie sich wandelndes und dennoch stets sich erneuerndes Temperament, das war, das ist und das wird für immer der Mann sein, der seit 60 Jahren als Mahner und Wegeweiser, als Werber und Wegweiser, als — durch eine im Eifer sengende Jugend und eine auf der Schaffenshöhe erstrahlende Wirksamkeit auf vorderstem Platz an der Sonne — geläuterter, abgeklärter Weiser, der berufenste Sachwalter des aus christlicher Uberlieferung sein Da-seinsrecht herleitenden Österreichs unaustilgbare Leistungen in Politik, Publizistik und im gesamten Kulturleben vollbracht hat. Eine so starke Persönlichkeit ist nicht mit dem Ehrendiplom eines Musterknaben in der journalistischen Sonntagsschule zu versehen. Oder — um mit dem unsterblichen Wippohen zu reden —, auch Achilles schlief auf einer von Homer besungenen Ferse. Die bedingungslose Treue zu sich selbst und zu den ihm heiligen Prinzipien hat bei Funder eine gewisse Hartnäckigkeit sowohl zur Voraussetzung als auch zur Folge; derlei ist, im Entscheidenden, von Charakterfestigkeit und von Konsequenz des Verhaltens unzertrennlich. Im Kleinen bekundet es sich mitunter am Beharren bei Urteilen und sogar bei Vorurteilen, ja bei formalen Irrtümern. Ich erinnere mich — lang ist es her —, wie unmöglich es war, in der „Reichspost“ die richtige Schreibweise des
Namens des heute außerhalb Frankreichs vergessenen Hochstaplers Stavisky durchzudrücken. „D'une plume rageuse“, mit einer zornigen Feder korrigierte Funder, der als Ohefredakteur sich um alles kümmerte, das Wort immer wieder in Stawinsy um. Assoziation mit Strawinsky mag dabei mitgespielt haben. Oder — um Belangreicheres zu erwähnen: Wieviel Wasser mußte in die Donau rinnen, bis sich der hervorragendste politische Schriftsteller, den Österreich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gezeitigt hatte, mit dem Phänomen des größten Sprachgewaltigen und Satirikers Karl Kraus versöhnte. Gerade in diesem Falle aber macht die Einsicht, die Funder gegenüber sich selbst bezeigte, seinem Kopf und seinem Herzen Ehre. In derselben „Reichspost“, die von der „Fackel“ mit unbilligem Hohn überschüttet worden war, hat der unvergeßliche Oberst Adam, ein als Stilkünstler nicht gewürdigtes großes Talent und ein ebenso großer Charakter, dem toten Karl Kraus den ersten dessen würdigen Nachruf veröffentlicht, und in der „Furche“ haben Bekenntnisse zum Werk des Autors der „Letzten Tage der Menschheit“ stets einen freien Spielraum.
Nur Lumpen werden einer Uberzeugung untreu, nur Dummköpfe verwechseln Überzeugung mit Ansicht. Funder, dessen Überzeugung tief im Glauben wurzelt — in dem an die Lehre seiner Kirche und im andern an die herrliche Sendung seiner Heimat —, ist, wie wir schon betonten, niemals starr auf eine Ansicht festgelegt gewesen. Er gab diese Ansicht nicht gerne, nicht leichthin und nicht schnell preis, zögerte indessen keinen Augenblick, sie zu ändern, sobald er von ihrer Irrigkeit oder auch nur ihrer Unzeitgemäßheit, ihrer Anwendbarkeit durchdrungen wurde. So ist er, den die Sozialisten einst als schärfsten Gegner erkannt, gehaßt, doch auch schon geachtet hatten, zum eindringlichen Verteidiger des heutigen Zweiparteiensystems in Österreich geworden, ohne dabei das leiseste seiner weltanschaulichen Meinungen zu opfern, ohne sich Illusionen zu machen und — ohne aus seiner weithin Nachhall auslösenden Fürsprache den geringsten persönlichen Vorteil zu ziehen.
Das gehört ja zu den schätzbarsten Eigenschaften dieses Unbestechlichen, daß er, im Zeichen des unheiligen Proporzes wie früher in der Ära des Hinaufgehens und Sichrichtens, nie darum bemüht war, sich Amt und Rang, Pfründen oder Auszeichnungen zu sichern. Sie strömten ihm auch so zu, und er nahm sie hin, ohne Gleichgültigkeit zu heucheln und mit unverhohlenem Vergnügen — die Auszeichnungen nämlich; er verschmähte die Pfründen, die ihn irgendwie gebunden oder den Mund, die federführende Hand gebunden hätten. Er hätte vermutlich freudig das hohe Amt ausgeübt, das ihm zugedacht war, hätte Erzherzog Franz Ferdinand, der Tote von Sarajewo, den Thron bestiegen. Er benutzte seinen Sitz im Staatsrat unter Schuschnigg, um auf die politische Entwicklung Einfluß geltend zu machen. Doch es waren nicht die Titel, die formelle Kompetenz, die ihn verlockten. Er war ja gewohnt und er liebte es, hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen, zu raten, zu beraten und endlich zu erraten, was für Österreich das Beste wäre.
Erstmals sind mir die Spuren der Rolle, die Funder gespielt hat, vor nun beinahe 50 Jahren begegnet, als ich im Belvedere bei einer damals sehr wichtigen Persönlichkeit zu Besuch weilte. Dieser Vertraute des Erzherzog-Thronfolgers wurde für einen Augenblick aus seinem Arbeitszimmer gerufen, und wie von selbst — ohne daß ich indiskret sein wollte — fielen meine Augen auf einen kleinen Zettel, der unterhalb des Telephons hing und der die Namen der jederzeit Anzurufenden enthielt. Es waren ihrer einundzwanzig, darunter: Friedrich Funder... Ein zweites Mal, als eben Seipels Walten den Höhepunkt erreicht hatte, saß ich in Paris dem eigentlichen Leiter des Quai d'Orsay, Philippe Berthelot, gegenüber, der nicht ohne Grund den Ruf hatte, dem alten Österreich nicht sehr freundlich gesinnt gewesen zu sein. Es war eine zweistündige Aussprache, oben in dem unzugänglichen vierten (oder war es das fünfte?)
Stockwerk des französischen Außenministeriums. Berthelot, offenbar sehr gut — und deshalb teilweise sehr schlecht — über die Situation in Wien unterrichtet, fragte mich immer wieder über Dinge aus, die er angeblich auf dem normalen Wege nicht abklären konnte. Zuletzt wollte er etwas an „Mon-seigneur Seipel“ weiterleiten lassen... Er sah
— gewissermaßen in stummem Selbstgespräch
— durch die Fenster hinweg in die Weite. Plötzlich beendete er seinen inneren Monolog: „Es gibt nur zwei Menschen, die ihm (Seipel) das beibringen können: Kunwald und Funder. Oui, le docteur Funder, ga vaut mieux.“ Ich habe mich davor gehütet, dem damaligen Herausgeber der „Reichspost“ die Anregungen Berthelots nur zu erzählen; warum, das gehört auf ein anderes Blatt. Doch als Zeugnis dafür, wie sehr auch in Paris die einzigartige Stellung Funders gewürdigt wurde, sei diese Episode in Erinnerung gerufen. Das schicksalhafte Eingreifen des tapferen, in jenen Tagen schon Sechzigjährigen beim Juliputsch 1934 ist bekannt. Und es bedarf keiner umfänglichen Beweise, seine wichtige Mitwirkung beim Wiederaufbau eines unabhängigen Österreichs als wesentlich darzutun.
Daß er in diesem Lande des Ausgleichs — in doppeltem Verstand (und mitunter in verwickeltem Unverstand) einem Land der Mitte
— so vielfältig und so häufig ein nachhallendes Wort zu sagen hatte; wir erklären es uns vor allem durch die Macht und den hypnotisierenden Zauber, den seine — war es geboten — stahlharte Unbeugsamkeit auf die zu einer gallertartigen, schleimigen Masse gar leicht verschmelzenden Verbindlich-Unverbindlichen rings umher ausübte. Kraft dieser Eigenständigkeit war er dem verewigten Erzherzog Franz Ferdinand artverwandt; man lese den Nachruf, den Karl Kraus auf den nie zum Zug gelangten providentiellen Erneuerer der Habsburgermonarchie verfaßt hat, um zu erfühlen, wie sehr der eine, der im andern den ihm seelisch Nahen erspürte, wie sehr der Thronerbe und der zum leitenden Staatsmann geborene bedeutende Publizist jeder ein Fortinbras war, der nicht etwa am Schluß der Haupt- und Staatsaktion als Retter erscheinen kann, sondern dem, hier die stupiden Kugeln zweier Wahnwitziger, dort das Gewirre der in Hamletposen umherstolzierenden Gemeindehofleute, armen Yor-ricks — also politischer Schalksnarren — und vor allem der Totengräber des Völkerstaats eine fruchtbare kontinuierliche Tätigkeit an verantwortlicher Stelle vielleicht verwehrt hätten.
So ist Friedrich Funder das geblieben, was er zwar von Gottes Gnaden war, der Meister des kritischen und des aufmunternden Wortes, der bekämpfte, was im Staate faul oder was zu dessen Untergraben zu fleißig war, doch es war ihm nicht beschieden, sich am Steuerruder dieses Staates zu bewähren. Welche Gaben hätte er dafür besessen! Zunächst die Zähigkeit, mit der er auf Ruinen sofort wieder aufzubauen verstand; ungebrochen durch frühere Enttäuschung, unerschrocken vor sich auftürmenden Schwierigkeiten. Dreimal hat er angefangen. Als junger Redakteur, der aus der, von den reichen liberalen Zeitungsmagnaten, den vermeintlichen Monopolerzeugern der öffentlichen Meinung, mit überheblicher Verachtung behandelten „Reichspost“ das weithin gehörte Sprachrohr der maßgebendsten Kreise der Donaumonarchie machte. Sodann, nach deren Zusammenbruch, als der überzeugte Monarchist und Verfechter der geschichtlich und geographisch unterbauten Zusammengehörigkeit der Völker des töricht zerstörten Reiches, im verkleinerten neuen, republikanischen Österreich dessen Sonderdasein verteidigte und ihm, zeitweise mit der passenden diplomatischen Zurückhaltung, die Aufgabe eines Piemont zudachte, das die Sukzessionsstaaten föderativ wieder zusammenfassen sollte. Ein drittes Mal, 1945, nachdem sieben Jahre vorher der Anschluß den politischen Konzeptionen Funders ein Ende bereitet zu haben schien, stand er inmitten von Schutt und Jammer dem Nichts gegenüber. Doch der Unermüdliche, der die Jahre des Psalmisten überschritten hatte, verband nun die Erfahrungen aus der sterbenden Habsburger-monarohie und aus der Epoche des nie ganz an seine eigene Lebensfähigkeit glaubenden Rumpfösterreich der Zwischenkrdegszeit mit dem Willen, nun erst recht die Selbständigkeit seiner Heimat und die bedeutsame Mission dieses Landes in einer leidgeprüften, nach Glück und Ruhe verlangenden Welt zu predigen. Nicht nur sie zu predigen, sondern auch ein unabhängiges, friedliches, arbeitsfrohes Österreich als den gegebenen Mittler, als die natürliche Brücke zwischen voneinander verschiedenen Staatengruppen zu zeigen. Im Innern aber wurde der einstige Rufer im Parteienstreit zum Herold der Verständigung, die auf politischem Verstand, und auf menschlichem Verstehen gründet. Doch das hat in nichts die Unnadh-giebigkeit Funders auf dem Gebiet beeinträchtigt, das von sonst sehr kampflustigen Parteileuten mitunter als geeignetstes Terrain für Zugeständnisse betrachtet wird, auf dem der sittlichen und erzieherischen Forderungen der Kirche, der christlichen Lebensauffassung. Beides, die Konzessionsbereitschaft im rein Politischen, die Festigkeit in allem, das von der religiösen Weltanschauung bedingt wird, hat dem greisen Friedrich Funder gleichermaßen die nun einmütige Achtung und sehr oft die Liebe nicht nur seiner Gesinnungsverwandten, sondern auch die der heftigsten Gegner errungen. Der noch heute funkensprühende, unerhört lebensvolle Greis, den vor Jahrzehnten politische Widersacher mit den ausgesuchtesten Schimpfworten traktierten, hat keine Feinde mehr. Er ist als ein kostbarer Besitz Gesamtösterreichs, als ein verehrungswürdiges Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft erkannt und anerkannt.
Mag dies weithin der Einsicht der durch Schaden klüger gewordenen Mitbürger zuzuschreiben sein, Ursache für diesen späten Triumph einer gar nicht kompromißlerischen, einer eher stacheligen Kämpfernatur sehen wir vordringlich in der Magie, die von Funders Persönlichkeit ausgeht. Ich habe ihn noch aus den Jahren im Gedächtnis, als er im alten Bau der „Reichspost“ im gar schlichten Zimmer des Ohefredakteurs, man mußte schon damals sagen, thronte. Da kam er einem entgegen, den Kopf leicht vorgestreckt, einem grimmen Stier nicht unähnlich, der mit — bei ihm unsichtbaren — Hörnern sofort zum Stoß parat ist. Hinter den Brillengläsern, oder über sie hinweg, schauten forschend
Sehr geehrte Redaktion!
Als ich kürzlich an einem Zeitungskiosk „Die Furche“ verlangte, waren dies vor allem zwei Gründe, die mich dazu bewogen: Motiv Nr. 1 war, daß es sich bei dieser Nummer um eine Jubiläumsausgabe handelte und ich, als Student der Zeitungwissenschaft, einiges für mich — aus rein fachlichen Erwägungen — wissenswertes, wertvolles Informationsmaterial darin erwartete. Der andere Grund war der — jetzt schäme ich mich fast, es einzugestehen —, daß ich bisher überhaupt noch nie ein Exemplar der „Furche“ in Händen hatte. Es mag etwas übertrieben klingen, wenn ich meine bisher „gehabte Meinung“ über die „Furche“ grundlegend geändert habe (ich hatte diese Meinung, obgleich ich sie nicht kannte!) und mein nunmehr rigoros gewandeltes Verhältnis zur furche“ in die vielleicht etwas gewagt anmutende Formel, ähnlich der paulinischen Wandlung eines D. Hyde: „Anders als ich glaubte“ kleiden möchte.
Nicht zu Unrecht werden Sie nun von mir wissen wollen, welches denn meine Meinung von Ihrem Blatt war, das nun auch meines werden wird. Ich sage offen: Ich subsumierte es unter den mir geläufigen Begriffen „radikalkatholisch als Sprachrohr des Kardirtals König“ und tendenziös „klerikalfaschistisch“. Entschuldigen Sie, liebe „Furche“, diese Unterstellung! Der Leidtragende bisher war ich, der ich die „Furche“ zu lesen versäumt habe. Zweifelsohne handelt es sich bei dieser Jubiläumsnummer um ein publizistisches Meisterstück, vielleicht in manchem zu vergleichen der Nummer 57 des „Rheinischen Merkur“ des rheinischen Joseph Görres. Jedoch, weniger die herzlichen Glückwünsche und Lobbezeigungen aus aller Welt beeindrucken mich. Nein, es ist vielmehr die Tatsache, wie die .furche“ das ihr gesetzte Ziel: „So sehen auch wir unsere Aufgabe, bescheiden, aber mit beharrlichem Bemühen Dienst an der Heimat, Dienst an der Wiedererweckung ihrer Lebenskräfte, Dienst am Frieden und am Wiederzusammenfinden der mißhandelten Menschheit zu leisten“ so gerade, mutig und unbeirrt verfolgt hat. „Zeitaufgeschlossen, auf das aktuelle Geschehen gerichtet, parteimäßig nicht gebunden (mag fragwürdig erscheinen?!), eine gesunde Demokratie bejahend, durch katholische Grundsätze bestimmt“, will sie nicht nur sein, sondern ist sie im Grunde. Davon überzeugten mich die „Querschnitte“ der Jubiläumsnummer.
Ich möchte abschließend, wenn es mir erlaubt ist, nur einen Satz noch zitieren, weil ich mich sehr darüber gefreut habe, als ich ihn las, den ich als das Herzstück in dem Artikel von Kardinal König bezeichnen möchte. Möge er nicht nur für die katholische Meinungspresse gelten, sondern auch auf alle anderen Erzeugnisse im österreichischen (aber warum nur im österreichischen?) Blätterwald zutreffen: „Es geht darum, nicht eng zu sein in der Enge des Herzens und des Geistes, sondern die Weite, die Größe, die Vielfalt des Lebens zu sehen, sehen im Lichte des Glaubens, der auch Spannungen und Widersprüche erträgt.“ In diesem Sinne darf auch ich mich als „Gratulantenspätlese“ bei Ihrem Blatt einstellen und Ihnen ein erfolgreiches Wirken für die Zukunft an Österreich und seinem Volk wünschen. Es geschieht zu unserem Besten!
Stud. phil. Robert Bauchinger Wien IV, Schlüsselgasse 9/8, b. Braun die klugen Augen heraus, im Nu zornig und wieder versöhnt, freundlich oder feindselig blickend. Der bald ergrauende Spitzbart war aus diesem Gesicht kaum wegzudenken, das mit einem Schnurrbart zu sehr der damaligen Mode gleichgeschaltet und das glattrasiert zu salonmäßig angemutet hätte. Ein ungewöhnlich angenehmes Organ nahm den Besucher sofort gefangen. Im Ohne besondere Anstrengung gepflegten österreichischen Hochdeutsch, das keine Spur von der in Sachsen verbrachten Kindheit noch von den steirischen Ursprüngen Funders verriet noch den drei Abarten des eigentlichen Wienerisch, dem der Hofgesellschaft und der sie nachahmenden „Vonerln“, dem des Kleinbürgertums oder gar dem aus den „entern Gründen“, verhaftet war, in dieser „Koi'ne“ der Gebildeten lag einerseits unbewußte Absage an das allzu Vulgäre, anderseits Bekenntnis zur engeren Heimat. Die rechte Mitte wahrte Funder ebenso in der weder stutzerhaften noch bo-hemehaft vernachlässigten Kleidung, dm gesamten Lebensstil. Doch in einem vermochte er nicht in mittleren Regionen zu verbleiben: man empfand sogleich, daß er zu befehlen, zu ordnen, zu lenken bestdmmt war. Schon deshalb, weil er, wie nur wenige, die Liebe seiner Mitarbeiter und Untergebenen gewann, die sich sogar in respektvoll-gutmütigem Spott über manche seiner Eigenheiten äußerte.
40 Jahre später: Friedrich Funder, jetzt eine der historisch gewordenen Gestalten Österreichs, ein „great old man“ des gesamteuropäischen Journalismus. Ungebeugt schreitet der mehr als Achtzigjährige durch die Prunksäle eines Alt-Wiener Palastes. Er trägt mit Würde den Prack mit dem Bande eines Großkreuzes und dazu edn reiches Assortiment anderer hoher Dekorationen. Minister und Botschafter umdrängen ihn. Doch er ist sich gleichgeblieben. Einfach, aufrecht und gerade, quickfrisch, schlagfertig im Gespräch. Noch immer so, daß man ihm jeden Augenblick einen Befehlsposten anvertrauen möchte. Eines aber ist — wie so manches unbewußt — an Funder zu merken: die Befriedigung darüber, daß sein Wirken nicht fruchtlos war, daß er eine Schar seiner würdiger Schüler herangebildet hat. Daß, sehen wir vom Einmaligen, Unübertragbaren ab, sein Wollen und Wirken in ihnen fortdauern wird. Daß die Spur von seinen Erdentagen nicht untergehen kann, solange es ein freies, unabhängiges, seiner Tradition getreues Österreich geben wird.