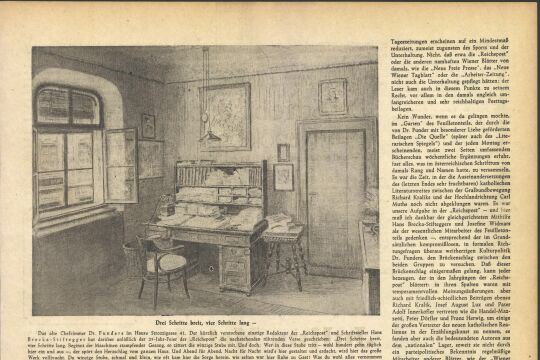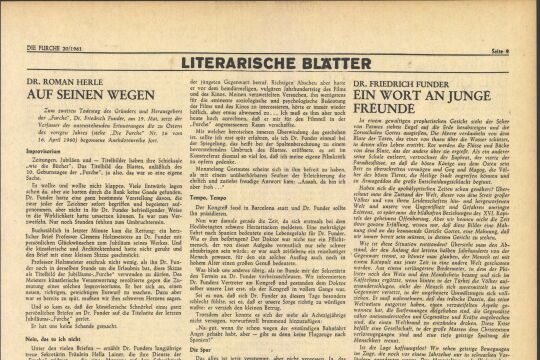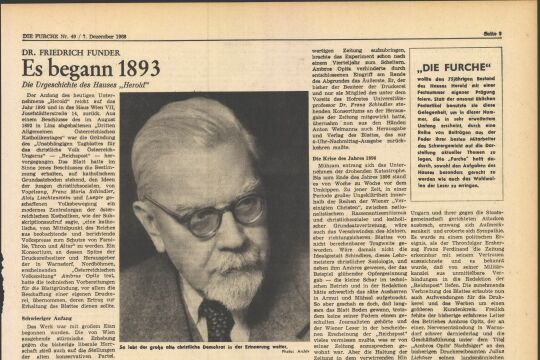„Ich werde ein neues Leben anfangen...“
Bis 1945 gehörte ich keiner politischen Partei an, und auch seither, auch in den Jahren meiner einzigen Parteimitgliedschaft, habe ich mich bemüht, für alle Menschen da zu sein. Man erlaube mir diese simple Feststellung, weil die durch nichts bewiesene Behauptung des Gegenteils bis heute nicht ausgestorben ist. Ich war mit allen Parteien unzufrieden und bin es heute noch, bekämpfte und bekämpfe Irrwege und Fehlleistungen, wo immer sie als solche erkennbar sind, möglichst rechtzeitig, frühzeitig, auch wenn mir das den Narren oder den Sonderling oder Ärgeres einbringt. Das hinderte mich nicht, die menschlichen Beziehungen zu verschiedenartigen Parteimitgliedern zu pflegen. Der Mensch ist ungleich mehr wert als Partei, Weltanschauung, Ideologie, Religion, Konfession, Sekte, elfenbeinerner Turm. Friedliche Koexistenz war für mich immer etwas Selbstverständliches, lange, bevor sie spezielle Doktrin wurde. Im KZ wurde sie auch denen aufgezwungen, und vielfach sogar selbstverständlich, die sie früher noch nicht kannten oder praktizierten. Auch in der Zeit meiner Parteizugehörigkeit — Mitglied des ZK der KPÖ von 1945 bis 1956 — ebenso wie als Stadt-und Gemeinderat, als Redakteur des „Tagebuch“ und dessen Mitherausgeber war mir die Bereitschaft für alle Österreicher etwas Selbstverständliches. Wie das meine Zeit- und Neidgenossen jeweils einschätzten, heute und morgen einschätzen, ergibt sich begreiflicherweise aus dem Unterschied.
Bis 1945 gehörte ich keiner politischen Partei an, und auch seither, auch in den Jahren meiner einzigen Parteimitgliedschaft, habe ich mich bemüht, für alle Menschen da zu sein. Man erlaube mir diese simple Feststellung, weil die durch nichts bewiesene Behauptung des Gegenteils bis heute nicht ausgestorben ist. Ich war mit allen Parteien unzufrieden und bin es heute noch, bekämpfte und bekämpfe Irrwege und Fehlleistungen, wo immer sie als solche erkennbar sind, möglichst rechtzeitig, frühzeitig, auch wenn mir das den Narren oder den Sonderling oder Ärgeres einbringt. Das hinderte mich nicht, die menschlichen Beziehungen zu verschiedenartigen Parteimitgliedern zu pflegen. Der Mensch ist ungleich mehr wert als Partei, Weltanschauung, Ideologie, Religion, Konfession, Sekte, elfenbeinerner Turm. Friedliche Koexistenz war für mich immer etwas Selbstverständliches, lange, bevor sie spezielle Doktrin wurde. Im KZ wurde sie auch denen aufgezwungen, und vielfach sogar selbstverständlich, die sie früher noch nicht kannten oder praktizierten. Auch in der Zeit meiner Parteizugehörigkeit — Mitglied des ZK der KPÖ von 1945 bis 1956 — ebenso wie als Stadt-und Gemeinderat, als Redakteur des „Tagebuch“ und dessen Mitherausgeber war mir die Bereitschaft für alle Österreicher etwas Selbstverständliches. Wie das meine Zeit- und Neidgenossen jeweils einschätzten, heute und morgen einschätzen, ergibt sich begreiflicherweise aus dem Unterschied.
Mit Friedrich Fluider verband mich manche Differenz bis 1938. Schon im ersten Weltkrieg schrieb ich der „Reichspost“ Briefe, die zwar nicht beantwortet wurden, aber sich mit der für mich schon damals problematischen Identität von Gott, Kaiser und Vaterland beschäftigten. Als ieh in der „Arbeiter-Zeitung“ weiße Zensurflecken entdeckte, wurde meine kriegsgegnerische Phantasie angeregt. Dem Grazer Universitätsprofessor DDDr. Johannes Ude, dessen Bekämpfung von Alkohol, Nikotin und Prostitution im Hinblick auf die Kriegsverlängerung mir imponierte, schrieb ich zustimmende Briefe und beschwerte mich über die christlich-soziale „Reichspost“. Ude antwortete und feuerte mich an, durchzuhalten, aber anders, das heißt Friedenskämpfer zu werden. Mein Geschichtsprofessor in den oberen Mittelschülklassen war Emmerich Czermak, der spätere Unterrichtsminister und der letzte Obmann der Christlich-sozialen Partei. Wir stritten nicht wenig in der Schule, und im späteren Leben war das nicht viel anders, aber ich glaube heute sagen zu können, daß wir ganz gute Freunde waren. Bis zu seinem Tod vor einigen Jahren. Uber all das unterhielten sich die Häftlinge F. F. und V. M.
Zwischen 1934 und 1938 habe ich Funder öfter in seiner Redaktion besucht. Mein Thema hieß ständig „Hitler ante portas“, Unmöglichkeit einer Verständigung mit den Nationalsozialisten, Hitler ist der Krieg, Einigung der Österreicher zur Abwehr Hitlers, Demokratisierung Österreichs. Als ich im Herbst 1937 in die Strozzigasse kam, sah ich das Auto des Hitler-Botschafters Franz von Papen vor dem Redaktionsgebäude der „Reichspost“ stehen. Da ist's höchste Zeit, sagte ich mir, als ich die Stiegen hinaufging. Oben mußte ich lang warten, bis der katholische Herrenreiter sich verabschiedete. Aber dann kam ich dran. Ich ließ an dem Botschafter des Teufels kein gutes Haar. Funder hörte mich geduldig an, wollte mir aber plausibel machen, daß er den Kontakt mit Papen auch zu Informationszwecken brauche. Beim Abschied sagte ich ihm: „Wenn Sie glauben, daß der katholische Papen Sie retten wird, dann irren Sie sich gründlich.“
An diese Worte knüpfte Funder an, als wir uns zum erstenmal in Dachau etwas ausführlicher unterhalten konnten: „Du hast recht gehabt Ich habe mich getäuscht Mag sein, daß der Freiherr von Papen etwas anderes wollte, aber...“ „Aber, unsere Aufgabe als Österreicher wäre es schon immer gewesen, zu erkennen, wer Hitler ist und was er will“, unterbrach ich Funder, und schon waren wir mitten in der Diskussion, selbstverständlich standen die großen deutsch-österreichischen Umfaller mitten im Gespräch. Wir Österreicher vom ersten Transport ins KZ Dachau und auch von den folgenden Transporten des Jahres 1938
— Funder dürfte im Mai gekommen sein — waren in einem Punkt einer Meinung, und der war die eindeutige Ablehnung, Verurteilung, Verdammung österreichischer Spitzenfunktionäre wie Innitzer und Renner, die uns eindeutig in den Rücken gefallen waren.
Im Herbst 1938 kamen, sozusagen am laufenden Band, nach der Kristallnacht, Judentransporte nach Dachau. Das ging so durch Wochen hindurch. Da mir ein deutscher Freund einen Platz im Schreiberkommando bei der Lageraufnahme der Juden Im Lagerbad verschafft hatte, brauchte ich nicht zur Schwerarbeit auszurücken. „Zum Glück“ kamen immer mehr und mehr Juden. Das Schreiberkommando wuchs bis auf 60, zeitweise auch 80 Mann an. Bürokratie muß sein, und erst recht deutsche Ordnung, Formulare. Bald begriffen wir, daß der Formularismus schon deshalb so üppig blühen mußte, weil schon etliche Wochen später die Entlassung vieler Juden erfolgte, und daher wurde Zugang und Abgang der Juden möglichst genau auf dem Papier registriert. Viele hatten ein Schanghai-Visum erhalten und konnten Österreich verlassen.
Funder war damals körperlich in sehr schlechter Verfassung, er hatte schon den Sechziger überschritten und gehörte zur alten Garde. Es war für mich selbstverständlich, meine Lagerbeziehungen zu dem von Mithäftlingen geleiteten Arbeitseinsatzkommando zugunsten Funders zu benützen und ihm einen Schreiberposten im Bad zu verschaffen. Dort saßen wir wochenlang nebeneinander. Daraus ergaben sich lange Gespräche.
Funder erwies sich als Mann der gründlichen Revision. Immer wieder sagte er: „Wenn ich je das Glück haben sollte, von da hinauszukommen, ich werde ein neues Leben anfangen,'' Darunter verstand er vor allem, daß er sich nicht mehr parteimäßig binden werde. Auch neue Formen der offenen Diskussion, der unterschiedlichen Standpunkte müßten geschaffen werden. Unerbittlich verhielt ich mich auch ihm gegenüber im Fall Innitzer und Renner. Auch er brachte wiederholt seine Meinung zum Ausdruck, daß mit solchen Männern ein neues Österreich, von dessen Auferstehung wir beide überzeugt waren, niemals in Betracht kämen.
Funder war ein leidenschaftlicher Pfeifenraucher. Dem Bad, wo unsere Schreibtische aufgestellt waren, war der Schubraum im Wirtschaftsgebäude des Lagers vorangelegen. Hier wurden den Neuzugängern die Kleider und Effekten abgenommen. Dazu gehörten auch Zigarettenspitze und Pfeifen. Einmal ging ein SS-Mann mit einem Korb voll kleiner Handpfeifen durch das Bad. Wenn ihm ein Häftling grad so paßte, blieb er bei ihm stehen und forderte ihn auf, sich was auszusuchen. Als er bei mir war, nahm ich mir eine Pfeife heraus, obwohl ich längst kein Pfeifenraucher mehr war, denn seit dem hektischen Jahr 1934 war ich zum Zigarettenrauchen übergegangen. Meinem Nachbarn Fritz funkelten die Augen: „So schöne Pfeiferin...“ Der SS-Mann ließ ihn aussuchen. „Die da, nein die da, die ist noch schöner.“ Er wühlte in den Pfeiferin. Der SS-Mann brummte: „Du nimmst auch gleich den ganzen Korb-— ja, wenn ich ihn dir gebe. Das war noch schöner.“ Nach längerem Herumkramen entschied sich Fritz für die Pfeife seiner Wahl, die ihm zur Qual geworden. Er hielt sie mit den Fingern ^umschlungen, probierte den Ansatz, er war glücklich. Als der SS-Mann weg war, schenkte ich ihm meine Pfeife; da ich sie ja nicht brauchte. An diesem Abend schwärmte' Funder beim Heimgang in die Baracke vom seligen Pfeifenrauch in der Redaktionsstube. Am nächsten Tag in der Früh mußte ich ihm die zweite Pfeife, die ich ihm am Tag zuvor gegeben hatte, wieder ausreden. Ich erinnerte ihn daran, daß die Lagerleitung durch Block-und Stubenälteste wiederholt mitteilen hat lassen, das Horten von Gegenständen im Spind sei bei strenger Strafe verboten. Ich sagte daher zu Funder: „Du gibst mir das Pfeiferl wieder zurück, ich werde es in meinem Spind aufbewahren und es dir jederzeit geben, wenn du eine Abwechslung brauchst.“
Oft ging es hart auf hart in unseren Gesprächen. Vor allem dann, wenn der Antisemitismus in der Christlich-Sozialen Partei drankam. Da war ich unerbittlich und ging mit der „Reichspost“ streng ins Gericht. Als Mitte 1936 in der Wiener Universität Professor Moritz Schlick von einem katholisch protegierten Fanatiker niedergeschossen wurde, protestierte die „Reichspost“ mit keinem Wort gegen die Bezeichnung Schlicks als Juden, wie sie in anderen katholischen Blättern wucherte. Moritz Schlick aus Hamburg war ein ,Arier“ wie der deutsche Dichter Ernst Moritz von Arndt. Auch L'udo Moritz Hartmann, eine wissenschaftliche Leuchte der Wiener Universität, hatte es nicht leicht bei der „Reichspost“, wo es ein Jahr vor seinem Tod hieß, daß nur „arbeitslose Bäckergesellen“ bei ihm Hörer seien.
Einer dieser Gesellen war auch ich, ich war sogar Hartmanns letzter Schüler, der bei ihm dissertierte, aber ich war weder arbeitslos noch Bäcker. Solcher Zeitungspraxis stellte ich in den Gesprächen mit Funder „Die Fackel“ gegenüber, und es war für mich nun interessant, zu hören, wie Funder immer mehr selbstkritisch die Unerbittlichkeit und die Lauterkeit einer so einmaligen und einzigartigen Persönlichkeit wie Karl Kraus herausstellte. Nach dem Ende des Dritten Reiches sprachen wir öfter über meinen und der Karl-Kraus-Gesellschaft Plan einer Neuherausgabe aller Kraus-Werke unter dem Protektorat der Stadt Wien. Daß eine Wiener Mafia diesen Plan durchkreuzte, und daß schließlich der kritisch-katholisch orientierte Kösel-Verlag in München die Wiedergeburt der Kraus-Werke zustande brachte, hätten wir beide auch in kühnsten Träumen im KZ nicht vorausgeahnt. Unvermeidbar waren Gespräche über Ignaz Seipel. Alles, was im Lager links war, und erst recht, was vorher schon links sich bewegte, hatte nichts für den „Kanzler ohne Milde“ übrig. Funder versuchte mir Seipel sozusagen theoretisch zu erklären. Er kam aber ins Erstaunen, als ich ihm mitteilte, wie frühzeitig ich mit Seipel mich beschäftigte. 1917 hatte mir ein älterer Freund, der sich als Anhänger Anton Orels betätigte und sonst ein Büchernarr war, Seipels „Wirtschaftsethische Lehren der Kirchenväter“ geschenkt. Für meine polemischen Auseinandersetzungen mit meinem Gymnasialprofessor in Religion hatte ich mir ein solches Buch schon lang gewünscht, denn von den Kirchenvätern wußte ich damals schon, daß sie mir manches Argument im Kampf gegen den politischen Katholizismus der Christlich-Sozialen liefern würden. Ungefähr ein Jahrzehnt früher hat Seipel dieses Buch herausgebracht, es war seine Habilitationsschrift an der Wiener Theologischen Fakultät. Wie gesagt, da staunte Fritz: „Das hätte ich nicht gedacht von dir, aber wie ging das weiter?“ Im Lauf der zwanziger Jahre hatte ich den deutschen Publizisten Dr. Werner Thormann kennengelernt, er war ein enger Freund und Mitarbeiter des Reichskanzlers Wirth und hat eine interessante Studie über Seipel publiziert, die als Buch herausgekommen, in Österreich freilich wenig bekannt war. Mit einem Wort: Ich kannte ganz gut den Theoretiker und Wissenschaftler Seipel zu einer Zeit schon, als der Praktiker und Politiker noch nicht so klar ausgeprägt war. Um so kritischer mußte daher meine Einstellung zu Seipel werden, als der Kampf um Österreich, um seine Selbständigkeit und Unabhängigkeit begann, und dieser fing für mich schon mit dem Beginn der zwanziger Jahre an, und ich hielt ihn kompromißlos durch. Am meisten lachte Funder mit aller Herzlichkeit auf, wenn ich zu ihm sagte, und ich tat das öfter geradezu formelhaft: „Ich habe mir mein KZ wahrlich verdient, und ich könnte fast stolz sein auf meine fast zwanzigjährige Vordienst-zeiit dm. Kampf gegen Hitler.“ Häufig hatten Funder und ich Vernehmungen in der politischen Abteilung der Gestapo im Lager. Das galt auch für Richard Schmitz, dessen politischen Katholizismus ich entschieden bekämpft hatte. Im Lager unterhielten wir uns häufig zu dritt, nicht zuletzt deshalb, weil wir drauf-gekommen waren, daß die Gestapo uns bei den Vernehmungen gegeneinander ausspielen wollte. Als Österreicher hatte ich nicht den geringsten Grund, meine beiden älteren politischen Gegner zu belasten. Wir durften uns aber auch nicht in Widersprüche verwickeln, und so teilten wir einander immer die Fragen der Gestapo mit, die an jeden einzelnen von uns gerichtet wurden. Es ist klar, daß wir bei solchen Gelegenheiten die österreichische Geschichte der Ersten Republik, wenn schon nicht auf einen Nenner brachten, so doch sie uns so zurechtlegten, daß wir uns nicht in den Fängen der Gestapo verstrickten. Wir drei betrieben ein gemeinsames Verteidigungsspiel, das uns begreiflicherweise sehr nahebrachte. Es war aus einem Notstand geboren, nach 1945 haben wir uns öfter daran erinnert. Wir haben uns sogar vorgenommen, zu dritt darüber ausführlich zu schreiben. Es kam leider nicht dazu.
Einen großen Eindruck machte auf Funder, als ich ihm von meinen Plänen 1937 erzählte, die Regierung Schuschnigg durch eine neue Regierung abzulösen, die mit der nötigen Konsequenz an eine politische Verständigung mit der verbotenen
Sozialdemokratischen Partei herangehe. Funder hatte zwar davon gehört, wie er mir versicherte, und er habe auch von meinen politischen Reisen nach Paris, Brüssel, London im Berliner „Angriff“ gelesen. Er konnte es aber nicht fassen, daß man Schuschnigg stürzen müsse, um eine breite Einheitsfront gegen Hitler zustande zu bringen. Geduldig hörte er sich an, was ich da alles unternommen hatte. Auch nach dem Krieg hat er mich wiederholt ermuntert, alle diese Tatsachen gründlich darzustellen. Ich hatte leider andere Sorgen, und so ist der Wunsch, den auch andere mir gegenüber zum Ausdruck brachten, noch nicht erfüllt.
Einen besonderen Eindruck machte auf Funder die Tatsache, daß ju-stament Richard Schmitz es war, der Mitte 1936 meine Absetzung in der Volkshochschule Wien-Ottakring durchsetzte. Freilich war es auch Funder, der die damalige Politik des Wiener Bürgermeisters billigte. Als Schmitz und ich uns das erste Mal In Dachau zu sehen bekamen, sagte er: „Du verzeihst mir doch meine Haltung gegen dich.“ Ich war bis zur Absetzung durch Schmitz, die mit Sicherheitsgründen motiviert war, der letzte freigewählte Obmann der Ottakringer Volkshochschule. Gewiß hatte ich dort dafür gesorgt, daß auch die „Verbotenen“ zu Wort kommen konnten. Das war für mich selbstverständlich, denn nur in einer Einheitsfront von rechts bis links war Österreich lebensfähig und fähig, Widerstand gegen den unbarmherzigen Aggressor und Vernichter der österreichischen Selbständigkeit zu leisten. Daß ausgerechnet ich ein Feind der österreichischen Sicherheit sein sollte, gehörte halt auch zu den Treppenwitzen der damaligen. österreichischen Geschichte.
„Du siehst, ich habe rrröt was Neuem angefangen, ich habe mich aus der Parteipolitik zurückgezogen“, das sagten beide zu- mir, als wir uns über die Vergangenheit unterhielten. Der eine gründete einen Verlag, der sich erfolgreich' durchsetzte, der andere pflügte weithin sichtbar das Terrain und sorgte-für fruchtbare Auflockerung. Friedrich Funder war einer der ersten, der die Notwendigkeit des „Gesprächs der Feinde“ erkannte und förderte. Wenn Schmitz mich um „Verzeihung“ ersuchte, so rannte er schon deshalb offene Türen ein, weil Politik, der ich mich immer ganz verschrieben habe, für mich zu allen Zeiten «ine offene Auseinandersetzung bedeutet, auch wenn diese nur allzu Oft erst viel später als Auseinander-und Zusammensetzung offenbar wird. Ich betrachte das nicht als ein« Tragödie, wie es häufig perhorres-ziert wird, sondern versuche immer wieder von neuem, Fehler in der Vergangenheit offen und ohne Einschränkung darzulegen. Freilich vertragen das viele Menschen auch heute noch nicht. Sie sind gleich „bös“, wenn man gewisse alte Wunden aufreißt. Geschichtliche Lehren können, wenn überhaupt, nur aus offen dargelegten Tatbeständen gezogen werden. Da soll keiner den anderen schonen, sonst kommt nie zustande, was als geschichtlich« Wahrheit angestrebt wird. ■ .......
Für das Zusammenfinden der Österreicher oder zumindest vieler Österreicher oder zumindest vieler Österreicher war die berühmte Lagerstraße, auf der die SS «ie alle unterschiedslos und brutal exerzieren und verbluten, aber auch Spazierengehen ließ; sicherlich ein« hohe Schule politischer Erkenntnis und neuartiger Willensbildung. Über unsere Gespräche im KZ wäre noch manches zu berichten. Auch darüber, wie wir uns dann in Freiheit darüber unterhielten. Vielleicht ergibt sich noch Gelegenheit.