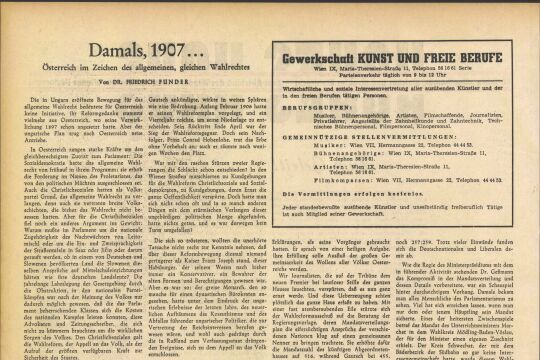Mancher Leser wird sich über diesen Titel zunächst wundern. Christlichsozial 1963! Was soll das? Eine historische Reminiszenz oder vielleicht gar der Aufruf zur Gründung einer neuen Partei in Österreich? Weder das eine noch das andere. Aber die Woche, in der Haus Nummer 8 in der Wiener Strozzigasse, das in seinem Entstehen und in seiner bewegten Geschichte untrennbar mit jener an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert aufgebrochenen Reformrichtung im österreichischen Katholizismus verbunden ist, seinen 50. Geburtstag feiert, erscheint als der gegebene Zeitpunkt, eine schon mehrmals zurückgestellte Frage auszusprechen: Ist „christlichsozial“ heute nur mehr eine verblassende Erinnerung? Eine Erinnerung an „Rerum novarum“ und an den Freiherrn von Vogelsang, an den Bürgermeister Karl Lueger und an seine erste „Gemeinwirtschaft“, an Friedrich Funder und seine „Reichspost“, an Franz Ferdinand und an den nie Wirklichkeit gewordenen Traum, an Stelle der unhaltbar gewordenen Doppelmonarchie, das Commonwealth der Völker Mitteleuropas zu schaffen? Wenn ja, dann wäre der Platz für solch einen Artikel schlecht gewählt. Ein Erinnerungsblatt gehört nun einmal, auch wenn es noch so teure Erinnerungen sind, nicht auf die erste Seite einer kulturpolitischen Wochenschrift.
Aber es geht hier um etwas ganz anderes. Hier soll der Versuch gemacht werden, zu prüfen, ob es nicht auch heute, in einer total veränderten geistigen und politischen Landschaft, in Österreich eine „christlichsoziale“ Position gibt, die mit dem gleichen Mut und der gleichen Leidenschaft gehalten sein will und ausgebaut gehört, wie sie unsere geistigen Vorfahren ausgezeichnet hat.
Wie war es damals? Georges Bernanos läßt den alten Pfarrer von Torey zu dem jungen Landpfarrer sprechen: „Heutzutage liegt das alles weit hinter uns. Du hast das nicht erlebt. Die berühmte Enzyklika „Rerum novarum“ Leos XIII. liest du zum Beispiel ganz ruhig und so leicht hin wie eine Fastenanweisung. Damals, mein Sohn, glaubten wir, die Erde bebte uns unter den Füßen. Was für eine Begeisterung! Ich war zu jener Zeit Pfarrer mitten im Kohlengebiet. Der einfache Gedanke, daß Arbeit keine dem Gesetz von Angebot und Nachfrage unterworfene Ware ist, daß man nicht in Löhnen und Menschenleben spekulieren kann wie in Getreide, Zucker und Kaffee, das warf die Gewissen um. Kannst Du es glauben: Weil ich diesen Gedanken von der Kanzel aussprach, galt ich für einen Sozialisten “
Auch in Österreich bebte die Erde den Menschen unter den Füßen. Seit dem „schwarzen Freitag“ des Jahres 1873 zeigte der Liberalismus deutlich Verfallserscheinungen. Neue Schichten drängten in die politische Arena. Die Unruhe war groß, nicht weniger groß war aber auch die politische Kopf- und geistige Orientierungslosigkeit. „Demokraten“ — in sich selber alles andere als einig — treten auf. „Reformer“ machen von sich reden und finden bald mit frühen Deutschnationalen der verschiedensten Observanz in einem lautstark verkündeten Antisemitismus eine „Basis“. Im Hintergrund aber steht das Millionenheer der noch stummen Lohnarbeiter. Wie lange? Ratlos sehen die Katholisch-Konservativen aus ihren Kasinos diesem Gang der Dinge zu. Sie haben zwar dem Frei- herm von Vogelsang die Möglichkeit gegeben, seine Ideen eines christlichen Sozialismus in ihrer Presse zu entwickeln, einige frühe Sozialgesetze tragen ihre Unterschrift, aber für einen entscheidenden Durchbruch gibt es doch Schranken, die Geburt und Besitz gesetzt haben.
Alles ist in Fluß. Wem wird die Zukunft gehören? In diesem politisch so labilen Wien wird im Jahr 1887 ein neuer Verein eingetragen. Einer unter vielen. Er nennt sich „Christlichsozialer Verein“. Junge Akademiker geben sich hier mit kaum viel älteren Geistlichen ein Stelldichein. Sie tasten sich an Ideen heran, denen in der Enzyklika Leos XIII. höchste Ermunterung zuteil wird. Suchende Arbeiter stoßen dazu. Eine Gruppe unter vielen — eine Gruppe aber, die zum Unterschied von den anderen unruhigen Geistern festen weltanschaulichen Boden unter ihren Füßen hat. Auch vaterländische Gedanken begannen bald mitzuschwingen. Diese Chance erkennt auch ein Mann, der genau zu schätzen und zu wägen weiß: Doktor Karl Lueger. Der aufstrebende Politiker nimmt das „Risiko“ in Kauf, zu den wegen ihrer staatstreuen Gesinnung als „antideutsch“ verschrienen „Klerikalen“ zu gehen, und erst aus dieser Begegnung zwischen dem Mann und der Idee entsteht der Funke, der die alte Parteienwelt zum Einsturz bringen wird.
Hier kann nicht der Weg der aus den verschiedensten Gruppen und Grüppchen formierten neuen Kraft verfolgt werden. Bald wird aber eine von ihnen der ganzen Richtung ihren Namen aufprägen. Als Christlichsoziale Partei ist die Partei Luegers in die Geschichte eingegangen. Um was es hier geht, ist vielmehr: zu zeigen, daß die „Christlichsozialen“ schon von Anfang an in ihrem politischen Lager nur eine Gruppe unter mehreren waren.
Schon die Stunde des ersten großen Triumphes hat ihre Problematik. Durch die Vereinigung mit den Konservativen ist die Partei 1907 zwar die an Mandaten stärkste des Abgeordnetenhauses, aber ihrem Elan sind Zügel an-
gelegt. Und als der Liberalismus in der Ersten Republik endgültig verschwunden ist, beginnt er auf seine Weise Rache an jener Partei zu nehmen, die ihn einst in Wien in nur wenigen Wahlgängen von der politischen Bühne weggefegt hatte. Es beginnt ein Prozeß des „Unterwanderns“ und des „Unterlaufens“, der freilich erst in der Ersten und Zweiten Republik zur Perfektion ausgebildet werden sollte.
Die politische Tragödie zwöier Männer stehe für die Tragödie einer Idee. Leopold Kunschak — um nur einen Namen, und gewiß nicht den letzten, zu nennen — haben wir uns alle angewöhnt, zu „harmlos“ zu sehen. Er war nicht zu allen Zeiten der abgeklärte Alte. Er war ein Kämpfer, er war sehr oft auch ein Verlierer. Gar bitter war es für ihn, miterleben zu müssen, wie die große Konzeption einer christlichen Arbeiterpartei früh auf „administrativem“ Wege von seinen Parteifreunden „erledigt“ wurde. So blieb ihm Jahrzehnte später, am Vorabend des blutigen Feber 1934, als letzte Konsequenz nur die Rolle des hellsichtigen Mahners, der mit Sicherheit um das kommende Unheil weiß, dessen Kräfte aber zu schwach sind, es zu wehren. Führte Kunschaks Weg letzten Endes in die Resignation, so trieb der immer breitere Spalt zwischen Idee und Wirklichkeit einen Anton Orel in die Rebellion und schließlich auf den Weg des politischen Einzelgängers.
Der Name „Christlichsozial“ wurde vor drei Jahrzehnten aus dem politischen Wortschatz Österreichs gelöscht. Es weinten ihm damals nur wenige Tränen nach. Vor allem unter der Jugend, die in dieser oder jener Form „Neuland“ suchte, hatte er keinen guten Klang mehr. Waren doch die Feuer schon weit herab
gebrannt, stand doch das Wort schon lange mitunter für nicht mehr viel anderes als für eine mickrige, kleinbürgerliche Gesinnung. Den Rest besorgte die „autoritäre“ Welle, die damals über Mitteleuropa hinweg ging. Und doch wurde der Kern der Männer, die zum Endkampf für Österreich antraten, von niemand anderem gebildet als von jenen, die in christlichsozialen Traditionen standen.
Sie waren die Letzten und sie waren auch die Ersten. Als 1945 ein neuer Anfang gemacht wurde, erfolgte er nicht nur in Österreich unter der Fahne der christlichen Demokratie. Altes christlichsoziales Gedankengut des eigenen Landes verband sich mit Ideen, die der Wind von Frankreich her trug. Es war die Zeit, in der die Begegnung mit Bloy, mit Bernanos und Pėguy eine nachrückende katholische Akademikergeneration entscheidend beeinflußt hat. Es war die Stunde, in der auf der politischen Ebene das MRP ein Modell bildete, an dem sich die „Schwesterparteien“ maßen.
„Macht mir die Mitte stark!“ Dieses umgewandelte Wort Schlieffens war es, was den Christen als Leitbild in der Politik vorschwebte — in Antithese zu dem Sozialismus verschiedenster Spielarten, im Gegensatz aber auch zu den Versuchen, auf diesem oder jenem Weg politische oder gesellschaftliche Zustände Vorkriegs-Europas „zu restaurieren“. Und mit diesem Bekenntnis zu einer Erneuerung aus den Wurzeln erfolgt in Österreich auch eine stärkere Besinnung auf die Idee dieses Staates und ihre festere Verankerung im Herzen seiner Bürger.
Seither sind beinahe zwei Jahrzehnte ins Land gezogen. Auf den geistigen Frühling ist — das wissen wir heute — kein Sommer gefolgt.
Der Siegeszug des „Wirtschaftswunders“ durch die westliche Welt erfolgte unter dem Vorzeichen eines erneuerten Liberalismus, der sich — zugegeben — von manchen Schlak- ken befreit und als „domestizierter“ Kapitalismus vieles dazu gelernt hat. Das zeitigte selbstverständlich auch seine Folgen auf der Ebene der Parteipolitik. Die Fahne der christlichen Demokraten wurde in aller Stille eingeholt, oder aber es zogen dort, wo sie weiter vom Giebel weht, in das Haus oft auch wieder sehr viele Mieter ganz anderer Art ein. Erst vor kurzem hat der Präsident des Nationalrates, Dr. Maleta, von dem großen „zeitbedingten inneren Dilemma“ gesprochen, das die christlich-demokratischen Parteien befallen hat. Um die Mehrheit im Staate zu behalten, brauchen sie auch jene Menschen, die nicht eine Aufgabe ruft, die keiner Idee sich verpflichtet fühlen, sondern „die sich aus verschiedensten Berufs- und sonstigen Interessen“ in ihr zusammengefunden haben.
Ist also ein Kapitel endgültig abgeschlossen? Sind die christlichsozialen Ideen, die vor acht Jahrzehnten gleich einem Gebirgsbach hoch oben in dem Felsen entsprungen, die einem Wasserfall ähnlich tosend zu Tal stürzten, hernach breiter, aber auch träger dahinflos- sen, viele Mühlen (oder ist es besser zu sagen: die Mühlen vieler) trieben, im Meer unserer entideologisierten Konsumgesellschaft aufgegangen?
Wir können es nicht glauben. Auch dann nicht, wenn es uns viele einreden wollen. Wieder einmal haben sich die Zeichen geistiger Unruhe — für jeden, der Ohren hat zu hören, vernehmbar — gemehrt. Und es steht auch noch nirgends geschrieben, daß ■ unserem Neoliberalismus — mutatis mutandis — sein „schwarzer Freitag“ erspart bleibt. Was dann? Es gibt bestimmt jemanden, der darauf wartet.
Da heißt es rechtzeitig an den Aufbau einer „inneren Linie“ denken. Da gilt es, sich darauf zu besinnen, daß das christlichsoziale Erbe auch in unserer Gegenwart und in unserem Lande noch Sachwalter hat, die es von alten Schlak- ken befreit haben und mit neuen Impulsen erfüllen. Moderne „christlichsoziale“ Ideen sind es, die von der Katholischen Sozialakademie ihren Ausgang nehmen oder — einige Schritte weiter hinein in den parteipolitischen Raum — die im „Institut für Sozialpolitik und Sozialreform“ gedacht werden. In der Katholischen Arbeiter- und Jungarbeiterbewegung gibt es bestimmt einen großen „christlichsozialen“ Reservekader, von dem die Politik — zu ihrem eigenen Schaden — so wenig Gebrauch macht. Und die jungen katholischen Akademiker? An platonischen Angeboten zum Engagement ist zwar kein Mangel, aber wenn sie zugreifen wollen, merken sie sehr bald, daß sie nur als „Störenfriede“ empfunden werden.
Christlichsozial 1963 — das heißt: auf den Schultern starker Ahnen stehen. Es heißt aber nicht: tagträumerisch zurückblicken, die Kämpfe von gestern noch einmal zu kämpfen, sondern dem neuen Gebot eines jeden Tages zu folgen.
„Wir sind Menschen, Christen, Österreicher“! Mit diesem Ruf traten die Christlichsozialen einst in die Geschichte. In diesen Worten ist vieles angedeutet: die demokratische Gesinnung, der Wille zur Brüderlichkeit, der vaterländische Auftrag. „Menschen, Christen, Österreicher!“ Dieser Ruf erreicht durch die Jahrzehnte auch uns — als eine Mahnung, als eine Forderung.