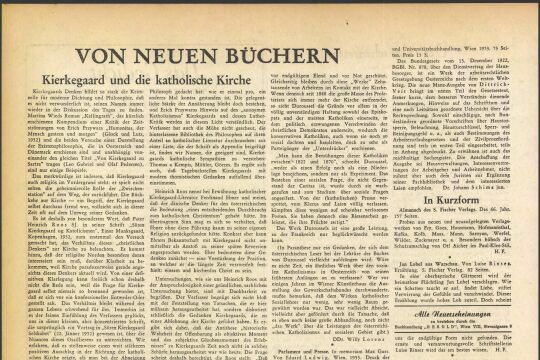Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit...“
„Brüder, zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum Lichte empor...“ Wir kennen die Welt der grauen Fabriken, der muffigen Mietkasernen, der finsteren Hinterhöfe, aus der dieser Schrei drang. Es war die Welt des arbeitenden Menschen unter dem gnadenlosen Schwungrad der Industrierevolution und des sie begleitenden Manchesterliberalismus. Arbeitstage von zwölf bis sechzehn Stunden, unkontrollierte Frauen- und Kinderarbeit, der Bettelstab für Krankheit und Alter, das Gespenst der Aussperrung und Arbeitslosigkeit, ein trostloser Unterschlupf als Zuhause, eine Familie, die keine ist, der trügerische Tröster Alkohol: das war das Los von Millionen — vor hundert Jahren. Vom recht- und schutzlosen Lohnarbeiter, vom Proletarier, der „nichts zu verlieren hat als seine Ketten“, zum freien Arbeiter im freien Staat führt ein langer, kurvenreicher Weg. Er sah Erfolge und Mißerfolge, er kannte trügerische Scheinlösungen, die sich bald als das Gegenteil aller Hoffnungen herausstellten. Auch stürmte der vierte Stand nicht in geschlossener Kolonne die Höhe der Zeit, vielmehr waren viele Seilschaften unterwegs, sich gegenseitig anspornend. Von dem erklommenen Gipfel freut stets ein Rückblick.
Noch vor 30 Jahren wäre man an den Historiker herangetreten, wenn die Aufwärtsentwicklung des vierten Standes, der Aufstieg einer Klasse, in gebührender Form gewürdigt werden sollte. Eingereiht in alle Volksbibliotheken, hätte dieses Buch dann auf eine zahlreiche Leserschar gewartet. Doch das Vertrauen in die Mission des Buches ist inzwischen viel geringer geworden. Heute erhalten Graphiker mit propagandistischer Ader und Talent zu anschaulicher, einprägsamer Darstellung den Auftrag. Eine Ausstellung wird geplant und eröffnet.
Eine Ausstellung! Im Zeitalter der Massen und der industriellen Gesellschaft bedeutet das: hunderttausende, oft Millionen Menschen erhalten ihr Bild von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durch Schaubilder, Montagen, Zusammenblicke in Wort, Ton, Farbe geprägt, und immer wieder durch das Bild, wie es die Ausstellung als Volkslexikon unserer Tage repräsentiert. Mit Vehemenz, mit aller Wucht und oft auch Geschicklichkeit totalitärer Propaganda stürzen sich deshalb auch die Diktatoren auf dieses Motiv, auf diese Möglichkeit, ins Denk- und Gefühlsleben breitester Massen einzugreifen, es in ihrem Sinne zu bewegen und zu formen. Noch heute kann man auch hierzulande in entlegensten Alpentälern Menschen finden, in deren Gedächtnis unauslöschlich Ausstellungen einer nahen Vergangenheit haften. Funk, Film, Presse — und diese drei kumulierend — hat im Zeitalter der Schlagworte, der Massensuggestionen, der schrecklichen Vereinfachungen und der unmittelbar auf die Sinne wirkenden Primitivassoziationen die Ausstellung einen eminent politischen, volkserzieherischen Charakter. Das heißt: sie kann unendlich viel schaden, verderben und sehr viel nützen, eben durch die Leitbilder, Idole, die sie beschwörend an die Wand malt und als einzige Wahrheit und Wirklichkeit vorstellt! Sosehr nämlich der heutige Mensch bereits geneigt ist, dem Ohr und der Zunge zu mißtrauen, dem Auge schenkt er noch über Gebühr Kredit: „Wir haben es ja gesehen, also muß es wahr sein...“
Für Veranstalter großer Ausstellungen heißt das: sie tragen eine bedeutende Verantwortung — für die Demokratie. Für Leitung, Führung und Irreführung weitester Volksschichten.
Wird nun die große Wiener Ausstellung dieser Verantwortung gerecht?
Die Geschichte — auch die einer Klasse — ist aus verschiedenem Garn gewoben. Die Wiener Ausstellung aber hat allein den roten Faden, den Anteil der sozialistischen Bewegung, herausgelöst und zum Leitseil gemacht. Alle Richtungen und Personen, die aus einer anderen Weltanschauung heraus sich der sozialen Frage genähert und ihren Beitrag zum Aufstieg der arbeitenden Menschen geleistet haben, genießen in den Schauräumen und Kojen des Wiener Künstlerhauses daher nur Gastrecht. Sie werden zwar geduldet, aber auf beschränkten Plätzen, möglichst unauffällig. So ergeht es neben den sogenannten „utopischen Sozialisten“ den Männern der Selbsthilfe und den Kathedersozialisten, vor allem den Wortführern einer christlichen Sozialreform, ihren Ideen und ihrem Werk. Leo's XIII. Bild steht überlebensgroß am Eingang. Das „Vaterland“ taucht einige Male auf, Name und Porträt des Freiherrn von Vogelsang huschen vorüber. Pfarrer Eichhorns Kampf für die „weißen Sklaven“, für die ausgebeuteten Angestellten der Wiener Tramwaygesellschaft findet Erwähnung. Dann aber verliert sich die schmale Spur, die schon bisher vom Wirken des Sozialkatholizismus nur ein mehr als spärliches Zeugnis gab, gänzlich. Sie taucht erst wieder auf, wenn der Ausgang bereits nahe ist. Hier, inmitten einer Rückschau über den Aufstieg des vierten Standes, findet sich auch ein Porträt Luegers. Lakonisch meldet die Legende, daß das Altersheim in Lainz und die Heilanstalt „Steinhof“ ihm ihren Bau verdanken. Von den ersten großen Kommunalisierungen auf dem Festlande, die mit dem Namen Lueger verbunden werden, ist hier nichts bekannt. Mitten in einer Flut Gewerkschaftsblätter, -broschüren und -büchern trifft man nach langem Forschen auch einige wenige
Autoren der Schule Vogelsang: Prälat Schindler, Wiard Klopp, E. K. Winter. Wäre den Bemühungen von katholischer Seite zur Lösung der sozialen Frage Gerechtigkeit widerfahren, so hätte eine eigene Abteilung unschwer den Beweis erbracht, mit welcher Zähigkeit und Leidenschaft immer wieder gerade von dieser Seite Vorstöße für die Sache des arbeitenden Menschen unternommen wurden. Hier wäre Raum gewesen, sich zu erinnern, daß die erste Lohnstatistik in Österreich ebenso wie die erste Ar-beiterstatistik aus dem Kreise katholischer Sozialreformer erstellt wurde. Die' halbvergessenen Beiträge zu der Diskussion des Zins- und Mietenproblems in der ersten Republik wären ans Tageslicht gekommen. Die „Aktion Winter“
nach dem Bürgerkrieg vom Februar 1934 hätte ebenso zur Sprache kommen müssen, wie die mit dem Namen Grossmann verbundene „Soziale Arbeitsgemeinschaft“. Erwähnung hätte schließlich auch jene letzte weit fortgeschrittene Aktion finden müssen, die im März 1938 sozialistische Gewerkschafter gegen den gemeinsamen Gegner mobilisierte. Aber nein. Es ist viel einfacher, eine Koje mit schwarzem Papier auszutapezieren, „Lüge, Verrat, Gewalt, Faschismus“ und der Einfachheit wegen die Jahreszahlen 1934 bis 1945 darüber zu setzen. Das entspricht der Theorie. Was macht es schon aus, wenn das Leben andere, verschlungene Wege ging.
In das Konzept dieser Geschichtsschau paßt auch nicht die entscheidende Rolle, die Kaiser Franz Joseph, ständig angeregt von Emil Steinbach, in der Frage des allgemeinen Wahlrechts spielte. Krone und Volksbewegung brachten damals gemeinsam das Privilegienparlament zu Fall. Auch die Darstellung des Sturmjahres 1848 verschweigt, retuschiert, fälscht. Hier soll der Arbeiter als letzter Hüter des Feuers der Revolution vorgestellt werden. Alle haben ihn verlassen. Der Bürger bereits im Mai, der Bauer im August, jetzt im Oktober, beim bitteren Ende, auch der Student. Allein bietet der Arbeiter den Kugeln der Gegenrevolution Trotz. Ein heroisches Bild. Aber nur ein Bildl In Wirklichkeit: „Die Arbeiter und Studenten waren entschlossen, Wien bis zum letzten Atemzug zu verteidigen.“ So war es bisher bekannt, so berichtet es auch der bürgerlicher Geschichtsauffassung bestimmt nicht verdächtige Ernst Fischer *. Und 1918? Mit kühnem Schwung hat hier eine Hand beim Bild der Ausrufung der Republik vor dem Parlament rotweißrote Fahnen auf die Masten gesetzt. Die Arbeiterklasse als Garant der rotweißroten Republik gegen ihre Feinde! Zu schön, um im Jahre 1918 wahr zu sein. Otto Bauer berichtet als Zeuge ohne sonderliches Bedauern:
„Als zum erstenmal die rot-weiß-rote Fahne, die sich die Republik än Stelle der schwarz-gelben Fahne Habsburgs gab, auf den Fahnenmasten des Parlamentsgebäudes gehißt werden sollte, rissen revolutionäre Arbeiter die weißen Teile aus dem Fahnentuch heraus2.“
Es war die Tragik der ersten österreiduschen Republik und der Arbeiterklasse, daß sie nicht einmal in zwei Jahrzehnten zueinander gefunden hatten. Hier ist nicht der Ort, die Schuldfrage aufzuwerfen, sondern nur vor verzerrender Darstellung vieler Übel zu warnen. Der Tod der ersten parlamentarischen österreichischen Republik trug jedenfalls — im Gegensatz zu der Darstellung im Wiener Künstlerhaus — nicht nur den Heimwehrhut.
Das letzte Wort muß ein Wort des Bedauerns sein. Die Erwartungen, daß einmal Menschen ihre eigenen Ideen für so überzeugend halten, daß sie auch denen der Andersdenkenden Raum geben, ist wieder einmal um eine Hoffnung ärmer. Der Raster einer engen und engherzigen parteipolitischen Geschichtsdarstellung ist noch immer nicht gesprengt.
„Brüder zur Sonne, zur Freiheit!“
Zur Sonne, zur Freiheit, zum Lichte einer vom vergangenen Zwist unbelasteten Geschichtsschau ist es anscheinend noch ein gutes Stück Weg.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!