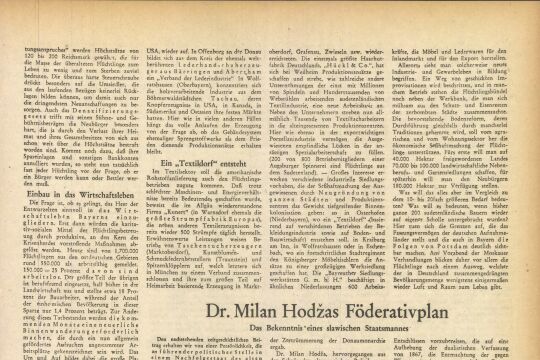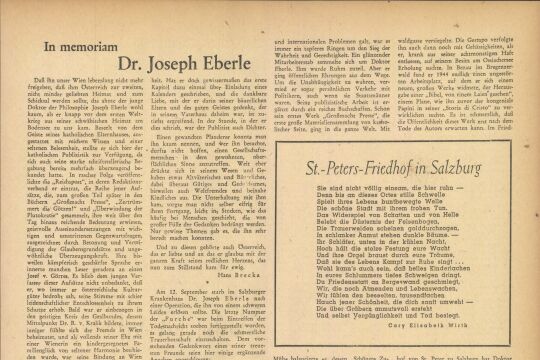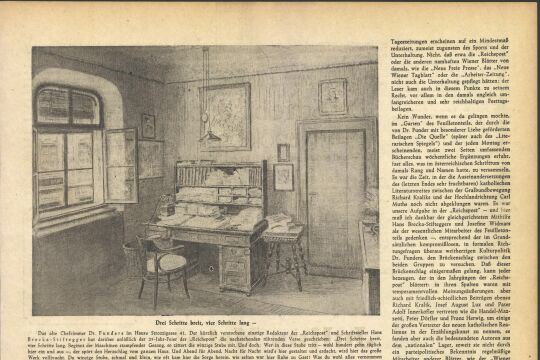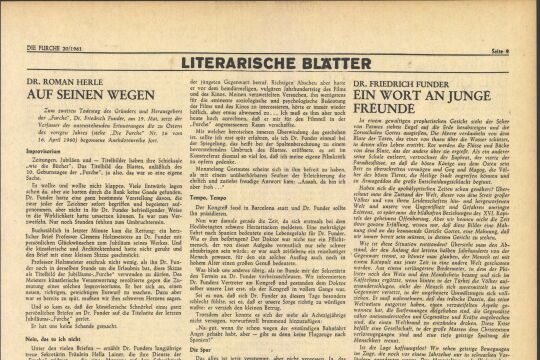In der „Furche“ vom 7. September 1954 erschien ein Leitartikel mit der Überschrift „Offener Brief an einen Editor in London“. Er war an die Londoner Wochenschrift „The Listener“, das Organ der BBC, adressiert, begann mit „Sir...“ und endete mit „ ... you sincerely Friedrich Funder“.
Der Inhalt war eine solid fundierte Antwort an den weder dem Österreich vor noch nach 1918 gewogenen englischen Historiker A. J. P. Taylor, der sich, quellenmäßig gestützt auf eine Publikation des italienischen Autors Luigi Albertini, mit dem Thema befaßte: „Konnte der Krieg 1914 bis 1918 abgewendet werden“, und der dabei besonders das Attentat von Sarajewo vom 28. Juni 1914 kommentierte. Darin hieß es:
„... Niemols war jemand imstande, zu zeigen, daß die serbische Regierung irgendeine Ver-~ bindung mit dem Komplott hatte... Ein einziger Serbe wußte um alles: Oberst Dimitrijevic oder Apis, wie er hieß... Obwohl er die Pläne billigte, leitete er sie nicht und gab ihnen keine ernstliche Unterstützung. Das Komplott war das Werk von sechs jungen, hochgesinnten nationalen Idealisten...“
Österreich aber sei es gar nicht um die Bestrafung des Attentates gegangen, sondern um die Bestrafung Serbiens wegen eines anderen Verbrechens, begangen durch sein bloßes Dasein als freier, nationaler Staat.
Wem kämen nicht tragische nahöstliche Parallelen aus jüngster Zeit in den Sinn, bei denen Hintergrund und Szenerie verschieden, aber Motive und Plädoyers der versuchten Verteidigung gefährlich ähnlich sind.
Wer Friedrich Funder kannte und sein Buch „Vom Gestern ins Heute“ gelesen hat, der weiß, daß ihn seit jungen Jahren das Nationalitätenproblem der alten Monarchie und hier vor allem das brennende Interesse an einer befriedigenden Lösung der nicht zuletzt durch den Dualismus von 1867 hoffnungslos verkorkten Lage der österreichischen und ungarischen Südslawen beseelte. Wie kaum ein anderer der führenden österreichischen Publizisten seiner Zeit war er um intensive persönliche Kontaktaufnahmen in den umstrittenen Gebieten bemüht, die ihn zu ausgedehnten Studienreisen in die Krisenhefde, so vor allem auch nach Bosnien und Dalmatien führten. Daher hatte ihn auch die unglückliche Wendung schwer getroffen, die der sogenannte Friedjung-Prozeß und im Zusammenhang damit die Presseklage gegen die „Reichspost“ im Jahr 1909 genommen hatten.
Seit 1907 hatte ein Konfident der Österreichisch-Ungarischen Gesandtschaft in Belgrad, der sich Milan Stefanovic nannte, von Beruf Philosophiestudent und angeblicher Sekretär eines Belgrader Klubs mit ausgeprägten großserbischen Tendenzen (Slovenski Jug), der Gesandtschaft laufend „Klubprotokolle“ geliefert, die diese an das Wiener Außenministerium weiterleitete. In diesen waren eine ganze Reihe von Abgeordneten der serbisch-kroatischen Koalition im Agramer Landtag aufs schwerste wegen ihrer Verbindungen mit Belgrad kompromittiert.
Als nach der Annexion von Bosnien und der Herzegowina im Oktober 1908 die Wogen der Leidenschaft aus Serbien über die Grenzen der Monarchie schlugen, veröffentlichte der bekannte Historiker und Publizist Dr. Heinrich Fried jung (Autor des „Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland“), seiner politischen Herkunft nach ein Deutschliberaler, in der „Neuen Freien Presse“ die Stefanovic-Dokumente, wobei deutlich zutage trat, daß die
Informationen vom Ballhausplatz stammten. Kurze Zeit vorher waren in der „Reichspost“ deutsche Ubersetzungen „serbischer Dokumente“ erschienen, die Dr. Funder aus der Militärkanzlei des Erzherzog-Thronfolgers erhalten hatte und die gleichfalls Landtagsabgeordnete der serbisch-kroatischen Koalition in Agram hochverräterischer Beziehungen bezichtigten. Die beschuldigten Abgeordneten klagten Dr. Friedjung und die „Reichspost“ mittels Presseklage, für die das Wiener Schwurgericht zuständig war. Für die „Reichspost“ erschien als Beklagter der verantwortliche Redakteur des Impressums. Im Zuge der Prozesse stellte sich heraus, daß der angebotene Wahrheitsbeweis nicht erbracht werden konnte, da die Echtheit der belastenden Dokumente mit Erfolg bestritten wurde. Dabei geht aus den mittlerweile veröffentlichten diplomatischen Akten hervor, daß die amtlichen Stellen zweifellos im guten Glauben gehandelt hatten. Anderseits ist auch die Tatsache erwiesen, daß eine einflußreiche großserbische Irredenta in Belgrad mit
Gleichgesinnten jenseits der Grenze laufend Verbindung hielt. Nachdem die belastenden Dokumente sich jedoch im Prozeßverlauf als Falsifikate herausstellten, wurden sie von Dr. Friedjung ebenso wie die darauf basierenden Anschuldigungen zurückgezogen; dies ermöglichte den Abschluß eines Vergleiches, der in Wahrheit von aller Welt als Sieg der Kläger betrachtet wurde.
Dr. Funder, der über die tatsächlichen politischen Verhältnisse genau Bescheid wußte, und als Zeuge vor Gericht sie auch ausführlich schildern konnte, trug schwer am internationalen, für Österreich durchaus ungünstigen Echo der Prozesse, wenngleich die Affäre in Belgrad selbst eher als ein Warnungssignal aufgefaßt wurde und zunächst nach außen hin sogar zu einer Mäßigung der antiösterreichischen Affekte führte.
Der dauernde Schaden für Österreich-Ungarn lag unter anderem darin, daß der einflußreiche englische Publizist und Spezialist für südslawische Fragen Seton Watson ins feindliche Lager wechselte; ferner auch in der Bestärkung der notorisch antiösterreichischen
Grundhaltung des Wiener „Times“-Korrespondenten Wickham Steed, der die öffentliche Meinung in England stark zu beeinflussen imstande war.
Friedrich Funder, der zu den führenden katholischen Publizisten deutscher Zunge zählte, kämpfte sein Leben lang für eine Korrektur des vielfach verzerrten Österreichbildes, ohne sich den Erkenntnissen der neuen Zeit und ihren Geboten zu verschließen. Er Ist zeitlebens ein Kämpfer für Österreich in seinen verschiedenen geschichtlichen Wandlungen geblieben, ohne sich jemals dem Verdacht eines billigen Opportunismus auszusetzen. Nach der heutigen Begriffsdeutung, die von der Polarisierung der Gegensätze geformt ist, gehörte er bestimmt zu den Konservativen, aber nicht nach jener der Jahrhundertwende, als er sich den Rufern im Streit um die christliche Sozialreform zugesellte und konservativ für einen viel enger gezogenen Parteibegriff stand. Niemals aber in den fast 87 Jahren seines Lebens wurde er zum „Nachtwandler, der rückwärts geht“, wie Franklin D. Roosevelt den Reaktionär definierte.
Der impulsive Feuergeist mochte vielleicht als Chef und Referent in Grundsatzfragen nicht immer bequem sein. Seine brillante, zuweilen gefürchtete, aber nie verletzende Feder mochte ihm zuweilen Gegner schaffen, obzwar er kaum persönliche Feinde hatte. Als Fanatiker der Sprachreinheit und des sauberen Stils konnte man ihn mutatis mutandis dem ansonsten in gänzlich anders gearteten literarischen Regionen angesiedelten Karl Kraus vergleichen. Als Vollblutjournalisten könnte man ihn seinem großen Widerpart und Antipoden Friedrich Austerlitz gegenüberstellen, einem anderen Meister der Feder, dem Funder in seinem Erinnerungsbuch des Epitheton Friedrich der Streitbare zulegt, das er auch für sich in Anspruch nimmt.
Schließlich war er einer der wenigen seiner großen journalistischen Wiener Zeitgenossen, von Moritz Benedikt (t 1920), Friedrich Austerlitz (t 1931) bis Karl Kraus (t 1936), der im heutigen Österreich, und zwar als Steirer geboren war.
Von 1902 bis 1938 war die „Reichspost“ in den Augen der Öffentlichkeit schlechthin Friedrich Funder, so wie es von 1945 bis zu seinem Tode (1959) die „Furche“ war. „Reichspost“ und „Furche“ waren Friedrich Funder, wie seine Zeitgenossen und die jüngere Generation ihn kannten.
Mit 24 Jahren war er nahezu mittellos in ein mittelloses junges Unternehmen, eben die „Reichspost“ eingetreten (Juli 1896); schon im Alter von 30 Jahren (1902) wurde er deren Chefredakteur, zwei Jahre später (1904) auch deren Herausgeber und diente fortan im gleichen Rahmen der Sache, an die er glaubte, bis zunächst das bittere Ende kam (1938). Fürwahr ein seltener Fall, wie er sich später kaum wiederholte und der heutzutage kaum denkbar ist; vielleicht auch nicht mehr wünschenswert; die Zeiten haben sich geändert. Beim letzten großen Wandel der Dinge — 1945 — trat ihm kaum ins Bewußtsein, daß er mittlerweile 73 geworden war; „der alte Funder“ in des oft gebrauchten Wortes mehrfacher Bedeutung.
„... Der neue Slogan ist: das Recht der Jugend; und unter diesem Titel beanspruchen viele Leute, die nicht Jugend, sondern erheblich älter sind, für sich das Privilegium, auf die Erfahrungen derjenigen, die älter sind als sie, verzichten zu können. So habe ich mich ganz in die arbeitsame Häuslichkeit unserer Redaktion zurückgezogen, einer Gemeinschaft trefflicher Leute, die voll tiefer Harmonie ist, gebildet von Menschen, von denen jeder ein tüchtiger Könner ist, und sehe lächelnd dem großen Getue draußen auf der Straße zu...“
(Aus einem Brief Dr. Funders vom 1. August 1949 an den Verfasser dieser Zeilen.) Acht Jahre später, 1957 — Friedrich Funder stand nun im 85. Jahr seines Lebens — kam er mündlich auf das Thema zurück, ohne Schärfe und aus seiner reichen Erinnerung schöpfend: „Es war doch eigentlich immer schon so; wir waren nicht anders; auch müßte man sich abgewöhnen, alles über einen Leisten zu schlagen. Es hat immer schon Alte und alte gegeben, wie es Junge und junge gibt.“ Er selbst wisse wohl um die Bürde des Alters, auch wenn er sie lange nicht wahrhaben wollte; nun bitte er nur um die Gnade, das noch vollenden zu dürfen, woran er gewiß nicht leichten Herzens, dem Drängen vieler Freunde folgend, gegangen sei. Wenn es ihm gelänge, durch sachliche Darstellung die Gegensätze zu mildern — „wir alle haben Fehler gemacht“ — und dazu beizutragen, daß wie in anderen Ländern, denen die Geschichte ähnliche Prüfungen wie uns nicht ersparte, die Wunden sich schließen, dann wäre dies der Lohn, den er sich wünsche. Damit meinte er den zweiten Band seiner Erinnerungen: „Als Österreich den Sturm bestand“, dessen Auslieferung in wenigen Monaten zu erwarten stand.
Dies war nun im Juli 1957, somit nach neunzehn Jahren die erste Wiederbegegnung mit dem zum verehrten Patriarchen gewordenen Weggefährten vergangener Jahre, und es sollte das letzte Gespräch mit ihm gewesen sein.
Die Szenerie allein ist nicht leicht zu vergessen. Um die Anhöhe von St. Anna bei Schwanberg dem Urlaubssitz Dr.““ Funders, '“breitete sich die weite steirische Landschaft, vom welligen Mittelgebirge begrenzt, und atmete fern allen lärmenden
Touristenbetriebes, Ruhe, Frieden, Besinnlichkeit.
Unwillkürlich kam das Gespräch auf die letzten und noch • früheren Begegnungen von 1927 bis 1938, zumeist in Wien, im Parlament, am Minoritenplatz, Ballhausplatz, in der Strozzigasse... Auch noch viel früher, wie sich bei der Lektüre „Vom Gestern ins Heute“ herausstellen sollte. Dabei hatte es sich allerdings nicht wörtlich um Begegnungen, eher um gelegentliche enge räumliche Nachbarschaft gehandelt, so wenn der damals 45 Jahre alte Dr. Funder und der damals 19 Jahre alte Verfasser im März 1917 an der südlichen Karstfront, der eine in Brestovizza, der andere wenige Kilometer westlich davon in Jamiano und dann in den Dolinen und Kavernen der Hermada die spannungsgeladene Zeit vor der zehnten Isonzoschlacht erlebten.
Und nun war 1957. Dr. Funder sah wie eh und je mit völlig klarem Blick und ungebrochenen Muts in die Zukunft. Optimist — nein, zutiefst gläubiger Mensch, der er immer gewesen war. Zwar waren die turbulenten sechziger Jahre, die er nicht mehr erleben sollte, noch in einiger Ferne. Aber sie warfen doch schon da und dort ihre Schatten voraus. Es kam, wie es kommen mußte: der Einfluß Amerikas und mancher seiner großen Hohen Schulen begann sich bemerkbar zu machen. Neue Disziplinen schufen ein neues Vokabularium, das wie jene, die sich seiner bedienten, vorerst an Klarheit und Verständlichkeit einiges zu wünschen übrig ließ. Eines war offensichtlich: daß mit den Tabus der Vergangenheit, den wirklichen und den vermeintlichen, aufgeräumt werden sollte, daß ein neues Menschen- und Gesellschaftsbild entstand; daß um der Menschenrechte willen Rebellion, gewaltsam oder gewaltlos, groß geschrieben wurde; daß auf allen Gebieten des sozialen und kulturellen Lebens Schockieren und Provozieren auf der Tagesordnung stand. Daß es letzten Endes um den entscheidenden Akt des Protests gegen bestehende Ordnung, zumal die internationale Ordnung ging. All dies begann sich in zunehmender Deutlichkeit abzuzeichnen, und zwar, wie zugegeben werden muß, nicht ganz grundlos. Denn es hatte sich herausgestellt, daß die neue internationale Ordnung, wie sie nach dem Kriege 1945 geschaffen wurde, in Wahrheit keine Ordnung war, zumindest nicht auf die Dauer. Damit war man wieder dort, wo die Welt schon in den zwanziger Jahren stand. Was zunächst eine vielversprechende neue Lösung schien, die UNO, die regionalen Verträge, die Auflösung der Kolonialherrschaften und die Emanzipation der Dritten Welt, hatten nicht gehalten, was man sich von ihnen versprechen mochte. Es gab keine Institutionen und keine Werte, an denen eine neue Zeit mit ihren Menschen und ihrer revolutionären Grundstimmung nicht zu rütteln begann.
Im sommerlichen St. Anna des Jahres 1957 war von den Sturmzeichen wenig zu verspüren, die in aller Welt, diesmal mehr vom Westen (Kalifornien) als vom Osten (den kommunistischen Imperien) her, an den Nervensträngen zu zerren begannen. Seither hat sich wieder vieles in der Welt gewandelt und Friedrich Funder, wäre er noch bei uns, würde dieser Tage seinen hundertsten Geburtstag feiern. Die nicht allzuvielen aus seiner Zeit, die übrig blieben, und viele, die nach ihm kamen, suchen aus diesem Anlaß in ihren Gedanken aufs neue Kontakt mit ihm und möchten gerne ergründen, wie er auf die Sorgen und Probleme von heute — dreizehn Jahre nach seinem Tod — wohl reagierte. Könnte er antworten, würde sein Brief, gemessen an dem, was er zu seinen Lebzeiten dachte, sagte und schriftlich niederlegte, wohl ungefähr so lauten:
Teure Freunde! ... Es ist wohl so, daß von drüben gesehen, also jenseits von Zeit und Raum, alles anders aussieht als in der Perspektive eines Menschenlebens, und wenn ihm noch so lange Dauer geschenkt war. Ihr klagt über den wachsenden Unmut und den fehlenden Willen vieler, sich in eine Welt hineinzufinden, die gänzlich verschieden ist von der, die man sich nach der letzten großen geschichtlichen Cäsur, 1945, erwartet hat. Ihr sagt, daß zumal die, die nachher geboren sind, vielfach in Ungeduld nach der endgültigen besseren Lösung drängen.
Eine bessere ist immer denkbar. Jedoch zu glauben, daß es jemals eine endgültige geben könnte, darin liegt und lag unser aller Irrtum. In der Wahl des richtigen Zeitpunktes, den schrittweisen Übergang einzuleiten, liegt die Schwierigkeit. Sein Versäumnis führt zum Spiel mit und schließlich zur Auslösung von Revolutionen, die entweder sich durchsetzen oder, wie die Erfahrung zeigt, besiegt und damit auf ein Menschenalter oder auf noch viel länger vertagt werden. Die Revolution als solche ist so alt wie die Staatengeschichte. Aus der Sicht seiner Zeit hat schon Aristoteles über ihre Gründe berichtet.
Zunächst ist die Revolution immer ein Unglück und bringt nur ganz selten eine wirkliche Lösung.
Wem ein langes Leben beschieden war, der lernte, daß wir stets in einer Zeit des Übergangs leben, auch wenn wir es manchmal nicht wahrhaben wollen.
Vor hundert Jahren, 1872, begann man die Bismarck-Monumente zu bauen zum Gedenken an ein Werk, das für die Ewigkeit bestimmt schien. Im gleidienjahr wurde das Dreikaiser-Bündnis geschlossen. Ein knappes Menschenalter später verschob der russisch-japanische Krieg die Gewichte. Wir haben 1914, 1918,
1938, 1945 und schließlich das glückliche Jahr 1955 erlebt; alles Jahre, die erst aus der Distanz betrachtet ihre volle Bedeutung in unserem Denken erlangen. Jedes einzelne von ihnen bedeutet Ende und Anfang. Und jedes einzelne ist nur voll zu verstehen, wenn man mindesten ein Menschenalter vorher schon bewußt auf der Welt war.
Wir haben das Konzert der Großmächte erlebt — ihrer war etwa ein halbes Dutzend — und wissen, was daraus wurde. Dann saßen im Durchschnitt etwa fünfzig Nationen im Genfer Völkerbund beisammen. Und jetzt zählt die Vollversammlung der UNO, hundertdreißig gleichberechtigte souveräne Nationen. Wer hätte vor hundert Jahren von dieser Entwicklung geträumt, die neben vielem Unzulänglichen auch ihre guten Seiten hat, wenn sie eben nicht als Endstation betrachtet wird.
Die Aufgabe, die ich mir in meinen letzten Lebensjahren setzte, war „mit der großen Geschichtslüge, die Österreich überschattet, durch eine überzeugende, objektive Darstellung Schluß zu machen. Dabei muß man sich immer wieder überzeugen, daß es der jüngeren Generation schwer fällt, sich in die Gegebenheiten der damaligen Situation zu versetzen, die ja so viele unmeßbare psychologische Quellen hat... Die österreichische Jugend ist mit vielem Schweren beladen, aber zeigt Vorzüge, mit denen sie meiner Generation weit voraus ist.“
Es ist schon immer so gewesen, daß bisweilen das richtige Augenmaß verloren ging. Aber dies war nie eine Dauererscheinung. Jeder Übertreibung und jeder Geschmacksentgleisung folgte über kurz oder lang noch immer der Rückschlag des Pendels; jedem Rausch die Ernüchterung. Das riskante Wagnis unbegrenzten Tolerierens liegt darin, daß dieses sich früher oder später von selbst ad absurdum führt und dann leicht in sein Gegenteil umschlägt. Damit aber drehen sich auch die gesellschaftskritischen Fahnen — zum wievielten Male? — nach dem Winde.
Das alles haben die Alten schon früher erlebt einschließlich gelegentlicher Erdbebenstöße, wo solche am wenigsten erwartet und am schmerzlichsten empfunden wurden, nämlich im kirchlichen Bereich. Im Jahre 1901 etwa hat es eine Art österreichischen Klerustag in Wien gegeben, ohne Einladung und Präsenz, ja zum Mißvergnügen der Bischöflichen Ordinariate; die Differenzen zwischen dem hohen und niederen, dem alten und jungen Klerus, allerdings nicht aus dogmatischen Gründen — aber auch der Widerstreit der Theologen, spielten damals eine nicht zu übersehende Rolle. Reformkatholizismus und Modernismus sind Begriffe, die den Altösterreichern -seit dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts geläufig sind wie Josephinismus und Staatskirchen-tum.
Das alles ist längst Geschichte. Auch die heutige Zeit mit ihren aktuellen Problemen wird bald Geschichte sein, einschließlich ihrer modischen, sprachlichen, literarisch-dramaturgischen Experimente und überhaupt ihrer zeitgebundenen Version der schönen Künste.
Im übrigen: „in gewissen Lagen, wenn man seiner eigenen Sache sicher ist, wird Schweigen die beste Parade“...
Soweit der Brief von drüben. An seinem Ende aber stünde wie eh und je — auch dieser Geschichte:
In alter Treue,