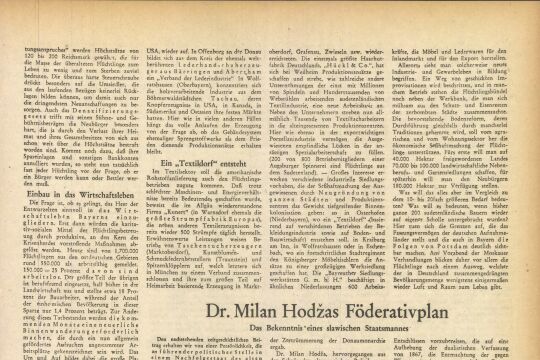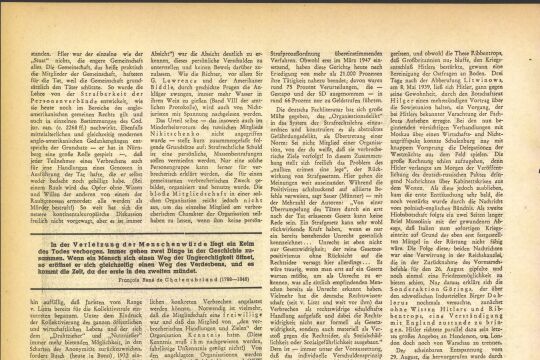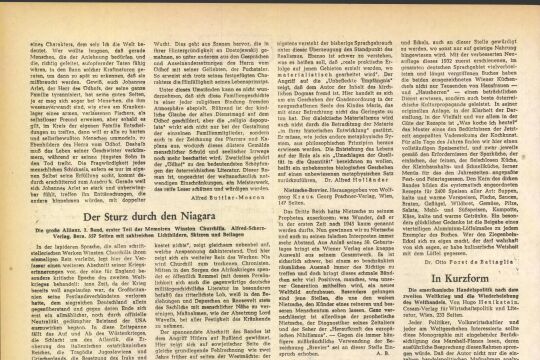Anfang September ging in Abidjan (Elfenbeinküste) die sechste Weltfriedenskonferenz (World Peace Through Law) zu Ende; unter amerikanischer Führung forderten 2500 Juristen aus 123 Nationen in 41 Resolutionen einmal mehr ein allgemeines Kriegsverbot und obligate friedliche Beilegung aller internationalen Konflikte, Atomwaffen-Stop und -Kontrolle, sowie Verzicht auf jede Form der Gewaltanwendung oder -drohung. Genau das gleiche Anliegen, nämlich irrationalem Kurzschluß durch rationale Prävention zu begegnen, hatte schon die Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907 beschäftigt; nach 1918 den Völkerbund; nach 1945 die UNO.
Auch die Ältesten unter uns entsinnen sich keiner Zeit, in der nicht in allen Sprachen, unbeschadet der Staatsform und des Gesellschaftssystems, von Rüstungskonferenzen zu ebener Erde und von der Dringlichkeit hoher Verteidigungsausgaben im ersten Stock die Rede war. Mittlerweile machte in unseren westlichen Metropolen ein neuer Bestseller seinen Weg: die kleine rote Bibel („Worte des Vorsitzenden Mao Tse-tung“). Darin der lapidare Satz: „Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen“, und an anderer Stelle: „Die Kriege teilen sich in zwei Arten: in gerechte und ungerechte Kriege; alle Kriege, die dem Fortschritt dienen, sind gerecht; die den Fortschritt behindern, sind ungerecht ... Ein ungerechter Krieg war zum Beispiel der Erste Weltkrieg..., er wurde auf beiden Seiten für imperialistische Interessen geführt... “ (Probleme des Kriegs und der Strategie, ausgew. Werke, Bd. II, 1938).
Die ganze Problematik von Angriffs- und Verteidigungskrieg; Bündnissen und Gleiohgewichts-theorie; Präventivaktion und Notwehrüberschreitung; das Unwiderrufliche der in Panikstimmung geöffneten Schleusen; die blutige Alternative zwischen dem, was für restlose Macht und dem, was für machtloses Recht gehalten wird, und die zur Eskalation des Terrors im Antiterror führt, — das alles ist mit anderen Vorzeichen schon aus Thukyd'ides und der Geschichte des attisch-delischen und des pelopon-nesischen Bundes bekannt; in neuerer Zeit aus dem Kaleidoskop der Allianzen der letzten 400 Jahre. Wir Mitteleuropäer der letzten drei Generationen haben es besonders anschaulich erlebt in der euphorischen Stimmung der Friedensnobelpreise und dem Schock der Kriegs-manifestos. Dem Österreicher fällt dazu Bertha von Suttner (1843 bis 1914) ein — und im Zusammenhang mit dem 28. Juli 1914 Kaiser Franz Joseph; Kants unsterbliches Ideal vom ewigen Frieden (1795) und seine Distanz zur geschichtlichen Wirklichkeit.
In der Tat, es wird bald 60 Jahre her sein seit dem Juli 1914.
Daran erinnert der stattliche Band „Theorie und Realität von Bündnissen; Heinrich Lammasoh, Karl Renner und der Zweibund (1897 bis 1914)“ des Wiener Ordinarius für Völkerrecht und ehemaligen a. o. Botschafters und zünftigen Diplomaten Stephan Verosta. Er wurde zum 50. Jahrestag des Todes Heinrich Lammaschs (6. Jänner 1970) geschrieben und verdient gerade in besinnlicher Erinnerung an das wohl entscheidendste Datum unserer jüngeren Geschichte besondere Beachtung. Es handelt sich dabei um eine sorgfältig bearbeitete und dokumentarisch belegte Analyse des Zweibunds Donaumonarchie—
Deutschland mit Einbeziehung des historischen Hintergrunds und detaillierter Zeichnung und Wertung des außen- und innenpolitischen Rahmens, um politische Porträts von handelnden Persönlichkeiten, kritisch akzentuiert aber niemals verzerrt gezeichnet, und um das wissenschaftliche Hauptanliegen, den völkerrechtlichen Stellenwert des Bündnisses und seines tragischen
Ausgangs. In 21 übersichtliche Kapitel gegliedert, mit reichhaltigem Anhang, ist das Buch dank seiner spannenden und klaren Diktion und trotz seines stellenweise brisanten Inhalts — dies soll nicht verschwiegen werden — leicht zu lesen. Es bringt manches Neue und erhärtet Geahntes; auch für den, der dem Autor in der Begründung seiner Thesen nicht immer zu folgen vermag, ist die spannende Lektüre wertvoll, weil sie zum Nachdenken, bisweilen auch zum Umdenken anregt; immer vorausgesetzt, man ist nicht mit Hegel der pessimistischen Meinung, daß Geschichte uns lehrt, daß wir nie daraus etwas lernen.
Im vestigiis Heinrich Lammaschs, des großen Völkerrechtsgeslehrten, Humanisten und großösterreichi-
sehen Patrioten, ist auch Stephan Verosta keineswegs der Auffassung, daß das alte Österreich überlebt, zum Uafcesgaag verurteilt und nicht erhaltenswert gewesen wäre. Sein Gedankengang erinnert an Wildgans („Rede über Österreich“):
„... denn es erscheint als eine allzu leicht hingenommene Behauptung, daß der frühere Nationalitätenstaat in seinen Grundfesten morsch und als solcher unmöglich gewesen wäre. Unmöglich war er bloß als Schwerthelfer der Germanentums und vor allem als solchem wurde ihm auch ein Untergang von seltener Grausamkeit bereitet...“
Verosta steht in seinem Rückblick dem Bündnis der Donaumonarchie mit dem Deutschen Reich von Anbeginn an kritisch gegenüber. Er sieht in ihm — völlig richtig — die Folge der Bismarckschen Gewaltlösung von 1866 und des folgenden öster-reichisoh-'ungarischen Ausgleichs von 1867. Daraus ergeben sich für ihn zwei weitreichende Konsequenzen: einmal daß aus der früheren Großmacht Österreich eine „völkerrechtliche Realunion Österreichs mit Ungarn“ geworden sei, wobei im Grunde beide Staaten eigene Völkerrechtssubjefcte bildeten in einer „Monarchie auf Kündigung“. Daher sei zweitens das Bündnis Bis-marck-Andrässy von Haus aus in Wahrheit ein Dreibund gewesen, nämlich Deutschlands mit Österreich und Ungarn. Es habe keinen wirklichen Mittelpunkt (Wien) mehr gegeben; die Donaumonarchie sei politisch eine Ellipse mit zwei Brennpunkten gewomden. Als Folge davon wurde Berlin automatisch das Zentrum des Bündnisses und Österreich hatte die Rolle des schwächeren Partners zu spielen. Wenngleich nun das Bündnis zu Beginn ausschließlich defensiven Charakters war, änderte sich im Laufe der Jahrzehnte die europäische politische Lage — und damit, wenn auch uneingestandenermaßen, das politische Fernziel der Bündnispartner. Während die Donaumonarchie den Status quo vertrat und sich mit Selbstbehauptung begnügte, wurde es das deutsche Ziel, zur Weltmacht aufzurücken: damit aber war das klare Risiko von Kollisionen ver-
bunden. Der ursprüngliche Defensivbund erhielt, ohne dies auszusprechen, de facto offensiven Charakter, und zwar durch den führenden deutschen Partner, dem sich die österreichisch-ungarische Militärdiplomatie (Generalstabschef Conrad) wohl oder übel beugte.
Speziell die Generalstabsabmachungen von 1909 hätten völkerrechtlich ein neues offensives Bündnis bedeutet; denn in diesen habe Conrad, wenn auch widerstrebend, den Schlieffenplan des deutschen Generalstabs (1906) angenommen, der die rasche Niederwerfung Frankreichs durch Umklammerung vorsah, und zwar unter Verletzung der völkerrechtlich festgelegten Neutralität Belgiens und Luxemburgs. Bis zur Niederwerfung Frankreichs im vorgesehenen Zweifrontenkrieg hatte Österreich-Ungarn die Hauptlast des Kampfes gegen Rußland zu tragen. Damit aber sei die Abhängigkeit Wiens von der Strategie des stärkeren Bündnispartners offensichtlich geworden.
Verosta schließt daraus, immer mit dem Blick auf das zentrale Anliegen der Friedenssicherung, daß es für Österreich-Ungarn richtiger gewesen wäre, auf Großmachtpolitik überhaupt zu verzichten und sich mit der Rolle einer neutralen europäischen Mitteknacht zu begnügen. Diese Meinung mit allen ihren Konsequenzen vertrat auch nachdrücklich Karl Renner, dessen Pazifismus wie der des Völkerrechtlers Heinrich Lammasch in echter Uberzeugung wurzelte und sich von utopischer Übertreibung fernhielt; leider hatten Renners konstruktive Ideen zur Lösung des Nationalitätenkonflikts in den nationalen Lagern zuwenig Beachtung gefunden. Im übrigen sah er die Wurzel aller österreichischen Übel in der „Hausmachtpolitik“ und deren Großmannssucht, vertrat den Standpunkt, daß „wir für Österreich eine Großmachtpolitik überhaupt nioht brauchen“ und wandte sich in scharfer Kritik gegen alle Rüstungen zu Lande und besonders zur See (den „Marinismus“). Heinrich Lammasch war anderer Meinung. Nicht hinsichtlich der engen Bindung an Deutschland, der er als konsequenter Vertreter einer gesamteuropäischen Friedenspolitik kritisch gegenüberstand; aber er glaubte an die Großmaohtsendung der Donaumonarchie und „stellte durchaus vertretbare, ganz realpolitische, geradezu maehtpolitisehe Überlegungen in ihrem Interesse an“ (S. 408). In seinem außenpolitischen Memorandum an den Thronfolger, vom 24. November 1912 plädierte Lammasch ausdrücklich mit Rücksicht auf die Mittelmeerlage für die notwendige und wünschenswerte Stärkung der Kriegsmarine (S. 632).
Übrigens verweist auch Verosta verschiedentlich auf die Rolle des Thronfolgers Franz Ferdinand, der in den kritischen Jahren von 1908 bis zu seinem Tod konsequent um die Erhaltung des Friedens besorgt war und wiederholt der „Kriegspartei“ entgegentrat.
die Besetzung Belgrads als Faustpfand — bis zur Regelung des Streitfalls durch eine internationale Konferenz.
Allerdings war bereits am 25. Juli 1914 die serbische Mobilisierung erfolgt, darauf die österreichischungarische Teilmobilisierung gegen Serbien, am 28. Juli die Kriegserklärung, und bereits tags darauf die russische Teilmobilisierung gegen Österreich-Ungarn. Die Lawine war ins Rollen gekommen; alle späteren Spekulationen, ob das Verhängnis aufgehalten werden konnte, bleiben problematisch; insbesondere auch die Frage, ob militärische Repressalien gegen Serbien statt formaler Kriegserklärung etwas ändern hätten können.
Wohl aber zeigte sich, daß die Automatik der Bündnissysteme den Krieg auslöste, den niemand wollte und in den man in allen Hauptstädten hineinglitt (Lloyd George). An ihrem Anfang stand der Zweibund, der in seiner Theorie den Frieden zu erhalten bestimmt war, aber in seiner Realität, wenn auch gänzlich ungewollt, zum Weltkrieg führte. Daher war er, in der Rückschau betrachtet, ein Irrtum.
angeprangert wurden, gehört auf ein anderes Kapitel und kann die österreichische Diplomatie nicht von dem Makel der formalen Rechtswidrigkeit ihres Vorhabens befreien.
Es ergibt sich ein anderes Bild, wenn rückprojiziert auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg die Begriffe von Offensiv- oder Deffensivbünd-nis, aber auch unprovozierter Angriffskrieg und Aggression zur Debatte stehen.
Der ursprüngliche Zweibund war als Sicherung gegen einen möglichen russischen Angriff geschlossen. Lammasch, der den Gedanken der Nützlichkeit der österreichischen Großmachtstellung in Europa vertrat, war keineswegs aus antideutschen Affekten gegen das Bündnis. „Er hat niemals die Donaumonarchie in einer Kaunitzischen Allianz gegen Preußen-Deutschland gesehen“ (S. 290); aber er war im Prinzip gegen militärisch-politische Bündnisse, daher auch gegen die Verlängerung des Zweibundes; an dessen Stelle schlug er den Bund der friedliebenden Nationen vor, in dem das Donaureich als eine Art monarchischer Schweiz dem inneren und äußeren Ausgleich zu dienen berufen war. ,
Die Lage hatte sich grundlegend verändert, als mit dem englisch-russischen Vertrag (1907) und dem vorhergehenden russisch-französischen und englisch-französischen Einvernehmen die Mittelmächte sich neuen Problemen gegenübersahen. Die Generalstabsabmachungen (1909) zwischen Moltke und Conrad waren weder ein neuer Vertrag, noch verstießen sie gegen das Völkerrecht; sie hatten Absprachen über die gemeinsame Strategie im Fall des Zweifrontenkrieges im Osten und Westen zum Gegenstand. Mit einem solchen war infoige des Bestehens der Triple-Entente zu rechnen. Nun hatte man sich allerdings auf den Schlieffen-Plan geeinigt, der eine rasche Niederwerfung Frankreichs vorsah. Daß der österreichische Generalstabschef von der deutschen Absicht, das neutrale Belgien und Luxemburg zu überrennen — im Rahmen dieses Schlieffenplans — informiert worden wäre, ist nicht erwiesen und zudem nicht wahrscheinlich1. Das Bündnis blieb weiter für den Fall eines russischen Angriffs gedacht, wobei allerdings damit gerechnet werden mußte, daß Frankreich nicht abseits stehen würde; damit aber war die Auslösung der Bündnisautomatik vorhersehbar.
Es kann sich hier nicht darum handeln, ob die österreichische Initiative im Juli 1914 politisch richtig oder falsch war; nur darum, ob sie dem damals geltenden Völkerrecht entsprach, oder ob es sich bei der Kriegserklärung um Aggression, also unprovozierten Angriff gehandelt hat. Unbestritten ist, daß Österreich-Ungarn Grünide für eine Repressalie gegen Serbien ins Treffen führen konnte. Die Faustpfandtheorie (Besetzung Belgrads) scheiterte an den Einwänden der Militärs, die eine solche ohne Mobilisierung für zu riskant erachteten2. Außerdem war nicht vorauszusehen, ob ein Krieg damit verhindert werden konnte. Gewiß, ein brutaler Raubkrieg wäre auch damals schon völkerrechtswidrig gewesen. Nun war aber klargestellt, daß Österreich nicht an Eroberung und Gebietserwerb dachte, sondern nur an die eigene Sicherung. Die Ausweitung des Kriegs aber ist doch wohl der unmittelbar folgenden Mobilisierung Rußlands und der Automatik der Bündnisverträge auf beiden Seiten anzulasten.
Womit nur neuerdings bewiesen ist, daß die politisch-militärischen Bündnisse ein Verhängnis waren, das, wie wir heute in der Rückschau wissen, im Juli 1914 kaum noch vermeidbar gewesen ist. Was unsere Generation gelernt haben müßte, ist, daß ein Krieg keine Lösung bringt; er
„ist zuerst die Hoffnung, daß es . einem besser gehen wird, hierauf die Erwartung, daß es dem anderen schlechter gehen wird, dann die Genugtuung, daß es dem anderen auch nicht besser geht und hernach die Überraschung, daß es beiden schlechter geht“ (Karl Kraus, Aphorismen aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg).
Trotz und vielleicht gerade wegen der Anregung zu mancher Debatte im einzelnen zeichnet Professor Verostas Buch ein Bild des alten Vaterlandes mit all seinen Vorzügen und Schwächen, mit dem sich der Österreicher von heute befassen sollte. Bei aller manchmal scharfen Formulierung entsteht nie der Eindruck, daß es sich um eine jener historisch-politischen Anatomien handelt, die, wie es leider bei Österreich-Büchern bisweilen der Fall ist, bewußt oder unbewußt, der üblen Nachrede dienen. Die Kritik wird nie zur Karikatur. Der gelernte Österreicher, zumal wenn er die letzten Jahre der Monarchie noch aus eigenem Erleben kennt, wird das Buch zu jenen zählen, die er schwer aus der Hand gibt.
„THEORIE UND REALITÄT VON BÜNDNISSEN; HEINRICH LAMMASCH, KARL RENNER UND DER ZWEIBUND, 1897—1914.“ Von Stephan Verosta. Europa-Verlag Wien, SS. 660, mit Anmerkungen, Anhang und Personenregister.
Verosta befaßt sich ausführlich mit der Annexionskrise von 1908 und spart nicht mit scharfer Kritik an der Politik Aehrenthals, dem er Vertragsbruch und eklatante Verletzung des Völkerrechts vorwirft.
Um eine solche hat es sich in seiner Sicht auch bei der Kriegserklärung an Serbien vom 28. Juli 1914 gehandelt. Sie habe zu einem vom Völkerrecht verbotenen Aggressionskrieg geführt. Dabei sei Österreich-Ungarn infolge der provokati-ven Politik Serbiens zu einer völkerrechtlichen Sanktion, also einer Repressalie durchaus berechtigt gewesen; Lammasch hat den Angriff auf Serbien völkerrechtlich später als Repressalienexzeß bezeichnet (S. 464).
Unter vertretbarer Repressalie war die Möglichkeit einer räumlich und zeitlich begrenzten militärischen Blitzaktion im Gespräch; etwa
Gerade aus völkerrechtlicher Perspektive verschieben sich in der Rückschau manche Akzente. Auf der zweiten Haager Konferenz (1907) ist es bekanntlich in wichtigen Fragen der Friedenssicherung, darunter auch der Abrüstung, zu keiner Beschlußfassung gekommen. 1897 bis 1914 war eine Zeit, die weder Völkerbund, noch Kriegsächtungspakt, noch Vereinte Nationen kannte; daher auch keine rechtlichen Verpflichtungen, wie sie die heutige internationale Organisation ihren Mitgliedern auferlegt. Die Annexion Bosniens (1908) hat zu internationalen Protesten geführt, weil sie zwar nioht dem Sinn aber dem Wortlaut des Berliner Kongreß-Protokolls, also eines internationalen Vertrags, widersprach. Damit war der politische Akt formal völkerrechtswidrig gewesen — bis zu seiner bald nachfolgenden Sanierung. Daß es andere Annexionen (Burenkriege, Bulgarien, Italien) gegeben hat, die, wie auch Verosta ausführt, nicht als Rechtsverletzung