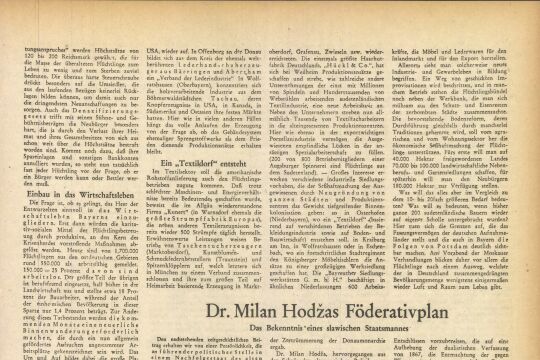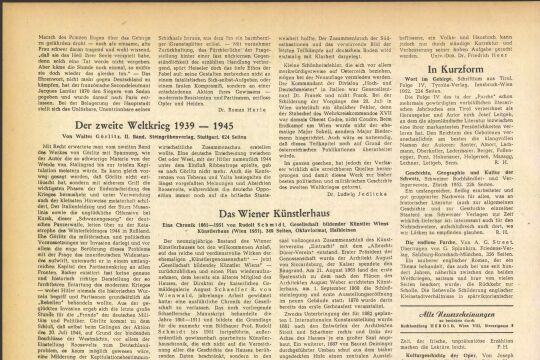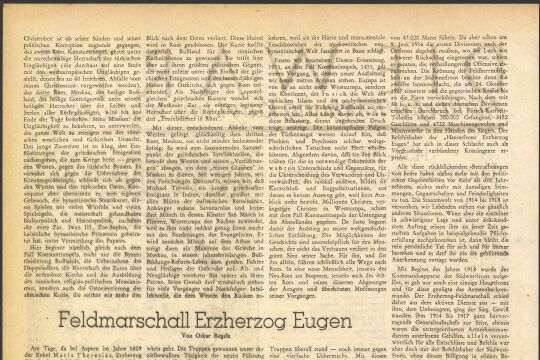Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Dreibund
Das „Österreich-Archiv“ hat sein dankenswertes Vorhaben, der österreichischen Geschichtsschreibung zu dienen, bisher mit bestem Erfolg erfüllt, seine Publikationen werden von jedem begrüßt, für den Österreich nicht erst 1918 oder gar erst 1945 beginnt. Die jüngst erschienene Arbeit Fritz Fellners, „Der Dreibund“, ist ein Teilergebnis umfangreicher Forschungen über die diplomatischen Beziehungen Österreich-Ungarns zu Italien; hier wird auf neunzig Seiten ein erschöpfender Überblick über Wesen und Wandel des Dreibundes in den 33 Jahren seines Bestandes geboten. An den großen Zügen der Bündnisgeschichte ändert sich wohl nichts mehr, doch erscheint das Bündnis durch Betrachtung vom Standpunkt aller drei Partner mehrfach in neuem Licht. Das Ergebnis der Untersuchungen läßt sich dahin zusammenfassen, daß alle Teilhaber selbstverständlich bestrebt waren, ihre eigenen Interessen in den Vordergrund zu rücken, und daß sie in bemerkenswerter Aktionsfreiheit neben dem geltenden Pakt auch andere Bindungen eingegangen sind. Österreich-Ungarn, seiner Natur nach vorwiegend passiv, wurde mit den Jahren der leidtragende Teil, da sich Italien eine Wien beeinträchtigende Einflußnahme sicherte, weshalb der Autor auch nicht mit reichem Tadel an den Außenministern Kälnoky und Goluchowski spart. Nach Bismarcks Rücktritt lag das Schwergewicht der europäischen Politik nicht mehr im Dreibund, und nach Italiens Annäherungen an Frankreich 1902 und an Rußland 1909 trug der Vertrag hauptsächlich nur noch Italien Früchte. Das Deutsche Reich stand letzten Endes 1914/15 an der Seite Roms in Verfechtung eher italienischer denn österreichisch-ungarischer Interessen. Nicht mit Unrecht unterstreicht der Autor die unbedingt meisterhafte Führung der italienischen Außenpolitik, fach zugebend, daß die römische Politik des öfteren „gegen den Geist des Dreibundes“, „hinter dem Rücken der Alliierten“ und „mit, Mangel an Aufrichtigkeit“ vor sich ging, daß insbesondere die Abmachungen von Racconigi „eindeutig gegen die Donaumonarchie gerichtet“ waren. Gewissenhaft wird ergänzend bemerkt, daß sich auch Berlin und Wien nicht jederzeit als musterhafte Verbündete erwiesen.
Die wohlgelungene Arbeit Fellners beschränkt sich auf die Außenpolitik, und es erschiene unangebracht, zu verlangen, sie hätte auch die Wehrpolitik einbeziehen sollen, denn das hätte weitere 90 Druckseiten erfordert. An einigen Stellen wird allerdings auf Conrad Bezug genommen, und da dieser Fall derart zur Diskussion gestellt ist, sei einiges hierzu gesagt. Nach der Darstellung soll Conrad „ununterbrochen“ — was wohl nicht wörtlich zu nehmen ist — „aggressive Pläne“ gehegt und einen „Präventivkrieg“ gewollt haben. Wenn bei dieser Gelegenheit auch Erzherzog Franz Ferdinand kriegerischer Tendenzen bezichtigt wird, können Bar-dolffs Worte: „Den Krieg aber wollte er — der Thronfolger — niemals“ gegenübergestellt werden. Bezüglich des so umstrittenen „Präventivkrieges“ wäre zu bedenken, daß es Aehrenthal (1909) und Berchtold (zweimal 1913) waren, die sich zu einem Krieg gegen Serbien entschlossen, das heißt, einen Schritt zum „Präventivkrieg“ unternahmen und nicht der Generalstabschef, der lediglich Gutachten und Anträge zu vertreten hatte. Folglich konnten auch nicht Kriegspläne Conrads „vereitelt“ worden sein, da sich nur etwas „vereiteln“ läßt, was ein anderer vorzunehmen in der Lage ist. Das Amt des Chefs des Generalstabes war jedoch nie befugt, außenpolitische Handlungen zu setzen und etwa einen Krieg — auch nicht gegen Italien — von sich aus herbeizuführen. Das Einvernehmen mit Conrad litt vornehmlich darunter, daß der General in die Gedankengänge der Außenpolitik unzulänglich eingeweiht war, wir wissen doch, daß Conrad den Dreibundtext erst nach dem Kriege aus Pribrams Werk erfuhr. Ganz ähnlich war es schon dem Grafen Moltke ergangen, der ebenfalls mangels außenpolitischer Orientierung wiederholt zu unzutreffenden Ansichten gelangte. Zu beachten bliebe ferner Aehrenthals Glauben, man könne den Status quo und den Frieden bei gleichzeitiger Behinderung zureichender militärischer Bereitschaft behaupten. Nichts hat zum Verlust des ersten Weltkrieges mehr beigetragen als die verkümmerte Landesverteidigung Österreich-Ungarns. Kann man es noch Aehrenthals Vorgängern verzeihen, im Dreibund um des Friedens willen einen hohen Preis — Italiens Mitspracherecht am Balkan und in der Adria — gezählt zu haben, so war Aehrenthals Preis für den Frieden ein zu großes Wagnis, wie der weitere Geschichtsverlauf gezeigt hat. Heute kärtrt •niertirlnd ntr die Berechtigung aer-'ConradschebÄstte'gs plane bestreiten, denn Österreich-Ungarn war schon 1906 vom Ausland rüstungsmäßig überholt, und 1908 hatte Conrad melden müssen, daß der Nachbar im Südwesten „zielbewußt für einen Krieg gegen die Monarchie“ arbeitet.
Noch ein Wort zum Irredentismus: Es ist richtig, daß sich die italienischen Regierungen — wie alle Regierungen in ähnlicher Lage — offiziell vom Irredentismus distanzierten, es ist aber nicht minder richtig, daß der sich Ungehemmt entfaltende Irredentismus nach des Autors Feststellung „eine Bedrohung der Existenz der Donaumonarchie war“. Solche Bedrohung bedeutete aber eine Kriegsgefahr, und gegen diese vorzukehren war für den Generalstab dringendste Pflicht, wie sie es auch für den Außenminister hat sein müssen.
Die Studie „Der Dreibund“ soll nach Fellners Absicht bis zum Abfall Italiens weitergeführt werden; diese Fortsetzung wird zweifellos dasselbe lebhafte Interesse auslösen wie die vorliegende vorzügliche Abhandlung, und sie wird um so eindrucksvoller werden, je mehr sie die in der staatspolitischen Praxis so häufig vernachlässigte engste Verknüpfung der außenpolitischen mit den militärischen Gesichtspunkten in der Geschichtsschreibung zur Geltung kommen läßt.
Oskar Regele
DER HEILIGE BERG. Roman von Fanny Wibmer-Pedit. Eduard-Kaiser-Verlag, Klagenfurt. 300 Seiten.
Das geschichtlich Große an Einzelschicksalen darzustellen, um es dadurch dem Herzen nahezubringen, ist kein billiger Kunstkniff des Erzählers, eS liegt vielmehr im menschlich Wesentlichen begründet Denn nur das Miterleiden des Einzelschicksals erweckt in uns den Widerhall, das Verstehen. Die Tiroler Dichterin Fanny Wibmer-Pedit hat in dem jüngsten ihrer Romane den unheilvollen Abschnitt der heimischen Geschichte, der mit den napoleonischen Kriegen verknüpft ist, auf ihre klare und wahrhaft bewundernswerte Art neu gestaltet, indem sie die Benediktinerinnenabtei Sähen bei Brixen in Südtirol als Teil für das Ganze setzt und zugleich den bitteren Weg der bedrängten Tiroler in dem persönlichen Schicksal der Säbener Novizin Sabina nachzeichnet. Es entspricht durchaus dem tiefen Verständnis der Dichterin für die Vergangenheit ihres Landes, daß sie Sähen, den „heiligen Berg“, von ältestem Historischen her in unser Bewußtsein eindringen läßt, ein Heiligtum der Göttin Isis, ein römisches Kastell, dann bis zur Jahrtausendwende ein Bischofssitz, seit dem Ende des 17. Jahrhunderts eis Kloster der Benediktinerinnen. Selbst die Gestalt der Novizin Sabine wird in seelische Beziehung zu der dramatischen Erscheinung einer legendären rätischen Königstöchter gebracht. Damit wurzeln die historischen Ereignisse und die einzelnen Schicksale in dem Boden der Landschaft, die Fanny Wibmer-Pedit als ihre Heimat kennt wie wenig andere Erzähler. Andreas Hofer und seine Mitkämpfer stehen vor uns mit aller Lebendigkeit ihrer unbeugsamen
Treue, mit aller Kraft ihres Glaubens und Willens. Der tragische Zwiespalt zwischen ihnen und den bald mächtigen, bald entmachteten Herrengestalten, Franz I., Erzherzog Karl und Erzherzog Johann, entfaltet sich in der meisterlichen Führung der dichterisch-historischen Handlung. Die Beziehungen zu dem uns heute Nahen sind deutlich, wenn wir sie auch nur zwischen den Zeilen finden. Selbst der versöhnliche Ausklang weist über das Einst in die Zukunft.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!