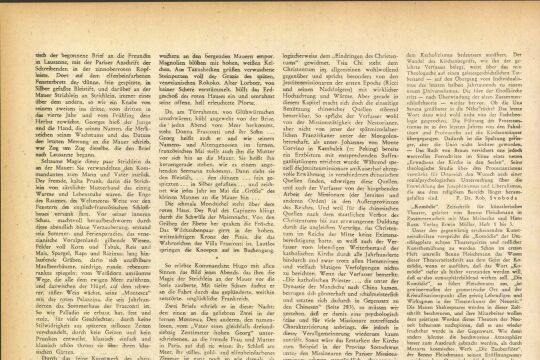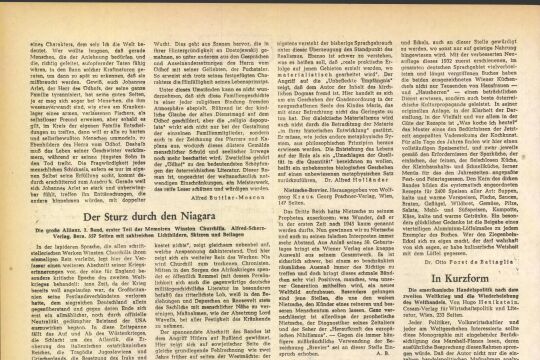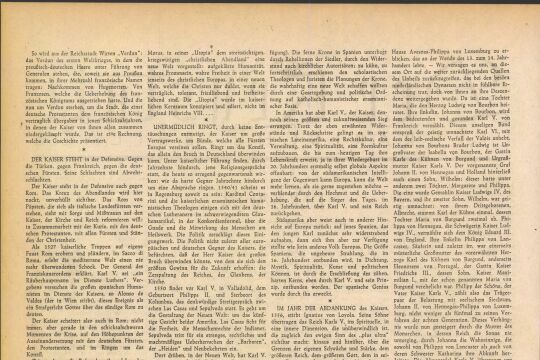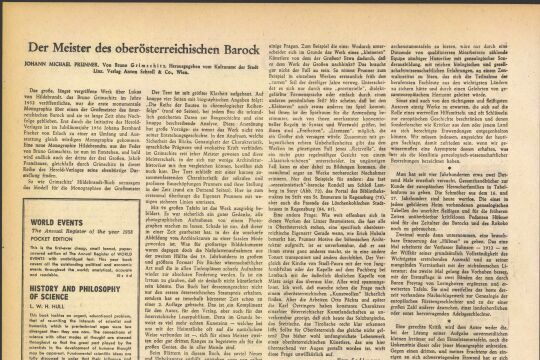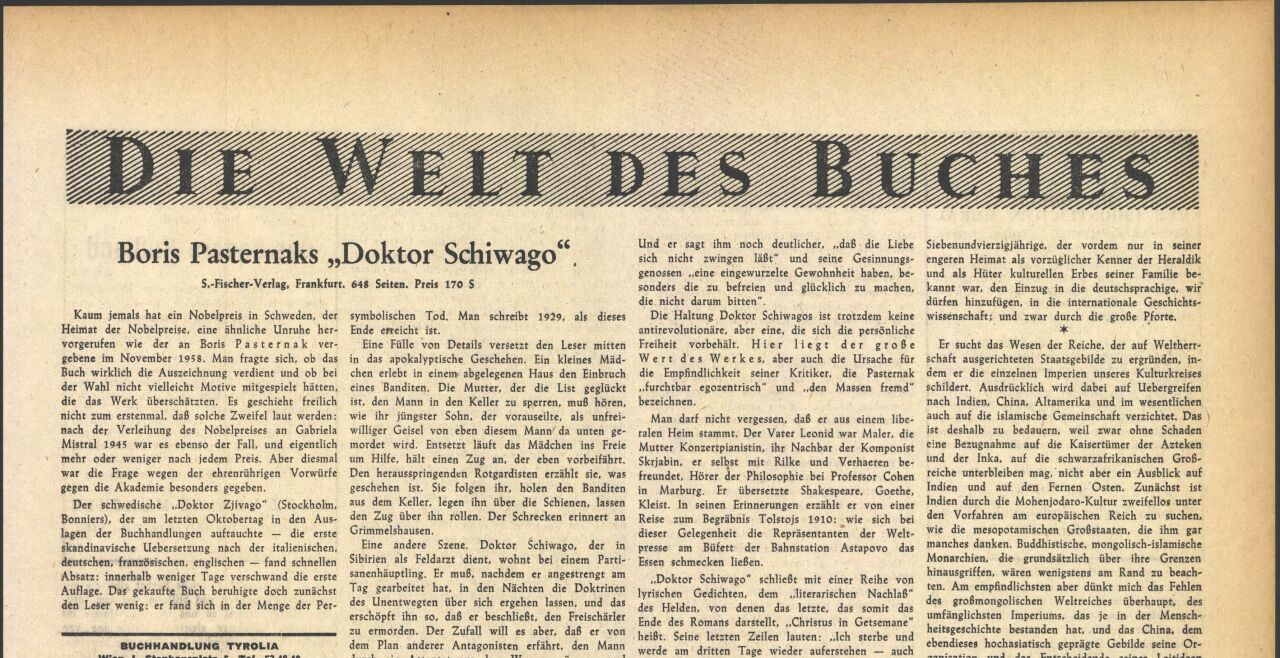
Nicht häufig begegnet man einem Buch wie diesem, das einen ausgedehnten Stoff in geistreicher und geisterfüllter Weise zu bewältigen weiß; das ihn originell zu erfassen und darzustellen versteht und das bei aller Vertrautheit mit den Methoden der Geschichtswissenschaft eine Form hat, die es den breitesten Kreisen der Leser zugänglich macht. Damit sind aber die Vorzüge des außerordentlichen Werkes nicht erschöpft. Es gewährt auch den Zünftigen — Historikern, Geschichtsphilosophen und Politikern, Völkerpsychologen und Publizisten — so mannigfache Anregung, es rührt an so viele Probleme, daß ihm schon darum besondere Aufmerksamkeit gebührt. Nicht, daß es frei von Einzelirrtümern, von umstreitbaren Ansichten, von anfechtbaren Grundsätzen seiner Konstruktion wäre! Doch es ist ein großer Wurf, es verdient überdacht zu werden; man muß sich mit ihm auseinandersetzen.
Der Verfasser ist eine fesselnde Persönlichkeit. Sproß — und Chef einet Linie — des berühmten Hauses-der seit Jahrhunderten in Böhmen führenden Fürsten Schwarzenberg aus dem fränkischen Geschlecht der Seinsheimer, durch die Frauen Nachfahre der hervorragendsten österreichischen, reichsdeutschen, alttschechischen, französischen, italienischen, britischen, madjarischen und russischen Geschlechter, Fachhistoriker von universellem Blick, hält der nun
Siebenundvierzigjährige, der vordem nur in seiner engeren Heimat als vorzüglicher Kenner der Heraldik und als Hüter kulturellen Erbes seiner Familie bekannt war, den Einzug in die deutschsprachige, wir dürfen hinzufügen, in die internationale Geschichtswissenschaft; und zwar durch die große Pforte.
Er sucht das Wesen der Reiche, der auf Weltherrschaft ausgerichteten Staatsgebilde zu ergründen, indem er die einzelnen Imperien unseres Kulturkreises schildert. Ausdrücklich wird dabei auf Uebergreifen nach Indien, China, Altamerika und im wesentlichen auch auf die islamische Gemeinschaft verzichtet. Das ist deshalb zu bedauern, weil zwar ohne Schaden eine Bezugnahme auf die Kaisertümer der Azteken und der Inka, auf die schwarzafrikanischen Groß-reiche unterbleiben mag, nicht aber ein Ausblick auf Indien und auf den Fernen Osten. Zunächst ist Indien durch die Mohenjodaro-Kultur zweifellos unter den Vorfahren am europäischen Reich zu suchen, wie die mesopotamischen Großstaaten, die ihm gar manches danken. Buddhistische, mongolisch-islamische Monarchien, die grundsätzlich über ihre Grenzen hinausgriffen, wären wenigstens am Rand zu beachten. Am empfindlichsten aber dünkt mich das Fehlen des großmongolischen Weltreiches überhaupt, des umfänglichsten Imperiums, das je in der Menschheitsgeschichte bestanden hat, und das China, dem ebendieses hochasiatisch geprägte Gebilde seine Organisation und das Entscheidende seiner Leitideen entlehnte. An vielen Stellen des Schwarzenbergschen Werkes drängt sich das Verlangen auf, den Vergleich mit, die Parallele zu China zu erörtern. Das, was der Autor so scharfsinnig als das Wesen des Reichsgedankens, also der mindestens postulierten Weltherrschaft, erspürt hat, kommt ja in der chinesischen Staatslehre vollkommen und aufs nachdrücklichste zur Geltung: der Himmel oben, der Himmelskaiser überträgt seinem irdischen Abbild, dem „Sohn des Himmels“ (Tien Tsu, japanisch: dem Tenno), die Sendung, den Auftrag (Ming), hienieden die Ordnung zu hüten, daß alles im Einklang mit den die Natur, darum auch die Menschen, regierenden Gesetzen sei. Kraft dieser Begnadung („von Gottes Gnaden“) und im Gehorsam an diese Mission, ist der irdische Kaiser berechtigt und verpflichtet, über das gesamte Erdenrund zu walten. Könige, staatliche Gebilde jeder Art, leiten von ihm ihre — sekundäre — Gewalt ab. Der gottgesandte Kaiser (China), der Kaiser-Gott (Japan) sind Entsprechungen zu allen Kosmokratoren Europas und Vorderasiens oder Aegyptens. Forschungen, zu denen die kunsthistorische Schule des genialen und phantasiebegabten Strzygowski den Anstoß und neuere britische wie sowjetische, indische und'ehme-sische; japanische -Historiker Beiträge in unübersehbarer Mannigfalt geliefert haben, müßten erst aufdecken, inwieweit die ältesten bisher nachweisbaren westasiatisch-nordostafrikanischen Imperien (von denen die hellenische und die römische, die byzantinische und die lateinisch-abendländische Reichsschöpfung den Ursprung genommen hat) mit Altchina auf einen gemeinsamen Vorläufer — in Hochasien, in Indien? — zurückgehen. Wie sehr der Blick nach Fernost förderlich und Stütze für die Meinungen des Fürsten Schwarzenberg gewesen wäre, das bezeigt ferner die verblüffende Analogie in den Sinnbildern. Der Drache ist ja das kaiserliche Wappentier par excellence im Blumigen Reich der Mitte geworden. Und noch anderes. Der Weltenherrscher als Heils-bringer — und sogar als Heiler körperlicher Gebresten — und umgekehrt, als verantwortlich für allgemeines Unglück, das er durch Erzürnen der himmlischen Mächte auf die Gesamtheit herabbeschwören kann, auch diese Vorstellung hat in China tiefe Wurzeln geschlagen. Doch begleiten wir nun den Verfasser auf seiner Wanderung durch die Weltreiche.
Sie hebt an in Aegypten. Ein erstes Mal sehen wir da den Götterliebling, das „Hohe Haus“, den Mittelpunkt des Oberstaats, den Ueberwinder und Herrn der Barbarenkönige, der von sich, wie der chinesische Kaiser, sprechen darf als „Ich, der Mensch“. Hierauf gleiten wir hinüber ins Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Eridu, die Sumerer; Akkad, Babylon und die Assyrer erscheinen, deren Vorstellungen und Symbole oft bis in die Gegenwart fortgedauert haben: vom Thron und dem Baldachin bis zur Jagd alt der königlichen Erlustigung — der auch nichtmonarchische Diktatoren gerne huldigen: man denke an Göring, Tito, Chruschtschow. Es folgen Alexander und das hellenische Großreich, dann die Perser und Parther. Der Autor entzieht sich den suggestiven Einwirkungen der hellenischen Kriegspropaganda. Er wird unter der Aegyde seines verstorbenen Meisters, des Exilrussen Kondakov, der iranischen Theokratie gerecht. In diesem Kapitel stehen eine Reihe, dem Kundigen erfreulicher Hinweise auf gemeinhin ungekannte Zusammenhänge, etwa auf die persischen Quellen der Gralsage, die lange ebenso verschüttet waren wie die arabischen, durch Asin Palacios wiederentdeckten, der Dante-schen „Divina Commedia“. Dankenswert sind die Exkurse über Armenien, Georgien und über deren gewissermaßen Bindeglieder zwischen West und Ost darstellende Fürstenhäuser, wie die Bagratiden, Auch hier wäre Gelegenheit, chinesische, turanische Verknüpfungen zu streifen, etwa bei den. Arzruni und in der Sage von Turandot. Die Ausstrahlungen des Hellenismus nach Inner- und Hochasien, über dai heutige Afghanistan bis in die einstigen Länder der Tocharer hätten wir gerne erwähnt gehabt.
Der Abschnitt über das Altrömische und das Byzantinische Reich bildet den Auftakt zum Haupt-teil .des Bandes. Hier bewegt sich Schwarzenberg auf einem Terrain, das ihm auf Schritt und Tritt geläufig ist. Zu den Zierden seines Berichts gehört das großartige Gemälde des Byzantinischen Reiches. Die blitzartige Erkenntnis, daß es sich bei den Ostkaisern in ähnlicher Weise um Legitimierung des Thronanspruches durch weibliche Abkunft von früheren Dynastien gehandelt haben muß, selbst wenn keine Quelle davon normative Zeugnisse bringt, verrät den historischen und juridischen Weitblick des Verfassers. Wir möchten den Satz erweitern: es ist überhaupt eine uralte gemein-indoeuropäische Auffassung, daß Abstammung vom Ersterwerber eines Thrones den Nachfahren Sukzessionsrechte gewährt, ohne Rücksicht, ob sie durch den Mannesstamm oder durch weibliche Herkunft vermittelt wird. Ein anderes Beispiel entpuppt sich uns bei der genaueren Betrachtung der einheimischen Könige und Kronbewerber in Polen, bei den „Piasten“ nach Aussterben der Pi-asten. Nicht aus bloßer Eitelkeit führen die Deszendenten der byzantinischen Monarchengeschlechter, selbst wenn sie zehnmal durch Frauen den Ursprung von Kaisern herleiten, den .Familiennamen ihrer erlauchtesten Ahnen mit. Daher rühren die ungezählten Komnenen, Angeloi, Laskaris, Palaiologen nicht nur im griechischen Gebiet, sondern auch in Serbien, Bulgarien, den rumänischen Fürstentümern, Albanien und später in Italien, Frankreich, ja in Rußland...
Wiederum sehr wohlgeraten, scheut die Zeichnung des „Römischen Reichs des Abendlands“ nicht davor zurück, hergebrachte und oft von der Wissenschaft, jedenfalls im Geschichtsbild der sogenannten „breiten Schichten der Gebildeten“ fortgeschleppte Ansichten und Begriffe stillschweigend zu übergehen oder überzeugend zu erledigen. Wie profund und glänzend ist nicht die Erläuterung der Kaiseridee Leopolds I. (S. 214) oder über die uralten, im Unbewußtsein verankerten Elemente im Mosaikbild, das sich die Bevölkerung vom alten Kaiser Franz Joseph, dem „letzten Monarchen“, geschaffen hat! Jetzt aber ein Lob, das nur selten einem westlichen oder westmitteleuropäischen Historiker gezollt werden darf, der uns ein allgemeines Werk vorlegt! Die „Nachfolge des Otsrömischen Reiches“ (Rußland, die Sowjetunion), dieses geschichtsphilosophische und psychologische Durchdringen einer dem Okzidenten meist unfaßbaren Vorstellungswelt, hat höchste Qualität. Man erfühlt hier den Beobachter, der lebenslang in slawische Aura gehüllt war, und der das bleibt, der ferner die Ergebnisse russischer Forschung kennt. Die Seiten über Urgrund und Gehalt der kommunistischen Weltreichidee (S. 245 ff.) sollte jeder Geschichtsforscher und vor allem jeder Politiker gelesen haben. Sie verwirren beinahe durch die Menge ununterbrochen aufeinander folgender, in ihrer Knappheit unübertrefflich formulierter Einfälle und Einsichten. Ich bedauere, dieses Prunkstück nicht Satz für Satz abdrucken zu können. Die Parallelen zu Altrom, zum Islam, die Ausführungen über Heilssendung und Eichatologie des kommunistischen Imperiums, über den ungewollt erzielten „Haupttreffer“, den Zeitungsleute mit dem Wort von den Satelliten gemacht haben, wobei ihr hinausschmissiger Propagandajargon durch den ihm zugeflogenen Sprachzufall tiefste Wahrheiten entlarvte: schließlich alles das, was Schwarzenberg zum Stalinkult, von dessen Apogäe und scheinbarem Ende aussagt, unter Erinnerung an die römische Geschichtsschreibung und deren Urteil über „gut“ und „böse“ Kaiser: das ist eine gar nicht alltägliche Leistung.
Kurz und gut würdigt der Autor das Erste Französische Kaiserreich, länger und noch besser die Habsburgermonarchie als authentische Erbin des Heiligen Römischen Reiches. Zuletzt sammelt er im Schlußkapitel die Summe der gewonnenen Resultate: über Weltreiche und Weltbeherrscher, die beide auf Weltanschauungen gründen, Weltordnungen wahren. Heilig sind die Herrschenden (oder auch: die Geheiligten herrschen); heilig, geheiligt sind die Symbole der Herrschaft. Heilig, geheiligt sind sie durch die Kontinuität, die Berufung auf das Frühere. Mit Recht sieht nun Fürst Schwarzenberg den gewaltigen Einschnitt in der Geschichte der Menschheit dann und dort, wo das Dagewesensein nicht mehr als Rechtfertigung eines Zustandes, eines Anspruches gilt, sondern als Makel und wo... der „gute“ Kaiser, Verzeihung, die „gute Staats- und Gesellschaftsform“, dadurch legitimiert wird, daß sie keine Kontinuität mit dem Gestrigen hat oder haben will, daß sie revolutionär (oder mindestens evolutionär, „fortschrittlich“) ist. Doch da meldet sich beim Verfasser -• wie beim Rezensenten — sofort der Einwurf: kehren nicht die Revolutionäre ihr Augenmerk den mythischen oder halbdunklen Urzeiten zu, deren gerechten Zustand sie wiederherstellen wollen. „Aurea prima sata est aetas...“ Das goldene Zeitalter soll wiederkehren; und so bekennt sich sogar das neueste, das revolutionärste Weltreich zur, allerdings während ein paar tausend Jahren unterbrochenen Kontinuität, zum angeblichen Ureinit.
Ein vierteltausend Anmerkungen ergänzt aufs dankenswerteste den Text. Sie so zu würdigen, wie sie es an sich verdienten, fehlt uns der Platz. Zur genealogischen Tafel (S. 364), die einen Deszent von Michael VIII. Palaiologos auf Franz Stefan zeigt, wäre eine Feststellung nötig gewesen, daß dieser Weg bei weitem nicht der einzige zu byzantinischen Monarchen ist, der das heutige Haus Oesterreich mit diesem verbindet. Dem Literaturverzeichnis entnehmen wir die Anerkennung heischende Belesenheit des Autors. Immerhin stören da manche Lücken. Vom Kapitel Aegypten angefangen, wo Jequier, Ma-spero, Pirenne vermißt werden, bis zu den grundlegenden Darstellungen über Rußland, etwa von Masaryk, Kucharzewski. Selbstverständlich haben wir von diesem Band keine auch nur annähernd das wichtigste nennende Bibliographie zu fordern. Wenn ich manche Standardwerke zu sehen gehofft hatte, ohne ihnen bei Schwarzenberg zu begegnen, so deshalb, weil sie entweder — und meist — Bestätigung oder, seltener, Modifizierung des Panoramas beschert hätten, das hier vor uns eröffnet wird. Dessen großartiger Weite und Tiefe bleibt durch derlei unerfüllten kleinen Wunsch nicht beeinträchtigt. Noch eines: Fürst Schwarzenberg, nicht nur im Blute verwandter Nachfahre des „Lanzknechts“ Friedrich, in einer Zeit der Bilanzknechte, hat rühmlichen Sinn für die Schönheit der Sprache, zumal der lateinischen, den er uns bei jeder Gelegenheit bekundet; er schreibt auch selbst einen persönlichen, bald anmutigen und leicht ironischen, bald pathetischen Stil. Eigenartigen Reiz strömen endlich die, fast setzten wir: genial, ausgewählten Doppelbilder aus, die, mit lateinischdeutscher Unterschrift versehen, ein integrierender Bestandteil des harmonischen, denkwürdigen, überdenkwürdigen Buches sind.