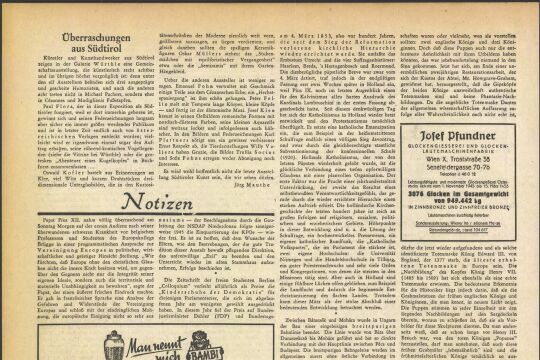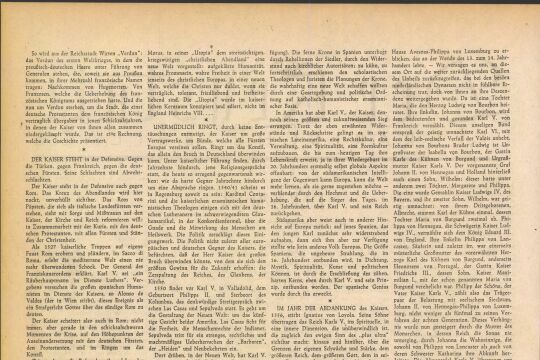Der große europäische Krieg, dessen reli- gionspolitische Anlässe im Laufe seiner dreißig Jahre mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt wurden, bildet die historische Auseinandersetzung zwisdien zwei gewaltigen Machtzentren, deren Antagonismus älter ist als die Glaubensspaltung, von der er seinen unmittelbaren Ausgang genommen hat. Es ist der Kampf zwischen Frankreich und dem Reich um die Vorherrschaft in Europa, wobei er für das absolute französische Königtum eigentlich nur die außenpolitische Seite seines Sieges über Adel und Bürgertum im eigenen Lande darstellt. Denn die Herrschaft der Krone war auch nach dem Tode Richelieus noch vielfach bedroht, erst Mazarins feine Diplomatie und glatte Hemmungslosigkeit sollte vollenden, was „le grand Cardinal“ mit eiserner Hand begonnen hatte.
Dieser dreißigjährige Krieg ist aber auch die letzte Phase im Kampf der deutschen Territorien wider Kaiser und Reich. Im Westfälischen Frieden wird den Reichsständen jene Souveränität bestätigt, um die sie bereits ein halbes Jahrtausend mit wachsendem Erfolg und in einer sehr vagen Großzügigkeit in der Wahl ihrer politischen Mittel gekämpft haben. ;— Schweden, die dritte große Komponente im damaligen europäischen Kräftespiel, hatte mit scharfem politischem Bück die allgemeine Situation erfaßt, um aus ihr das „Dominium Maris Baltici“ zu gewinnen. Natürlich wurden immer wieder von beiden Seiten die religiösen Anlässe und Ziele versichert, wobei subjektive Ehrlichkeit und poetisches Interesse nicht leicht voneinander zu scheiden sind. Eigentlich sind es doch wohl nur zwei große Gestalten unter den vielen Figuren dieses europäischen Dramas, von denen man sagen darf, daß es ihnen um die Wahrung der religiösen Belange völlig ernst gewesen ist, die sich in seltener Treue ihrer Sendung und ihrem G auben geopfert — in den ersten Jahren des Krieges Feldherr der Liga und dann des Kaisers: Johann Tserclaes Graf Tilly, und an seinem Ausgang der „letzte Ritter der evangelischen Sache“, Herzog Bernhard von Weimar.
Darüber hinaus darf man eines nicht übersehen: die beiden Habsburger, die während des Dreißigjährigen Krieges der Krone schwere Bürde tragen, Ferdinand II. und Ferdinand HL, waren unbedingt von dem religiösen Ethos dieses düsteren Kampfes erfüllt. Vor allem Ferdinand II. (t 1637), der dadurch nicht nur in machtpolitischer, sondern auch in weltanschaulicher Hinsicht in einen tragischen Gegensatz zu seinem größten Feldherrn Albrecht von Wallenstein gerät. Der protestantische Historiker Johannes Haller gibt diesem Gegensatz einen besonders klaren Ausdruck, wenn er sagt:
„In Wallensteins Kopf tauchten phantastische Pläne auf. Der Kaiser sollte sich zum Herrn der Fürsten, zum Alleinherrscher in Deutschland machen, die Kaiserwahl abschaffen, das Erbrecht an der Kaiserkrone einführen, eine Flotte auf der Ostsee bauen und mit ihr der spanischen Seemacht die Hand reichen. Im fernsten Hintergrund winkte die Unterwerfung Italiens und ein Kreuzzug, der der Macht der Türken ein Ende bereiten sollte. Auch für das, was von diesen Träumen Wirklichkeit werden konnte — und es war gewiß nicht alles Schimäre —, hatte der phantasielose Ferdinand keinen Sinn. Ihn beherrschte ein anderer Gedanke: die Wiederherstellung der katholischen Kirche überall in Deutschland. Hätte er den Anregungen Wallensteins folgen wollen, so hätte er sich vor allem auch gegen seine bisherigen Bundesgenossen, Bayern, die geistlichen Kurfürsen, wenden, dafür aber die konfessionellen Gegensätze zurückstellen müssen. Es galt zu wählen: entweder die politischen Möglichkeiten, die in den militärischen Erfolgen lagen, voll auszunutzen — dann empfahl es sich, auf konfessionelle Rückeroberung zu verzichten; oder das konfessionelle Ziel im Auge zu behalten — dann war die Umwandlung der Reichsverfassung unausführbar. Für Ferdinand kam das erste nicht inFrage. Er hat die genialen Gedanken seines großen Generals wahrscheinlich gar nicht verstanden, darum versagte er sich ihm, entließ ihn und beschränkte sich auf den Erlaß des Restitutionsedikts (1629), das nichts anderes verlangte als die Rückkehr zu dem Besitzstand, den die Evangelischen im Jahre 1555 eingenommen hatten. — Wäre das voll ausgeführt worden, so ist kein Zweifel, daß der Protestantismus aus dem größten Teil Deutschlands ausgerottet worden wäre. Er wäre zu einer geduldeten Sekte in einigen norddeutschen weltlichen Fürstentümern, in Sachsen, Brandenburg, Braunschweig, herabgesunken, ähnlich wie man früher die Hussiten in Böhmen geduldet hatte. Wie lange und in welchem Umfang er sich dabei gehalten haben würde, ist sehr die Frage. Deutschland im allgemeinen hätte sich geistig und damit auch in jeder anderen Beziehung dem bayrisch-österreichischen Typus anbequemt … “
Es ist daher nicht zuviel gesagt, daß mit dem Tode Wallensteins der weiteren Kriegführung die große Linie mangelt; daß sie mehr und mehr den religiösen Charakter verliert, erhellt schon daraus, daß eben das von einem Kardinal der römischen Kirche geführte Frankreich, la falle ainee de l’eglise, sich mit der Vormacht des Protestantismus, mit Schweden, verbündet, um das Reich, immer noch di« „Ordnungsmacht des christlichen Abendlandes“, in seinem Bestände zu erschüttern.
Bereits 1644 kündigen sich die ersten Bemühungen um den Frieden an, beide großen Parteien, beziehungsweise Parteigruppen sind langsam kriegsmüde geworden, in ihren Zielsetzungen wohl auch bescheidener. Es ist nicht Aufgabe dieser Zeilen, den Gang der langwierigen Verhandlungen auch nur anzudeuten, die schließlich zum endlichen Abschluß dieses großen Krieges geführt haben; „Verhandlungen, die oft wochen-, ja monatelang durch lächerliche Zeremonial- und Rangstreitigkeiten aufgehalten wurden, die aber die Gesandten der verschiedenen Potentaten ganz im Sinne der barocken Zeit oft ernster nahmen als das Schicksal ihrer Länder1 2 .“ — Es war das unbestrittene Verdienst des ebenso umsichtigen wie beweglichen kaiserlichen Gesandten Grafen Trauttmannsdorff, die 1645 begonnenen Teilverhandlungen für die französisch Delegation allmählich auf Münster, für die schwedische auf Osnabrück zu konzentrieren. Bis zum Jahre 1647 währten die Bemühungen um eine angehende Verständigung nur innerhalb der beiden großen Parteigruppen, in denen immer wieder kleine Sonderinteressen aufeinandertrafen, man denke etwa an den tiefen Gegensatz zwischen Brandenburg und Schweden oder an die dauernden Spannungen zwischen Bayern und den übrigen katholischen Reichsständen. Endlich, am 24. Oktober 1648, unterzeichneten alle Gesandten im Rathaussaal zu Münster die umfangreiche Friedensurkunde.
Wenn man von „Siegern“ in diesem Chaos, das der Krieg zurückließ, sprechen kann, so waren dies Frankreich und Schweden und dazu — wie schon eingangs erwähnt — die deutschen Territorien auf Kosten von Macht und Ansehen von Kaiser und Reich. Frankreich erhielt das (österreichische) Ober- und Unter-Elsaß mit der Landvogtei über die dortigen Reichsstädte, ferner Breisach, Metz, Toul, Verdun und das Besatzungsrecht von Philippsburg am Rhein. Damit war für den unmittelbaren Erben Richelieus und Mazarins, Ludwig XIV., die breite Operationsbasis für seine „Reunionen“ geschaffen, aus den Trümmern der Mitte Europas erhob sich bald für Frankreich „le grand Siede“. Und Schweden hatte nun das „Dominium Maris Baltici“ mit einem breiten Festlandsglacis erreicht, es gebot in Vorpommern und auf Rügen, hatte die Mündungen von Oder, Elbe und Weser in der Hand; freilich vermochten die Nachfolger Gustav Adolfs und Oxenstiernas diesen Gewinn nicht in gleich konsequenter Weise auszuwerten, wie dies in Frankreich geschah. — Im Reich, aus dem nun — was de facto längst vollzogen war — de jure die Niederlande und die Schweiz endgültig ausschieden, wurde nun den Territorien die Souveränität reichsrechtlich verbrieft, wobei sich diese Stimmung des Jus foederis besonders verhängnisvoll auswirken sollte. Denn wenn auch dieses Recht der Bündnisschließung mit auswärtigen Mächten durch die Klausel „außer wider Kaiser und Reich“ eingeschränkt wurde, so sollte die unmittelbare Zukunft bald erweisen, wie wenig die verschiedenen „Puis- sancen“ diese Einschränkung beachteten. (Die Entwicklung Brandenburg-Preußens liefert den klarsten Beweis für diese reichsfremde Entwicklung, was die kleindeutsche Geschichtsschreibung auch nie geleugnet hat, oder wie es zum Beispiel Bismarck auf den ersten Blättern seiner „Gedanken und Erinnerungen“ ausdrückt: „Jeder deutsche Fürst, der vor dem Dreißigjährigen Kriege dem Kaiser widerstrebte, ärgerte mich; vom Großen Kurfürsten an aber war ich parteiisch genug, antikaiserjich zu urteilen und natürlich zu finden, daß der Siebenjährige Krieg sich vorbereitetes.“ — Die konfessionellen Verhältnisse fanden durch den Westfälischen Frieden keine wesentliche Veränderung, die Bestimmungen des Passauer Vergleichs von 1552, beziehungsweise des Augsburger Religionsfriedens von 1555 blieben im allgemeinen maßgebend, sie wurden erweitert durch die offizielle Anerkennung auch der Reformierten durch das Reich; die Beanstandung des Friedenswerkes durch die Kurie fand bei den verschiedenen Vertragspartnern keine Beachtung.
Soweit die rein staatsrechtlichen Bestimmungen. Wie aber sah es nun in den vom Kriege betroffenen Ländern selbst aus? Hierauf gibt vielleicht Gustav Freytag die er- greifendste Antwort:
„Gewiß sind in einzelnen Zeiträumen der Völkerwanderung große Landschaften noch mehr verödet worden, zuweilen hat im Mittelalter eine Pest die Bewohner großer Städte ebensosehr dezimiert; aber solches Unglück war entweder lokal und wurde leicht durch den Überschuß an Menschenkraft geheilt, der aus der Umgebung auf den geleerten Grund zusammenströmte, oder cs fiel in eine Zeit, wo die Völker nicht fester auf dem Boden standen als lockere Sanddünen am Strande. Hier aber wird eine große Nation mit alter Kultur, mit vielen hunderten festgemauerten Städten, vielen tausend Dorf- fluren mit Acker und Weideland, das durch mehr als dreißig Generationen desselben Stammes bebaut war, so verwüstet, daß über, al! leere Räume entstehen, in denen die wilde Natur wieder die alten Feinde der Völker aus dem Boden erzeugt, wucherndes Gestrüpp und wilde Tiere4.“
In Österreich zum Beispiel, wo eigentlich nur die nördlichen und westlichen Randgebiete unter den unmittelbaren Kriegseinwirkungen gelitten hatten, waren allein 51 Schlösser,, 23 Städte und 311 Dörfer zerstört worden; in Würtemberg zum Beispiel, das alle Schrecken des Krieges und vielfacher Besetzung bis zum Ende durchzumachen hatte, zählte die Bevölkerung 1635 313.000, zehn Jahre später 65.000 Seelen. Wahrhaftig, ein Chaos, wie wir es nur nach dem letzten Weltkrieg erlebt haben, wo die Intensität der Vernichtung der Dauer der jahrzehntelangen Zerstörung gleichkam. Deshalb waren auch die wirtschaftlichen Folgen besonders hart: das meist entwurzelte Bauerntum geriet mehr und mehr in die leibeigene Abhängigkeit der Feudalherrn, Mangel an Viehstand, Saatgut und Ackergeräten, Verwüstung weiter Nutzflächen und dauernde Rechtsunsicherheit legten die Landwirtschaft auf lange Jahre lahm. Daß daneben oder darüber hinaus die geistige Kultur, ganz zu schweigen von der moralischen Haltung der Zeit, in diesem Kriege schwer gelitten hatte, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Während dieser langen Jahre der Zersetzung und Zerstörung war der Meistergesang längst verstummt, nur das geistliche Lied rang sich (in beiden Konfessionen) aus der Not der Zeit zum Ewigen empor. Dazu begann die theoretische Sichtungsarbeit der Sprachgesellschaften, begannen Drama, Roman und Satire aus reichem Stoff sich zu erneuern; unter anderem schenkt uns der oberdeutsche Regimentsschreiber Grimmelshausen unmittelbar aus eigenem Gegenwartserleben seinen „Simplizissimus“, um damit das Grauen dieser Zeit in freilich sehr düsteren Farben festzuhalten und sich selbst aus diesen Erinnerungen zu befreien.
Aber langsam erhob sich auch aus (fiesem Niederbruch ein neues Treiben und Blühen, es enstand eine figuren- und farbenreiche Ausdrucksform, die wohl aus einer gewissen Reaktion auf die dunkle Gestaltlosigkeit der letzten Jahrzehnte ihre Linien zuweilen zu betont ausschwingen ließ. Alles wurde in eine jauchzende Symphonie zusammengefaßt, in der sich die etwas strengen Formen der Renaissance in befreiende Vielgestaltigkeit auflösten, es war der Stil des fürstlichen Absolutismus auf sakralem und profanem Gebiet, es war die triumphierende, lebensbejahende Ausdrucksgestalt des Barocks. Und doch, der Westfälische Friede zog einen ernsten Schlußstrich unter die gesamte Reichsentwicklung, er stellt darum eine noch deutlichere Zäsur dar, als sie etwa die große Zeitenwende vom 15. zum 16. Jahrhundert geschaffen hatte. Mit 1648 endet die Geschichte der christlich-abendländischen Solidarität, die Geschichte Europas in seinen national betonten Einzelstaaten tritt an ihre Stelle, um sich ihre relative Geschlossenheit noch bis etwa zum ersten Weltkrieg einigermaßen zu bewahren.