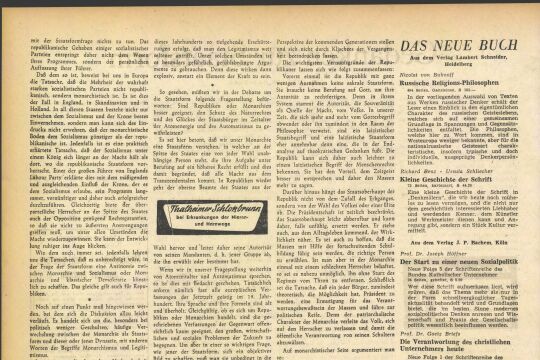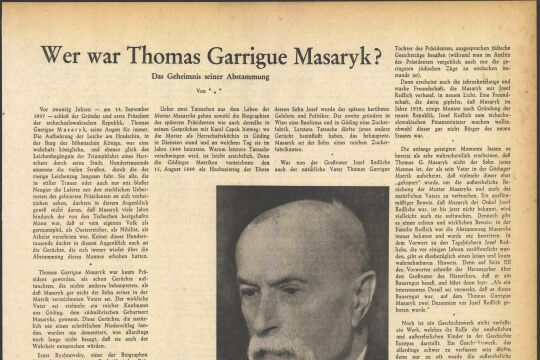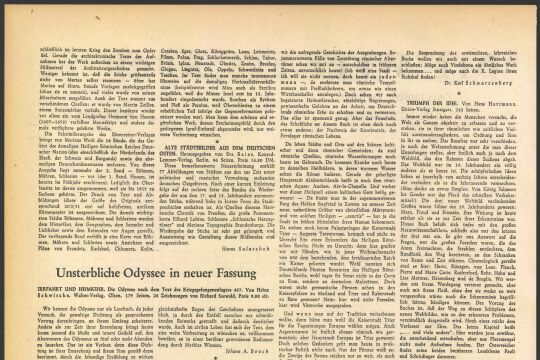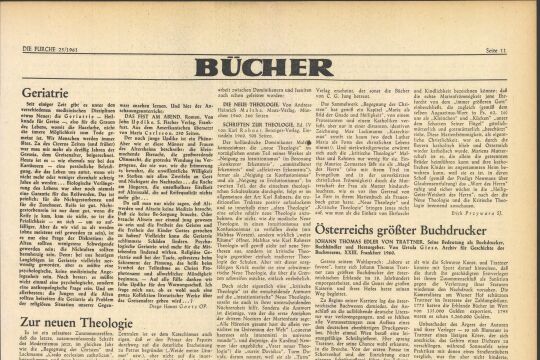Wenn ein Romanist für die höchste akademische Ehrung, die Zuerkennung des staatswissenschaftlichen Ehrendoktorats *, nicht bloß mit tiefbewegten Worten für Nachsicht und Güte seiner hohen Fakultät danken, auch nicht bloß einige Erinnerungen aus halbhundertjähriger didaktischer Erfahrung und wissenschaftlicher romanisti-scher Forschung vorbringen soll, so mag in dieser so auszeichnenden Verbindung römischer Rechtswissenschaft mit modern-rechtlicher. Staatswissenschaft objektiv die Bestätigung dafür gesehen werden, welch hohe Bedeutung der Romanistik in der Erziehung der jungen Juristen nicht bloß auf prjvat-rechtlichem Gebiete, sondern auch als Vorschule im öffentlichen Recht heute von berufenster Stelle zuerkannt wird. Und von diesem objektiven Gesichtspunkte aus dürfen vielleicht einige Worte gesagt sein.
Das römische Recht zeigt uns einen Januskopf. Das eine Gesicht ist das von wallenden Locken umrahmte Gesicht eines Jünglings, ein Gesicht, das' heute noch wie in den Zeiten der klassischen und justinianischen Jurisprudenz und seither immer wieder ein Gegenwartsrecht zeigt und siegessicher auch in die Zukunft schaut. Es ist das römische Privatrecht, wie wir es an vielen Denkmälern und insbesondere an den Pandekten werden und wachsen sehen, wie wir es schon zu erkennen glauben von jenen dunklen Zeiten an, als noch namenlose Juristen die ersten Formeln bildeten, die Zwölftafeln und die anderen ältesten Gesetze schufen, als aus ihrem Geiste das Edikt des Prätors entsprang, als immer namhaftere Praktiker und Rechtsgelehrte den Parteien umsonst ihr Wissen in Rechtsgutachten zur Verfügung stellten und dabei oft ein Recht fanden, das seine Unsterblichkeit bis auf den heutigen Tag bewiesen hat. Römische Juristen, mochte ihre Wiege wo immer im weiten Weltreich gestanden sein, waren es auch, die das Erbe der klassischen Vergangenheit wahrten und mehrten und in das zeitentsprechende Gewand des Corpus Iuris des Kaisers Justinian kleideten, wie es ihre Nachfahren in Bologna taten und die Praktiker und Pandektisten bis. in unsere Tage in internationaler fruchtbarer Zusammenarbeit aller kindischen Anfeindung zum Trotz und mit dem der geistigen Überlegenheit sicheren Enderfolge fortsetzen. Als monumentum aere perennius, als Grundstein all unseres erhofften Weltrechtes der Zukunft, steht das römische, das gemeine, das Recht der Pandekten vor uns.
Doch Janus zeigt auch ein anderes, ein graubärtig in die Vergangenheit blickendes Antlitz, in das die Züge der Geschichte des römischen Imperiums eingegraben sind. Hat auch dieses Gesicht uns noch jfwas zu sagen? Ich meine nicht dem Rechtsnistoriker, für den wie für jeden Historiker das historische Interesse an sich zur selbstverständlichen Bejahung der Frage veranlaßt. Aber ist diese historia eine magistra vitae auch für den Juristen? Ist sie es etwa gar als Geschichte des römischen Staates da und dort einmal für den Politiker, für den Staatslenker? Ist es erlaubt, ist es berechtigt, eine objektive Beziehung zwischen dem Staatsrecht der Römer und den Problemen unseres . modernen Staatsrechts festzustellen? Oder ist, wie man es vor den Weltkriegen auch von Verteidigern der Pandekten hören konnte, mit der Quellenkunde, mit dem Zivilprozeß und der ganzen Geschichte des öffentlichen Rechts auch sein vornehmstes Teilgebiet, das römische Staatsrecht, in die Kategorie „gänzlich zweckloser Nebengegenstände des römischen Rechts“ zu verweisen? i Kein Zweifel, daß Forschung und Lehre des römischen Staatsrechts aus dem Studium des modernen Staatslebens lebhafte Impulse gewinnen, daß, um einen Ausspruch unseres verewigten großen StaaBphilosophen ■ Friedrich von Wieser zu zitieren, gar oft die vita zur mägistra für die Erkenntnis der historia werden kann. Welcher antike Rechtshistoriker hätte in den sturmbewegten letzten Dezennien nicht Gelegenheit gehabt, Staatskrisen der Antike gleichsam im Spiegel zu sehen? Aber daß auch unsere Zeit, ja mehrfach erst gerade sie, aus analogen Vorgängen längst vergangener Jahre Parallelen abnehmen und, belehrt im positiven oder negativen Sinne, Schlüsse ziehen kann, ist richtig und kann im öffentlichen Leben nützlich wirken, wenn anders Erfahrungen auch im Rechts- und Staatsleben nicht notwendig nur am eigenen Leibe gemacht werden müssen. Denn die Antike zu kennen, bedeutet natürlich nicht schlechthin, sie zu kopieren. Auch von ihrem ius publicum gilt gar manchmal für uns ein weises errando diseimus. Und wir können es dankbar hinnehmen, wenn die Alten einmal uns Fehler und deren Folgen vorlebten. Immerhin dürfte des Positiven auch noch genug zur Belehrung bleiben.
So mag vom Stadtstaat hier einiges mit vergleichendem, aber, wie ich wünschte, nicht aufdringlichem Seitenblick auf die Gegenwart gesagt sein, nicht von der dunklen Vor- und Frühzeit Roms und Italiens, von der hypothetisch kaum erreichbaren Kultur und Zivilisation der Mittelmeerwelt, die doch kennbare, wenn auch noch wenig erkannte Spuren einer vorindogermanischen Zeit hinterlassen hat, von den Aboriginern, der „Urbevölkerung“ des Landes, die freilich auch einmal eingewandert war, auch nicht von der Einwanderung stammstaatlich organisierter Völkerschaften, der Illyrer, Italiker, Kelten, rlicht von der Kolonisation der Griechen in Großgriechenland, nicht auch vom dauernd großen Rätsel der Etrusker, die der Stadt den Namen Roma gaben und vermutlich auf die Gestaltung des staatsrechtlichen Grundbegriffs des Imperiums von grundsätzlichem Einfluß waren. Am Anfang einigermaßen sicherer römischer Geschichte steht die Gründung der Stadt und damit des Staates durch wohl glaubhaften Synoikismos, durch Zusammensiedlung von Latinern und Sabinern, durch gemeinsame Umwallung, später Ummaue-rung früher selbständiger Hügeldörfer. Erobernd und wohl auch in der Königszeit beherrschend tritt das etruskische Element hinzu. So mag aus latinischen, sabinischen, aber auch aus artfremden etruskischen Elementen, aus Siegern und Unterworfenen, der populus Romanus, das lateinisch sprechende Staatsvolk der Quiriten, erwachsen sein: Städter und Bauern, Patrizier, wozu aber zugezogene Händler und Gewerbetreibende kommen, Plebejer, die sich im Ständekampf die Gleichberechtigung im Staate erobern. Aus diesen und anderen nationalen und sozialen, sich bekämpfenden und vergleichenden Bevölkerungsteilen, aus Arm und Reich, Bauer und Kaufmann, Latiner und Etrusker, erwächst, nach außen hin in Abwehr und Angriff, zu Schutz und Trutz geeint, das Staatsvolk der Römer. Es ist der große Sieg einer Staatsidee über Volksbürgerschaftsfragen auf dem Gebiete der Rechtsordnung. Völkische und rassisehe Zugehörigkeit ist gegenüber der Staatszugehörigkeit gegenstandslos. Andererseits wäre freilich auch der Begriff eines „Volksrömers“ juristisch unvorstellbar gewesen. Das Staatsbürgerrecht ist zunächst höchst exklusiv, nicht leicht ist es außer durch Geburt zu erwerben. Erst nach und nach kommen Bürgerrechtsverleihungen an einzelne oder Gemeinden auf. Es war aber solche Verleihung eine rein staatliche Angelegenheit, die nach politischen Gesichtspunkten behandelt wurde. So begreift man auch die hohe Wertschätzung der römischen Zivität, wofür die Geschichte des Apostels Paulus mehr als einmal in sehr bekannter Weise Zeugnis gibt. Aber als die Bürger-rechtsverleihungen immer häufiger wurden' und schließlich unter Caracalla die überwiegende Mehrzahl, seit Justinian restlich alle freien Untertanen des Weltreiches erfaßt hatten, hatte die Zivität ihre Bedeutung gegenüber ökonomischer und sozialer Ungleichheit längst eingebüßt. Auch die Stellung des römischen Rechts zur Doppelbürgerschaft unterlag nivellierendem Wandel. Konnte noch Cicero mit stolzer Emphase verkünden, daß „duarum civita-tum civis noster esse iure civili nemo potest“ (pro Balbo 11, 28), daß also das stolze Römerrecht sich mit keinem anderen in einer Person verträgt, so zeigen schon die von den Italienern ausgegrabenen und glänzend edierten Edikte des Augustus in Kyrene das zugrunde liegende Kompatibilitätssystem. Man darf bei diesem uns eher verblüffenden Wandel freilich auch nicht die allumfassende politische Machtsphäre Roms vergessen, den nur noch theoretisch fortdauernden Stadtstaat Rom. der zum Territorialstaat und faktisch zum Weitimperium geworden war.
Mit dem Problem des Bürgerrechts stehen wir schon im römischen Verfassungsrecht. Auf drei Pfeilern ruht Roms Verfassung, auf der Magistratur, auf dem Senat und dem Volke. Man kann die Aufzählung auch umkehren, jedoch dürfte die genannte Reihenfolge am ehesten der historischen Abfolge der Machtsphären gerecht werden.
Denn das Imperium des Beamten, des magistratus, steht im Zentrum alles juristisch von der Republik aus gesehenen staatsrechtlichen Geschehens. Mit voller Konsequenz ist rückschauend der König, vorwärtsblickend der Prinzeps Staatsbeamter, ja kann sogar der absolute Kaiser hier an- und eingereiht werden. Und der revolutionär von der Plebs geschaffene Volkstribun ist mit der Revolution selbst in juristische Form gebannt und ein Staatsorgan geworden, aus dessen von der Plebs unter strengste-Sanktion gestelltem Schutz seit dem augusteischen Prinzipat alle Monarchen bis zur Gegenwart die Heiligkeit und Unverletzlichkeit ihrer Person ableiten. Das Imperium als schrankenlose Vollgewalt des Beamten wirkt sich nur außerhalb der Stadt in seiner Fülle aus. In Rom selbst ist es durch das merkwürdige Institut der gleichen Amtsgewalt zweier Träger gehemmt, auch durch die höchste Gerichtsbarkeit des Volkes und überall durch die Annuität, die einjährige Befristung des Amtes: demokratisch-republikanische Schutzgesetze des Bürgers. Scheinbar unüberbrückbare Gegensätze: Staatsgewalt und Bürgerfreiheit, Imperium und Libertas, sind durch die dem Bürger von der Rechtsordnung garantierte patria potestas auf ihr dem Staate unumgängliches Maß gemildert. Familie und Eigentum untersteht der freien Gewalt des Bürgers. Heerdienst und Steuer heischt der Staat von ihm, auf Einmischung in die Interna von Haus und Familie verzichtet die res publica grundsätzlich — wobei freilich die furchtbaren Proskriptionen durch revolutionäre Machthaber das Regelbild des Rechts nur heller leuchten lassen.
Der Senat ist der Rat des Beamten. Er erteilt Gutachten, die kraft ihrer Auctoritas, jenes juristisch nicht faßbaren Begriffes des privaten und öffentlichen Rechts, zu rechtsbildender Geltung kommen. Im Senat wirkt sich die ganze politische Erfahrung gewesener hoher Beamter aus: einer Versammlung von Königen schien er dem fremden Gesandten. Nur natürlich, daß sich in der Provinzialverwaltung des Weltreiches die ganze Weisheit dieser konservativen Korporation entfaltet.
Auch das Volk*zeigt langhin keine demokratischen Züge in seinem verfassungsmäßigen Auftreten. In den Komitien erzwingt sich erst in hartnäckigem Ringen die Plebs gleichen Anteil mit den Patriziern. Überdies sind die aus der Heeresorganisation zur politischen Versammlung umgestalteten Zenturiatkomitien timokratisch gegliedert, die an Zahl wenigeren Vermögenderen haben das politische Übergewicht an Stimmen, es sind freilich auch die der res publica mehr Leistenden. Das Problem der politischen Gleichheit der „arithmetischen“ und der abstufenden „geometrischen“ Gleichheit wird in der Theorie erörtert. Gegen jene sprechen sich Cicero: „ipsa aequabilitas est iniqua (de re publica 1, 27, 43) und der jüngere Plinius aus: „nihil est ipsa aequalitate inaequalius“ (ep. 9, 5). Für diese wird herkömmlich das den Juristen aus Institutionen (1, 1, pr.) und Digesten (1, 1, 10 pr. 1) geläufige Postulat der Gerechtigkeit, das „ius suum cuique tribuere“, zitiert. Auffallender, daß selbst gegen geheime Abstimmungen moralische Bedenken geltend gemacht werden: „ne tacitis suffragiis impudentia in-repat“; denn daß sich bei geheimer Abstimmung Schamlosigkeit einschleichen könne, glaubt Plinius in einer anderen Epistel (3, 20, 8) damit motivieren zu sollen, daß viele um den Ruf, wenige aber um ihr Gewissen besorgt seien („multi famam, conscientiam pauci verentur“).
Die Beispiele für ähnliche gedankliche, für staatstheoretische Probleme, aber auch für Berührung in Aufgaben der praktischen Staatskunst lassen sich leicht in großer Zahl an Antike und Gegenwart vorführen: wir sind in schmerzlicher Lehrzeit für solche Parallelen hellsichtig geworden. Was zeigt uns da doch alles die römisdie Staatsverwaltung. Um nur ein paar Schlagworte zu nennen: die Reichsorganisation mit ihrer vorbildlichen Ausgleichung weitest geschonten Föderalismus mit den militärischen und außenpolitisdien Erfordernissen der Zentralverwaltung; die nicht bloß für den Rechtshistoriker, sondern auch für den modernen Verwaltungsjuristen im positiven oder negativen Sinne lehrreichen Ergebnisse der Finanzverwaltung, der Agrar-, der Handelspolitik; die kulturgeschichtlich interessante Stellung des heidnischen Roms zu Religion und Kultur, vor allem aber der volle Stellungswechsel nach dem Siege des Christentums, das neue, große Problem Staat und Kirche und seine verschiedene Gestaltung im Osten und Westen, in Byzanz und in Rom.
Staatslehre wie Rechtstheorie überhaupt war nicht die starke Seite der römischen Jurisprudenz. Da waren die Griechen die großen Lehrer. Ciceros Schrift de re publica genügt es zu nennen. Aber überliefert haben die Römer dem Abendland auch hier das, was die Griechen erdachten So übernahmen sie und mit ihnen wir von den Griechen die staatsrechtlidien Klassifikationen von Monarchie, Aristokratie und Demokratie — diese freilich unter Ausschluß von Sklaven, Fremden und Frauen, also durchaus nicht in unserem Sinne —, sowie der Parekbaseis, der Karikaturen dieser regulären Formen, der Tyrannis, der Oligarchie und der Ochlokratie. So übernahmen die Römer die Vorstellung von der aus den braudibarsten Elementen der drei Grundformen gebildeten „gemischten Verfassung“ um so lieber, als den Griechen die remische Verfassung als solches Idealbild erschien. Auch die erhabene Vorstellung von einem über die nationalen Rechte sich erhebenden völkerverbindenden Internationalredite ruht auf griechischer kosmopolitischer Basis. Aber dem römischen Genius war es gegeben, eine res publica zu schaffen, die in den verschiedenen zeitentsprechenden Verfassungsformen ein mehr als tausendjähriges, ja, darf man Byzanz mit Grund hinzurechnen, mehr als zweitausendjähriges Reich zu gründen. Und Roms Juristen haben das Verdienst, über dem engherzigen ius civile den Bau des ius gentium errichtet zu haben. Daß sie in diesen Bau auch Bausteine hellenistischer Herkunft einbauten, schmälert ihr Verdienst nicht, vergrößert es vielmehr; daß Justinians Gesetzbuch vollends christlidie Züge trägt, könnte nur tadeln, wer im Christentum nicht die größte Zeitenwende sähe. Nicht anderes gilt von der Idee des ius naturale, das ein falsch verstandener Positivismus schon so oft totgesagt hat. Nicht als ob sich, wie eine vergangene Richtung versuchte, ein über alle wirtschaftlichen Wandlungen der Zeiten und Völker hinweg geltendes kasuistisches Gesetzuch von Tausenden von Paragraphen aufstellen ließe, aber so, daß die jeweilige Gestaltung einer Rechtsordnung sich großen, gottgegebenen Grundsätzen einfüge. Wäre es möglich, die von Ulpian unmittelbar übernommenen Iuris praeeepta, das „honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere“ (Dig. 1, 1, 10, 1), im Verkehr nicht bloß der Menschen, sondern auch der Staaten miteinander durchzuführen und damit das ius als „ars boni et aequi“ zu verwirklichen, also anständig zu leben, den Mitmenschen nicht irgendwie zu schädigen, vielmehr ihm das Seine zu lassen, so wäre das die Verwirklichung einer Kunst der Güte und Billigkeit, die den Frieden im privaten und öffentlichen Leben und im Leben der Staaten und Völker verbürgte. Bona fides und aequitas, die Prinzipien von Treu und Glauben und von Billigkeit im ganzen Rechtsleben zu verwirklidien, stellt sich aber das römische Recht zur ersten und höchsten Aufgabe.
In den österreichischen Großmachtzeiten des vorigen Jahrhunderts hat der ehemalige Professor des österreichischen Privatrechts an der Universität Wien und nachmalige Präsident des Reichsgerichtes Joseph U n g e r durch sein glänzendes System des österreichischen Privatredits dieses wieder in den Bereich des gemeinen Rechts zurückgeführt und damit zugleich eine neue Blüte des römischen Rechtsstudiums inauguriert. Seither ist die Tradition des römischen Rechts nicht abgebrodien, audi nicht ganz in den Jahren der vergangenen Entrechtung. In Wien haben vornehmlich als Dogmati-ker des Pandektenrechts Ludwig von Arndts und vorübergehend Rudolf von Ihering, dann Adolf Exner und Karl von Czyhlarz gewirkt, während Ludwig Mitteis, mein hochverehrter Lehrer, in genialer Forsdiung damals, als das deutsche bürgerliche Gesetzbuch die Pandekten zurückdrängte, eine neue Schule mit seinem „Reichsrecht und Volksrecht“ auftat und die Romanistik für die Papyri gewann, und mein unvergeßlicher väterlidier Freund Mori? Wlassak die Lehre vom Zivilprozeß in neue Bahnen lenkte, beide das römische Recht über enge privatrechtliche Bahnen hinausführend. Leider starben dann die Papyrologen Paul J ö r s und Friedrich von Woeß vor Vollendung ihrer Pläne — um so nur der Toten gedacht zu haben. Deren Werk und deren Pläne sind den Lebenden verpfliditen-des Vermächtnis. Unsere Universität hat eine große Aufgabe vor sich, auch sie als Vermittlerin auf kulturellem Gebiet zwisehen Ost und West, Nord und Süd, als Weltuniversität Künderin des Weltrechts. Eine geistige Macht, die Licht ausstrahlt, ist nicht gebunden an politische Grenzen, noch weniger an militärische Mittel. Die Graecia victa ist ein tröstendes Beispiel aus der Welt der Antike. Und so möge es nach schwerer Prüfung von unserer Alma mater Rudolfina in Forschung und Lehre auch auf dem Gebiete der Rechts- und Staatswissenschaften in alle Zukunft heißen: Austria docet.