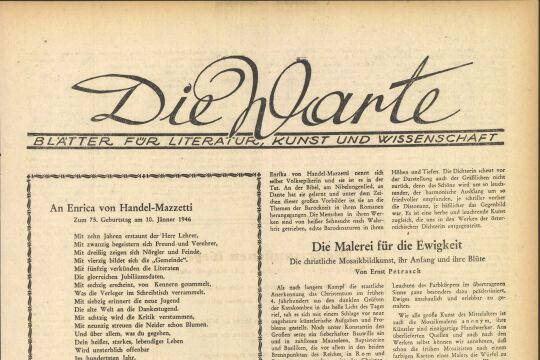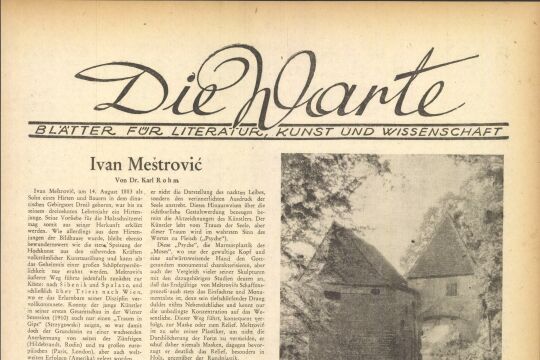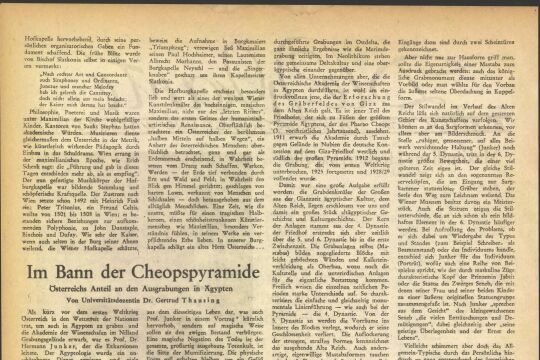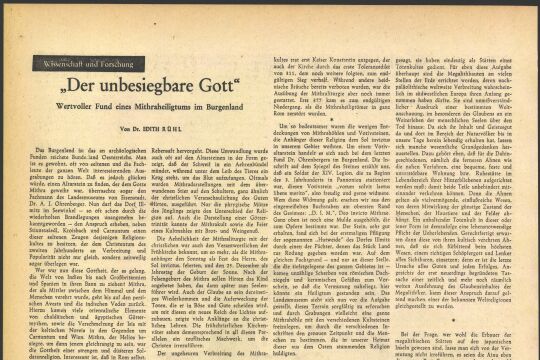Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
BLICKE ZUR EWIGKEIT
Um das Jahr 200 nach Christus war Rom der strahlende Mittelpunkt des größten Reiches, das die Welt bisher gekannt hatte. Urbs, die Stadt mit ihren mehr als einer Million Bewohnern, war nicht nur ein kosmopolitisches Zentrum, sondern auch großartig und großzügig angelegt. Die Reichsidee verlangte öffentliche Bauwerke, die in angemessener Größe von der Macht und der Würde des Staates kündeten. Seit mehr als 100 Jahren waren das Kolosseum — mit mehr als 50.000 Plätzen — und der Titusbogen fertiggestellt; von Kaiser Hadrian, der den Ätna bestiegen hatte, war ein Doppeltempel für Venus und Roma errichtet worden. Unter ihm hatte man auch um 125 nach Christus den durch Blitzschlag zerstörten Bau des Pantheons erneuert, jenen Tempel, der allen Göttern des mächtigen Reiches geweiht war, mit einer Kuppel von 43 Metern Spannweite, durch deren Öffnung sich der aufschauende Blick in das unendliche Blau des Himmels, in ahnungsvolle Leere verliert.
Der glanzvollen Größe der Hauptstadt stand jedoch der wachsende Druck von innen und außen auf das Imperium gegenüber. Nicht weniger als 225.000 Menschen lebten in Rom allein von der Fürsorge des Staates, und die germani-
sehen Völkerwanderungen brachten die Donauvölker in Unruhe, die, durch römische Sklavenwirtschaft bedrückt, den Anstürmen keinen oder geringen Widerstand leisteten. In den Provinzen mehrten sich die Aufstände. Byzanz wurde 196 von den Römern zerstört, während Nordafrika unter ihnen eine Blütezeit erlebte und Karthago wieder Weltstadt wurde.
Noch lebte das Christentum in der Hauptstadt unter ständiger Bedrohung, aber seine Gemeinden in Persien, Ägypten, Kleinasien oder Syrien waren bereits zu eigenem kräftigem Leben erstarkt. Dort herrschten auch noch an vielen Orten die Traditionen der alten Kulturen, jene Babylons, Assurs und Ägyptens. Sie verbanden sich mit der hellenischen, die stets — mehr denn je die römische — das östliche Mittelmeer beherrscht hatte, um ihr Formengut zu jenem Stil zusammenfließen zu lassen, der von Byzanz aus so bedeutungsvoll werden sollte.
Besonders in Ägypten spielte die altägyptische Tradition eine besondere Rolle, da sie sich mit der des Hellenismus — Alexandrien war eine griechische Stadt und die griechische Sprache herrschte in Ägypten vor — zu einer eigenartigen Synthese verband.
Die spätantiken Herrscher Ägyptens, die Ptolemäer, waren Griechen gewesen und Kleopatra die Letzte ihres Stammes. Unter ihnen entstand eine Kunst, die bewußt das strenge, hieratische Formengut der alten Kultur des Landes wieder aufnahm und mit jenen barock-weichen Stilelementen vermählte, die die späte Epoche griechischer Kunst auszeichneten. Im Verlauf der römischen Kaiserzeit gewann die römische Porträtkunst an Einfluß, und ihr Realismus verband sich mit der ägyptischen Statuarik. Nun entstanden jene Mumienporträts, die die Vorform der christlichen Ikonen bilden. Von der repräsentativen Darstellung des Verstorbenen, auf ein dünnes Holzbrett in Enkaustik — eingebrannten Wachsfarben — gemalt, führte ein direkter Weg zu jenem frühesten und bedeutendsten Beispiel der Ikonenmalerei, das die Ausstellung zeigt: der Tafel mit Christus und dem heiligen Menas.
Geht hier in der Malerei der Weg aus dem privaten Bereich des Totenkultes in die Repräsentation, in die Selbstdarstellung des Heiligen in der Ikone, so ist in Ägypten auch im Bereich der Symbolik und der Plastik das Durchwachsen alter Vorstellungen mit christlichem Gedankengut in fast nahtloser Durchdringung zu beobachten. So wird beinahe wanglos der Ankh-Schlüssel zum Kreuz und die den Horus
säugende Isis zur Madonna. Schon hier ist es, als hätten die alten Kulturen und Religionen Formen und Vorstellungen ausgebildet, die nur darauf warteten, vom Geist und der Seele des Christentums ergriffen und erfüllt zu werden, als hätten sie ihrer inneren Vollendung entgegengeharrt.
Als die römische Reichsidee und die damit verbundene Gewalt immer schwächer wurde, gewann die eigentliche ägyptische Bevölkerung — die Kopten, wie sie später genannt wurden, immer mehr an Bedeutung. Dem Wesen der ersten Christengemeinden war ein starkes Mißtrauen gegen alles Heidnische eigen, so vor allem gegen die bildlichen Darstellungen, die von Szenen aus der Mythologie bis zum Repräsentationsbild des verhaßten Kaiserkultes reichten. Erst allmählich wurde die Möglichkeit erkannt und ergriffen, mit den gegebenen Mitteln und Formen nicht nur ein Bekenntnis zum Glauben abzulegen, sondern auch die bildlich-szenische Darstellung zu benutzen, um die Wahrheiten des Glaubens zu verbreiten. Ein rein naturalistischer Stil wäre diesem Unterfangen, transzendentale Glaubenswahrheiten darzustellen, in keiner Weise gemäß gewesen. Die eigenartige Mischung aber aus spätantikem Expressionismus, statuarischer Überhöhung und repräsentativer Realistik, die die Kopten auf ihrem Boden erlebten, gab ihnen die Mittel in die Hand, zu einer eigenartigen Ausdruckskunst zu kommen, vor allem in der Plastik und den uns noch zahlreich erhaltenen Geweben, die in oft naiver Freude Christliches und Heidnisches nebeneinanderstellt und verbindet, in der sich Themen aus der antiken Mythologie — in die Dekoration und zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken — besonders lange halten.
Nimmt die koptisch-ägyptische Kunst dieser Zeit einigermaßen eine Sonderstellung in dieser Epoche ein, so war im anderen, westlichen, Römischen Reich der Verlauf der Entwicklung doch nicht ein sehr wesentlich anderer. Denn seine Gesamtheit war von dem Verlangen nach einer Reichskunst erfüllt, deren Ideale sich im Lauf der Zeit im Gegen- und Miteinanderwirken der verschiedensten Kräfte herausgebildet hatten. Hier in Rom verband sich die Dekadenz der späten griechischen Kunst, die deutlich durch den Verfall einer bereits hochentwickelten Raumvorstellung gekennzeichnet wird, mit dem fast brutalen Realismus und Naturalismus des römischen Porträts am entschiedensten, strömten die barbarischen Einflüsse vergröbernd von allen Seiten in das Reich ein.
Im,..-Grunde und ' im gesamten gesehen, findet das er.-, wachende Christentum nicht die Hochblüte einer Kunst, sondern deren N lergang und Übergang vor. In einem kritischen Augenblici: schaltet es sich in einen Prozeß ein, der zur Entleerung und Entlehnung der Formen geführt hatte, um sie mit dem Hauch seines eigenen mächtigen, geistigen Lebens nicht nur zu erfüllen, sondern zu verwandeln. Sein Atem scheint alles neu zu beleben, das Trivialste mit tiefer Bedeutung zu laden. Die illustrative, repräsentative Schilderung, die die Römer entwickelt hatten, um die Taten ihrer Kaiser und Feldherren zu feiern, wird zu gleichnishaften Darstellungen von überzeitlichem Gehalt, das Repräsentationsbild des vergotteten Kaisers zur Darstellung des einzigen und wahren Gottes selbst. Doch das keineswegs gleich.
Denn in der Hauptstadt des Reiches waren die Christen, unter heftigerer Bedrückung und Verfolgung als in den Provinzen leidend, in den Untergrund der Begräbnisstätten gestiegen. Hier, in den Katakomben bei den Gebeinen der Märtyrer, entwickelte sich zuerst in schüchterner, zaghafter Form, fast im Rahmen des römischen Stils, zuerst in Andeutungen jener mächtige Strom, der für Jahrhunderte das christliche Abendland bestimmen sollte und zum Aufgang des Mittelalters führte. Zuerst nur in Symbolen, allein dem Eingeweihten verständlich, wird christliches Gedankengut angezeigt: Geheimzeichen entstehen auf den Wänden, das Monogramm Christi, das T als älteste Form des Kreuz-symboles, das Schiff als Sinnbild der Kirche, der Fisch. Dies
bei einer malerischen Ausschmückung der Gräber, die Landschaften, Eroten und Weingerank zeigt, Schnitter bei der Arbeit, Weinlesen und Olivenernten. Schon aber taucht die Taube als Sinnbild der Christenseele auf und das Lamm. Der Pfau erinnert an die Unsterblichkeit, der Hirsch am Quell an die Heilssehnsucht. Stammen schon diese Tierdarstellungen von klassischen, antiken Mustern, so auch erst recht jene, die in der Gestalt des Orpheus oder des Guten
Hirten Christus zeigen. Die Sarkophage, die in der Ausstellung zu sehen sind, sind nicht nur eindrucksvolle Beispiele antiker Steinarbeit, sondern auch bewegende Denkmäler dafür, wie sich das Christentum in dem herrschenden Stil unterordnete, sich seiner bediente und schließlich bemächtigte, um ihn seinem eigenen Ausdruckserleben anzugleichen. Dabei ist an ihnen nicht nur die ikonographische Situation des frühen Christentums zu studieren, wie zum Beispiel am Jonas-Sarkophag, wo die Geschichte des Propheten Jonas als Gleichnis für den Durchgang der Seele durch diese Welt und ihren Eingang ins Paradies gebraucht wird, oder die zahlreichen Darstellungen mit dem Guten Hirten, sondern auch der Übergang von der Illustration zur Repräsentation und*-damit die ganze Problematik, die die frühchristliche Kunst mit der der Spätantike teilt. Und doch ist in diese Steinarbeiten etwas gekommen, das in den anderen Bildhauerarbeiten der Antike nicht vorhanden scheint: eine eigene Intensität der Augen, des Blickes. Der Blick der Kuroi, der Götter und Kaiser scheint in einer eigenartigen Verhangenheit ins Leere zu schweifen, jener der Gestalten der frühchristlichen Kunst auf und durch den Betrachter hindurch in die Ewigkeit gerichtet zu sein. Ein neuer gesammelter Ernst spricht uns an, die Augen scheinen uns zu folgen, uns nicht zu verlassen — auch wenn wir den Blick wenden.
Von besonderer Bedeutung sind auch die Goldschmiedearbeiten und jene in Elfenbein, die ersten sakralen Gegenstände, darunter das kostbare Kreuz des Kaisers Justinus II. aus dem Schatz von St. Peter, das älteste uns erhaltene dieser Art. Die Kreuze der Spätantike waren Triumphzeichen, Symbole himmlischer Macht. Elfenbeintafeln wurden sehr früh als Votivgaben verwendet, und eines der bedeutendsten Stücke der Ausstellung in künstlerischer Hinsicht ist wohl die Tafel mit der Himmelfahrtsdarstellung des Bayrischen Nationalmuseums. Ihr an die Seite muß die Pyxis mit dem lehrenden Christus aus Berlin gestellt werden, ein Hostienbehälter mit einer großartigen Darstellung des thronenden Christus. Auch die Gläser und Gebrauchs-
gegenstände, in ihrer Art oft einzigartig schöne Stücke, zeigen in ihrem Schmuck oder ihrer Form das Wirken christlicher Vorstellungen, die Weihe an den alles durchdringenden Glauben.
Bewegt und staunend steht man unter den Zeugnissen eines Aufbruchs, der das ganze Abendland erfaßte, vor der Fülle an Tradition, die hier zusammenfloß und all diese Jahrhunderte ihre wirksame Kraft behielt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!