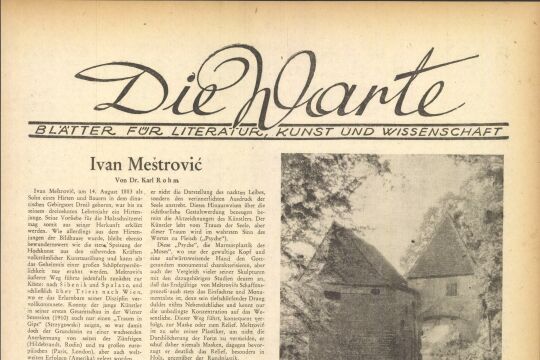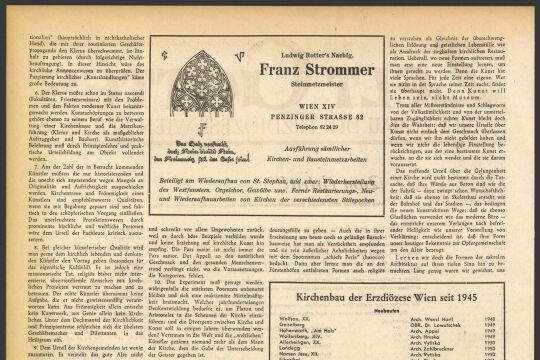Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
ÜBERWUNDENE DÄMONEN
Romanische Kunst. In diesen Worten liegt der Begriff der Kolonisation, und romanisch ist alles, was das späte Rom der Barbareneinfälle, der Völkerwanderungszeit, mit seinem Signum, mit seinem Stempel versah.
Es ist aber auch all das, was jenes Rom absorbierte, selbst neuen Antrieb aus barbarischer Kraft empfangend, den unverrückbaren Mittelpunkt der heidnischen und christlichen Antike bildend. Nach Rom strebten die auf gebrochenen Völkerschaften, um es zu erobern und schließlich nichtsahnend von ihm erobert zu werden, von seinen Mächten des Glaubens, der Kultur, der Zivilisation. Denn von Rom war seit Jahrhunderten ein ständiger Strom der Überlieferung nach Norden unterwegs, der sich in den Städten entlang der großartigen Straßen festsetzte, Grenzen festlegte und Bindungen schuf, die Jahrtausende überdauern sollten.
Dem Chaos der Völkerwanderungszeit, dem Zusammenbruch römischen Gesetzes und römischer Ordnung entwuchs eine stetige, starke und strenge Macht: die der Kirche. Im ständigen Ausbau ihrer Organisation vermehrte eie sowohl ihren geistigen wie weltlichen Einfluß. In den Klöstern entstanden selbständige Gemeinden, einer geistigen Ordnung gefügt und ihr gehorchend, gleichwohl aber auch autonome, von der Umwelt imabhängige Zentren, die alle Bereiche täglichen Bedarfs und Lebens umfaßten. Der Klo- eterplan von St. Gallen gibt darüber erschöpfend Bescheid. Im Zentrum stand die Abteikirche, vom basilikalen Typ mit beidseitiger Apsis und dem an einer Seite angelagerten Kloster. Darum gruppierten sich die Wohnräume, die Bäckerei, die Lagerräume, die Goldschmiedläden, der Pferdeschmied, der Böttcher, der Leinenwalker, Gärten und Viehställe, das Spital und die Schule; all das manchmal von einer schützenden Mauer umgeben, als Schutz gegen die Räuber und Feudalherren. In den Klöstern war fast die ganze Gelehrsamkeit der Zeit, fast die ganze Kunst- und Handfertigkeit konzentriert; sie hielten am Leben, was in diesen Zeiten von den alten Kulturen geblieben war, die Stürme überdauert hatte.
Bis zum Jahr 1000 gab es mit Ausnahme der großen Städte, die die Anfälle der Barbaren überstanden, wenig andere in Europa. Das Volk lebte in Landgemeinden, praktisch als Sklaven, den Feudalherren hörig, und die Unsicherheit der Straßen hinderte ausgedehnten Handel und weitreichende Beziehungen. Zu der Bedrohung von außen kam der innere Streit. Nicht nur die Feudalbarone, auch Bischöfe und Äbte bekämpften einander gelegentlich. Das Leben war schwer und dauernd gefährdet.
Um das Jahr 1000 aber verbreitete sich in Europa ein neuer Geist. Neue Städte wurden gegründet, die Verbindungen ausgebaut, Handelsgilden bildeten sich, und gegen die Feudalherren brachen Aufstände aus. Der Glaube wuchs zum religiösen Enthusiasmus an, der erste Kreuzzug wurde unternommen (1096). Im Gefolge dieser religiösen Erneuerung, deren eine Wurzel sicher in Cluny zu suchen ist, entfaltete sich eine kraftvolle künstlerische Tätigkeit an allen Orten, die ganz Europa überflutete. Schulen und Uni-, versitäten wurden errichtet, und die Volkssprache wurde ein Mittel literarischen Ausdrucks. Die Troubadoure schufen ihre Lieder an den südfranzösischen Höfen, und das Rolandslied und die Gralssage wurde zum Vorbild edler und wahrer Ritterschaft. So entwickelte sich im 11. und 12. Jahrhundert aus dem gärenden Chaos der vergangenen Zeit eine kraftvolle Kultur, die in den Klöstern und Höfen Ihre Mittelpunkte hatte und die der Epoche, ihr einmaliges Gesicht gebend, als Vorspiel der Blüte des Mittelalters in der Gotik diente.
Die Anfänge des Romanischen scheinen nun tatsächlich — wie Wilhelm Hausenstein einmal sagt — im Bildnerischen, im Fetisch zu liegen. Betrachtet man die Reliefs der Kirche von Schöngrabem, das Samson-Tympanon von Gurk, die Ungeheuer, Chimären und Tiere der Kapitelle und Taufbecken, so fühlen wir uns von einer seltsamen und ergreifenden Exotik berührt. Nicht nur ist es das Dräuende und Steinerne dieser Antlitze und Gestalten, das sich gegen die Wand in unerhörter Plastik oder einem Relief behauptet, es ist ihre blicklose Sehnsüchtigkeit, die uns angreift, ihre verstümmelte Körperhaftigkeit, die so ganz anders ist als der Wohllaut des griechischen Kanons. Und doch: Was alles wirkt noch mit! Im Gurker Samson ist unschwer noch der von den Legionen gebrachte Mithras zu erkennen, nicht nur im Gewand und der Krone — im Löwen schlummern noch ältere, in den Osten zurückreichende Erinnerungen. Hier ist wirklich ein heidnischer Aufbruch zu sehen, in dem das Heidnische vom Christlichen überwältigt und seinen Zwecken dienstbar gemacht wird. Eine unerhörte Spannung zeichnet diese Kunst aus, der Bereich der ganzen Welt erscheint in ihr; in einem dauernden Beispiel alles Menschlichen, vom Dämonen und der Chimäre bis zum lichten Engel. Und alles mit derselben Intensität und Inbrunst gebildet. Der Zusammenhang des Allgemeinen mit dem Allgemeinen wird gesucht — eine ewige Gegenwart in dauernder Präsenz und Transzendenz. Etwa die Muttergottes mit Kind aus dem Stift Griffen in Kärnten. Wie machtvoll hebt sich ihr Haupt aus dem Haar und dem Mantel. Gekrönt, fordernd und fragend. Und wie gelassen und selbstverständlich hält sie das Kind — in Tracht und Haarschnitt ein römischer Bürger —, königlich sich behauptend als Mutter. Seltsamer Zierat, der sie schmückt. Die großartige Eindringlichkeit der Gruppe ruft wieder Erinnerungen wach — an Ägypten, an koptische Kunst.
Dann die Kruzifixe. Auf ihnen thront Christus zuerst als König, in Tunika und mit den Füßen auf dem Schädel Adams. Erst langsam neigt sich das Haupt, biegen sich die Arme durch, treten andere Zeichen körperlich erlittenen Schmerzes und Leidens hinzu, um in der Gotik im Vesperbild übermächtig zu werden und schließlich bei Grünewald den religiösen Gehalt zu sprengen. Aber zuerst ist Er der König, der Herr — auch im Tod, den Er besiegt. Gelassen und segnend sterbend — wie im Kruzifix aus Höllein —, mild und verklärt und doch von barbarischer Expressivität
Romanische Plastik besitzt die ganze Schwere des Seins, und doch scheint sie in ihr überwunden. Vielleicht durch das Schicksal, das sie zu bilden trachtet? Denn auch die Leere ist in ihr nicht ungenützt. Auf den Domtüren von San Zeno, Augsburg, Hildesheim, in der Bauplastik spricht auch sie zu uns in unendlichen Spannungen.
Sie spricht zu uns ebenso in den großartigen Beispielen der Buchmalerei in Krems, in einer Zurückhaltung, die nun aber wieder in einen horror vacui umzuschlagen vermag und Initialen mit einer Überfülle von Ornamentik belebt, als bestehe eine geheime Angst vor einer leeren Stelle im Dasein. Alles ist dabei Bild und Sinnbild zugleich. Die Kunst hat einen unerhörten Auftrag erhalten: lehrhaft tätig zu sein, auf das Wesen, das Essentielle des Christlichen hinzuweisen. Das kann nun nicht unmittelbar genug geschehen. Die direkteste Form ist die deutlichste. Jene, die am deutlichsten macht, die wahrste. Hier ist keine Frage nach Schönheit am Platz, so sehr das Schöne auch der „Glanz des Wahren“ sein mag. Der Mensch soll ergriffen werden, nicht der Ästhet. Damals sprach man im übertragenen und wirklichen Sinn zu Kindern. Einem Volk, das sich an Stätten drängte, wo es Schutz fand, berührt und gerührt wurde, im naiven Staunen vor dem Wunder. Und das Wunder geschah immer dort, wo das Unerhörte, Unglaubliche Wirklichkeit bekam. Als die erste Orgel in Notre Dame in Paris installiert war, fielen die Menschen reihenweise in Ohnmacht, manche starben vor Schreck und Entzückung. Hört man heute Perotinus Magnus und die Ecole de Notre Dame, so kann man vieles verstehen. Welche verzückte Wildheit liegt in dieser Musik, ihrem Rhythmus, in der Freiheit der improvisierten Mehrstimmigkeit, die den Gedanken zu Parallelen des Jazz unserer Zeit gestattet. Nicht nur der Freiheit wegen, des improvieatorischen Musi- zierens, auch um der Scheidung willen, die damals den „Usus“ des Musikgebrauches, der lebendigen Praxis von der „Ars“, der Musiktheorie, trennte; nur, daß damals die „Kunst“musik auf einem Verhältnis zu Zahlen und auf einer damit verknüpften Beziehung zu göttlichen Proportionen beruhte... antikes Erbe.
Wie es die bildenden Künste in überzeugender Weise deutlich machen, „das, was es bedeutet“, so auch alle anderen Geräte, Waffen, ja, Schmuck sind bloßer Tatbestand. Hier ist Funktion alles, der Zierat Akzidenz, Dazutretendes, um eventuell die Bedeutung — sollte sie sakral sein — zu erhöhen. In den Helmen und Schwertern dieser Zeit wohnt nackte Funktion. Daher auch sind sie reine Form. Des Schutzes, des Tötens. Sie überzeugen uns durch die Mächtigkeit des Gedankens, der in ihnen dabei zum Ausdruck kommt. Alles ist auf das Essentielle, auf das Wesentliche zugeschnitten. Das auch ist es, was uns heute so direkt ergreift und überzeugt. Immer wird der Mensch und das Menschliche gemeint, unmittelbar und direkt. So ist auch das Rauchfaß von St. Daniel unmittelbar bergende Hülle, durchbrochen in einem Zierat, der an Persien erinnert, oder doch, leicht verzogene Kugel, bimenförmige Erde, Globus, von korinthischen Kapitellornamenten gehalten ... an Ägyptisches, Koptisches? In dieser Zeit reichen die Wurzeln sehr weit.
Im Barbarischen spiegelt sich der Aufbruch und das frühe Licht aller Kulturen, das läßt es uns auch so verwandt zu deren Frühzeit erscheinen. Aber im Gegensatz zu deren Fetischen, Götzen und Idolen, den Dämonen, die dort mit ihren Fratzen die Wände überwuchern, die Steine bevölkern, Mensch und Tier zur Symbiose vereinen, steht es hier in der romanischen Kunst gebannt, in einer manchmal, so erscheint es, gnadenlosen Hierarchie. Fratze und Chimäre, Tier und Dämon ducken sich, tragen das Taufbecken, winden sich um die Säulenstütze. Natürlich sind sie da, und das Bekenntnis zu ihnen ist eine der Faszinationen dieser Zeit, die der Subtilität, äußerster Verfeinerung, nicht mangelte, wie auch die Musik dieser Zeit beweist. Ihre Strenge und Wahrhaftigkeit strebte nicht darnach, sie zu „verdrängen“, sondern ihnen den Platz zuzuweisen, der ihnen gebührt.
Daß sie da sind, wird nach Freud niemand leugnen, doch heute haben sie ihren Platz nicht gefunden, sie usurpieren Räume, die nur dem Göttlichen zukommen. Damals hatten sie ihn nicht nur gefunden, er war ihnen zugewiesen worden in einer klaren Scheidung und Vermählung des Irdischen mit dem Überirdischen. Die Ekstase dieser Zeit waren keine „Neurosen“, sie waren nüchterne, evidente Tatsache, in der sich das Geheimnis mit der Wirklichkeit vermählte. Auch dies gehört zum Faszinierenden, das uns Ruhelose mit dieser Epoche verbindet, zu dem Bereich unserer Sehnsucht, der in absoluter Gefährdung das Absolute sucht. Die „Thronende Muttergottes“ aus Ruhpolding gibt darauf eine Antwort. Streng, unerbittlich, wie ihre Epoche, sitzt sie vor uns. Und während das Kind uns segnet, scheint sie zu fragen: „Und was bist du?“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!