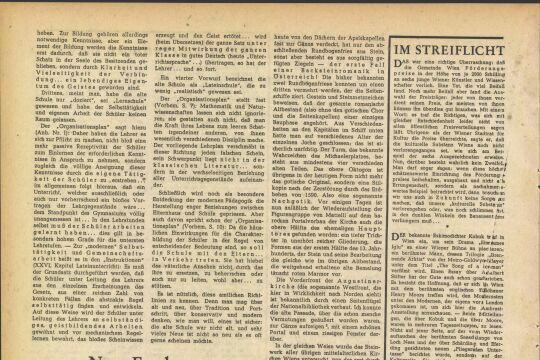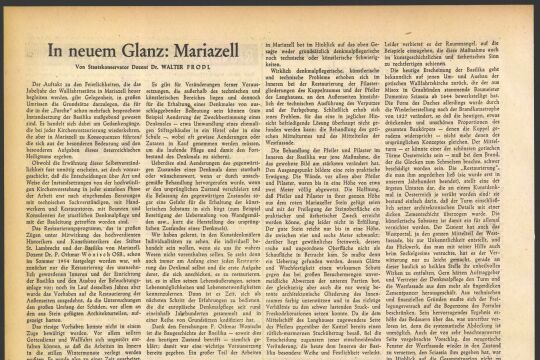„O Herr, die Werke deiner Hände sind die Himmel; sie werden vergehen, du aber wirst bleiben, sie alle werden wie ein Kleid veralten. Wie ein Gewand wirst du sie wandeln, und sie werden gewandelt werden. Du aber bist immer derselbe und deine Jahre schwinden nicht.“ Dieses Geständnis des Weltapostels über die Vergänglichkeit alles Geschaffenen (1. Heb. 10 bis 12) ist für die Erfahrung der gesamten Menschheit abgelegt, es hat keine Ausnahme und duldet keinen Widerspruch. Wenn nun schon die Werke seiner Hände diesem Gesetz unterliegen, um wieviel mehr erst die Werke der Menschen, die selbst nur Geschöpfe sind. Dieses Gleichnis vom Kleid, das sich abnützt, wird besonders dort sichtbar, wo der menschliche Geist des Stoffes bedarf, um seine Ideen zu verwirklichen, in den Werken der bildenden Kunst. Auch die gigantischesten Zeugnisse menschlichen Wollens, auch die erhabensten Leistungen menschlichen Sinnens und Könnens sind davon nicht ausgenommen. „Alles fürchtet die Zeit, die Zeit aber fürchtet die Pyramide“, selbst dieser stolze Ausspruch ist heute als eine überhebliche Phrase entlarvt. Wenn nun schon die kolossale Massigkeit des Pharaonenbaues dem zersetzenden Einfluß der Jahrhunderte nicht standhalten konnte, um wieviel anfälliger für das Schicksal „des Gewandes“ müssen die fein-gliedrigen Leistungen der gotischen Dome sein. Beredtes Zeugnis dafür ihre bewegte Baugeschichte. Mögen sie im einzelnen noch so verschiedene Aussagen ergeben, darin sind sie gemeinsam, daß sie die Spuren der geistig-kulturellen Wandlungen der Jahrhunderte, die äußeren Schicksale ihrer Stadt, deren Wahrzeichen sie sind, an sich tragen wie ein menschliches Antlitz, dem sich die geistigen und naturbedingten Krisen eines langen Lebens unverkennbar eingezeichnet haben. Wie sehr wir diese Ähnlichkeit empfinden, beweist zubest die Tatsache, daß-wir beide Erscheinungsformen als „altehrwürdig“ z bezeichnen pflegen.
Unser Stephansdom ist dafür ganz besonders aufschlußreiches Beispiel. Schon während seiner langen Entstehungszeit war die Urplanung mancher tiefgreifenden Wandlung ausgesetzt und jedes der folgenden Jahrhunderte hat zumindest in der Ausstattung vorhandene Bestände durch solche seines Geistes ersetzt und selbst die Restaurierungen der jüngsten Vergangenheit haben bei aller Absicht auf Erhaltung des ursprünglichen Zustandes den ihrer jeweiligen Gegenwart gemäßen Stempel aufgedrückt.
Die Veränderungen aber, die der altehrwürdige Dom vergangenes Jahr über sich ergehen lassen mußte, waren Zerstörung in einem ganz ungeahnten Ausmaße. Es. ist dies um so tragischer, als all dies erst geschah, da nach den sich steigernden Fährnissen eines langen Krieges schon die Hoffnung auf endgültige Überwindung aller Bedrohung aufzuleuchten begann. Erst die allerletzten Tage der Kampfhandlungen sollten das Verhängnis bringen. Es ist über diese krisenhaften Vorgänge eine Fülle von Berichten erschienen, die nicht alle durch genauere Einsicht in die wirklichen Vorgänge bestimmt waren. Dies ist nur zu begreiflich. Auch wahrheitsliebende Aussagen einzelner Augenzeugen sind erwiesenermaßen keine volle Gewähr für das wirkliche Geschehen. Die abweichenden Zeugenaussagen bei Gerichtsverhandlungen über belanglose Verkehrsunfälle beweisen immer wieder dieses Versagen. Das von Stunde zu Stunde wechselnde, dabei mehrere Tage und Nächte andauernde Schauspiel der Verwüstung der Stephanskirche war keinem Betrachter völlig übersichtlich erkennbar, vor allem blieben die Vorgänge im Innern des Domes nur wenig Eingeweihten zugänglich. Die verläßlichste Berichterstattung bietet eine von den Zunächstbeteiligten verfaßte Denkschrift, die nur in wenigen Exemplaren an maßgebende Personen und Behörden verteilt wurde. Nach einem darin niedergelegten Bericht des Domvikars Penall begann die akute Gefährdung des Baues Sonntag, den 8. April, und endete in den Morgenstunden des 13. April (Freitag). Die unmittelbare Katastrophe verursachten nicht die Bombeneinschläge, sondern das Feuer, das im Funkenflug von den brennenden Häusern am Stephansplatz, die hauptsächlich von zivilen Plünderern angezündet worden waten, auf das Baugerüst am unausgebauten Turm übertragen wurde. Am 12. April brennt das gesamte Dach, durch eine Gewölbeöffnung über der Westempore fällt Glut auf das herrliche Orgelwerk, das nur zu leicht ein Raub der
Flammen wird und infolge der übermäßigen Hitze ein weiteres Verweilen im Innern des Domes zeitweise unmöglich macht. Schließlich stürzt aus noch nicht sicher geklärter Ursache eine Stützmauer des Dachstuhles ein, durchschlägt die Gewölbe, zertrümmert das gotische Chorgestühl, alles brennt augenblicklich. Die Katastrophe war vollendet.
Die ganzen furchtbaren Stunden hindurch war ein kleiner Trupp von beherzten Männern, Klerikern und Laien, mit Einsatz letzter Kräfte bemüht, mit ganz unzulänglichen Abwehrmitteln zu retten, was noch zu retten war. Will man das Hohelied dieser „braven“ Männer singen, muß vorerst der Name des damaligen Sakristeidirektors Lothar Kodeischka genannt werden. Tatsächlich konnte die ersten Tage nur mit Feuerpatschen immer wieder an anderer Stelle ausbrechendes Feuer gelöscht werden.
In die erschütternde Verlustbilanz, die sich aus diesen Ereignissen ergab, muß an erster Stelle das unvergleichliche gotische Chorgestühl eingereiht werden, von dem nur der jämmerliche Rest einer Wange ins Diözesanmuseum übertragen werden konnte,anschließend der Lettner-K ruzifixus des alten Domes, das sogenannte Wimpassinger Kreuz (um 1280), das umfangreichste Denkmal frühgotischer Tafelmalerei in unseren Landen. Unglücklicherweise ging seither noch das künstlerisch hochwertige spätgotische Triumphkreuz (allerdings in Fassung des neunzehnten Jahrhunderts) durch Herunterfallen in Trümmer. Unersetzlich ist auch die große Orgel, ein Meisterwerk barocker Ausstattungskunst. Vom Geläute blieben nur erhalten zwei kleinere Glocken im Südturm und jene des nördlichen Heidenturmes. Was an weiteren Kunstdenkmälern, zum Beispiel an Statuen und Epitaphien, Altarbildern beschädigt oder vernichtet wurde, ist noch nicht einwandfrei überprüft, zumal ja ein weiterer Gewölbeeinbruch neuen Schaden anrichtete.
Es erweist sich heute als besonderes Verdienst des Staatsdenkmalamtes, schon in den ersten Kriegsjahren auf die Sicherung und Ummauerung des Riesentores, der Kanzel, des Friedrichsgrabes und auf die Entfernung der alten Glasgemälde im Chore gedrängt zu haben. Auch der sogenannte Wiener-Neustädter Altar sowie einige wertvolle Epitaphien wurden noch rechtzeitig von der Dombauleitung geborgen.
Ein günstiges Geschick bewahrte das Hochaltarbild vor ernsterer Beschädigung. Die Rettung dieses Hauptwerkes von Tobias Pockh, geschaffen (1640 bis 1648) als erste Großleistung der frühbarocken Altarmalerei in Wien, ist um so höher anzuschlagen, als der Bestand an derartigen Denkmälern aus dem siebzehnten Jahrhundert ohnehin schon in schmerzlich hohem Ausmaße verringert ist. Auch die demselben Jahrhundert
zugehörigen Altarblätter des Apostel- und Frauenchores, die Kreuzigung von Joachim von Sandrart und die Himmelfahrt Mariens von Spillenberger, sind erhalten, weil sie schon früher aus der Stephanskirche entfernt worden waren, ersteres in die Schwarzspanierkirche in Wien, letzteres in die St.-Wolfgangs-Kirche am Wechsel. Unbeschädigt blieb auch das frühbarocke Chorgestühl, das zwar mit dem alten keinen Vergleich hält, aber doch für die Geschichte des Domes hochbedeutsam ist, sowie die Altäre und Pfeiler-Statuen des Langhauses.
Man verstand es auch insofern aus der großen Not eine große Tugend zu machen, als man die einzig gegebene Gelegenheit benützte, die durch den Brand des Chorgestühles freiwerdende , Bodenfläche des Chores nach den Fundamenten des alten Baues fachmännisch zu untersuchen. Die Grabungen wurden gewissenhaftest von einem Kunsthistoriker geleitet, der durch seine bisherigen Arbeiten über mittelalterliche Wiener Kunst seine Berechtigung für solches Unternehmen einwandfrei nachweisen konnte. Das Kulturamt der Stadt Wien stellte freiwillige Helfer bei, denen diese Mitarbeit Herzenssache war. Es wären zum völligen Abschluß des ganzen Vorhabens freilich noch Grabungen im Hauptschiff notwendig, um d i e m u t-maßliche Lage der Westfassade der ersten Anlagefestzustellen. Es sei den zu gewinnenden Ergebnissen, die erst noch sorglich durchgearbeitet werden müssen, nicht vorgegriffen- Auch können nicht alle dabei aufscheinenden Sonderprobleme Anspruch darauf erheben, über den Kreis der Fachwelt hinaus Interesse zu erwecken.
Immerhin kann heute schon folgende gewichtige Feststellung gewagt werden: Schon die älteste Anlage, geweiht 1146, war für eine Pfarrkirche von außergewöhnlich großen Dimensionen und überbot an Raumgehalt selbst die eben vorher (1136) vollendete Kirche des babenbergischen Residenzklosters in Neuenburg, jenem für die junge Ostmark vorbildlichen Bau, dessen getreue Variante St. Stephan war. Diese Ausnahmsleistung ist nur durch das Repräsentationsbedürfnis des Passauer Bischofs zu erklären, der in der Stadt, die sehr vermutlich als zukünftige Hofhaltung der Markgrafen ausersehen war, eine monumentale Darstellung seiner kirchenpolitischen Stellung geben wollte.
Auch der Brand der großen Orgel hat der Forscherarbeit manche bisher verschlossene Aussicht auf neue Erkenntnisse eröffnet. Die gewaltige Westempore, die sich der Gesamtbreite des Langhauses vorlagert und darin eine unverkennbare Absage an die hirauische Gepflogenheit bedeutet (R. K. Donin), wurde höchstwahrscheinlich in der Regierungszeit Leopolds VI. begonnen, unter Friedrich dem Streitbaren energisch weitergeführt, ebenso ihr reicher Westabschluß, die Riesen-toranlage, deren plastischer Schmuck allerdings einige Jahre für sich erforderte. Der in seiner Wirkung viel umstrittene Brand von 1258 veranlaßte Ausbesserungen. Der eigentliche Weiterausbau der spätromanisch-frühgotischen oberen Partien der Fassade sowie der oberen Stockwerke der Heidentürme zog sich noch einige Jahrzehnte weiter hin.
Der Wegfall des platz- und lichtraubenden mächtigen Orgelprospektes und der Abbruch der Zwischenmauern, welche die Untergeschosse der Heidentürme vom Hauptraum absonderten, lassen nun dies Raumbild wieder ungefähr so sehen, wie es nach Vollendung des spätgotischen Umbaues (15. Jahrhundert) bis zur Aufstellung der Orgel 1720 sichtbar war.
Der erste Eindruck ist ein zwiespältiger. Für die Bauphase aus der Übergangszeit vom spätromanischen zum frühgotischen Formen- und Raumempfinden sind die Säulen zu massig, die Turmgeschosse erscheinen zu gedrückt: Nun wiesen ja schon bisher die sonderbaren, trompenartig sich weitenden Stufen, die von den Wendeltreppen zum Plateau der Empore hinaufführten, darauf hin, daß beim Umbau der spätgotischen Zeit die Bodenfläche der Empore bedeutend gehoben worden sein muß. Grabungen in den Türmen, die den alten Fußboden bloßlegen konnten, bestätigen nun einwandfrei eine Erhöhung von fast eineinhalb Metern. Wie leicht und beschwingt im frühgotischen Rhythmus muß ursprünglich dieser Raum gewirkt haben bei aller Wahrung romanischer Bildung in den phantasievollen, abwechslungsreichen Kapiteln, die zur Zeit nach den neuesten Bedingungen der Denkmalpflege ausgebessert werden!
Die verstärkte Helligkeit des Raumes erleichtert das Studium der Wandmalereien, die bisher nur sehr flüchtige Beachtung und Beschreibung fanden. An der Elachbogennische unter der Sohlbank des großen Westfensters kam eine Ansicht der Stephanskirche und Umgebung zum Vorschein, die in ihrem höchst fragmentarischen Zustand von Restaurator Schimann in vorbildlicher Weise gesichert werden konnte. Diese Arbeit, entstanden um 1450, ist somit als älteste Ansicht von Wien anzusprechen, ohne freilich die lokalgeschichtliche Bedeutung der um einige Jahrzehnte jüngeren Ansicht auf der viel abgebildeten Schottentafel mit der Flucht nach Ägypten in ihrem Werte besonders zu verringern, da ja das Unersetzliche dieses Gemäldes nicht so sehr in der Ansicht der Stadt selbst liegt, als vielmehr in der getreuer. Wiedergabe der südwestlichen Vorstädte, die 1529 größtenteils für immer in ihrer früheren Anlage verschwunden sind. Ein weiterer Gemäldestreifen, der etwa in Augenhöhe an der Nordwand angebracht war, gegenwärtig allerdings bis zum erhöhten Fußboden reicht, entstanden bald nach 1283, ist, abgesehen von seiner künstlerischen Qualität, berufen, die besondere Aufmerksamkeit der Forscher auf dem Gebiete der österreichischen Rechts- und Geschichtskunde zu erzwingen. Stellt er doch die Belehnung Albrechts I. durch seinen Vater, den römischen König Rudolf I. porträt- und kostümgetreu dar. Außerdem wurden am Eingang zum südlichen Turmgeschoß weitere Spuren von Malereien entdeckt, die ahnen lassen, wie prunkvoll farbig dieser festliche Raum einmal gewirkt haben muß.
Gegenwärtig ist das Problem der Notbedachung das vordringlichste. Einen ganz großen Freund und Wohltäter hat der arme Dom in dem ungewöhnlich trockenen Wetter gefunden. Was geschehen wäre, wenn längere schwere Regenperioden eingesetzt hätten, daran nur zu denken läßt erschaudern. Ein kaum zwei Tage anhaltendes Schlechtwetter hat in den großen feuchten Flecken, die allsogleich an der Unterseite des Gewölbes sichtbar wurden, sein Menetekel aufregend genug angekündigt.
Volle Übereinstimmung aller Stellen ist hinsichtlich der Form und Größe der Dachhaut gegeben. Nach außen hin muß der frühere Zustand und Anblick wieder hergestellt werden. Die spätgotischen Werkleute wußten sehr genau, was sie wollten, als sie über das planvoll gefügte System des Lärchengerüstes die mächtigen Flügel der Dachflächen breiteten. Jede Veränderung, besonders in den Größenverhältnissen müßte die sinnvolle Bezogenheit der einzelnen Bauglieder des Domes heillos ins „Schwimmen“ bringen.
Heftige Diskussion hat sich -nun aber darüber entzündet, ob der Dachstuhl in Eisen oder Eisenbeton auszuführen sei. Die Anhänger letztgenannter Richtung haben für ihre Konstruktionsart als schwerwiegende Gründe beizustellen die bessere ästhetische Wirkung, die größere Billigkeit des Herstellens und. den völligen Wegfall aller Erhaltungskosteri bei einer so gut wie unbegrenzten Haltbarkeit, schließlich die einwandfreie Sicherheit in Feuersgefahr. Die Vertreter der Eisenkonstruktion führen als Hauptargument dagegen an, daß eine Beton-lösung die Pfeiler viel zu schwer belaste (was allerdings von der Gegenseite wieder bestritten wird) und daß jene Elastizität dem Winddruck gegenüber, die das geniale Geheimnis des alten Holzgerüstes war, fehle. Autoritäre Fachgutachten stehen gegen ebensolche der anderen Richtung. Bei der entscheidenden Bedeutung, die die Lösung dieser Frage für den Weiterbestand der ganzen Kirche hat, müßte jede voreilige Entschließung verhängnisvoll werden.
Zur Zeit, allerdings schon in zwölfter Stunde, kann dank der tatkräftigen Hilfe der Alliierten unter Leitung von Major N i c h o 11 s vom britischen Hauptquartier eine provisorische, leichtgewölbte, schützende Eisenbetondecke über dem Mittelgewölbe des Hauptschiffes aufgeführt und auch die Chorpartie durch eine provisorische Holzbedachung vor den Einflüssen der winterlichen Witterung gesichert werden, wozu auch' die Gemeinde Wien ausgiebigen Beitrag leistet.
Aufklärung über das geplante Bauprogramm in nächster und ferner Zeit wird von der begreiflicherweise ungeduldigen Öffentlichkeit immer wieder gefordert. Ihre Beantwortung hängt aber von zu vielen Imponderabilien ab, um befriedigend beantwortet werden zu können. Man wird sich jedenfalls davor hüten müssen, zweite und dritte Schritte vor den ersten zu machen.
Aller Augen In Wien und in der übrigen Kulturwelt sind auf die Wiederherstellung dieses Kult- und Kulturgutes ersten Ranges gerichtet. Das christliche Volk verfolgt den Fortschritt mit dem bangen Herzklopfen und der unverlierbaren stillen Hoffnung einer Mutter, die das Ergebnis des Ärztekonsiliums am Bette ihres schwerkranken Kindes abwartet. Es wird bald sich beruhigen können.
Die ■ echt christlich empfindende anima meditans kennt allerdings das Wort „Katastrophe“ auch für solches Fanal der Zerstörung im Vertrauen auf die göttliche Vorsehung nicht. Es überkommt uns die Ahnung, ob nicht der Herr unserer in mehr als einer Hinsicht etwas veräußerlichten Religiosität mit wuchtigem Schlag das Wort der Bergpredigt in Erinnerung bringen wollte: Ist nicht der Leib mehr als das Kleid? (Matth. 6, 25.) Der mystische' Leib Christi, sichtbar in seiner Kirche, trägt die Herrlichkeit der christlichen Kunst als seinen Krönungsmantel. Aber das richtig Herrscherliche verliert seine Würde nicht mit dem Wegfall der Insignien, im Gegenteil erweist ihr Verlust erst recht, daß sie doch nur Zutat sind, die das Wesen nicht berühren, das nun erst recht in seiner unzerstörbaren Gültigkeit erkennbar wird.