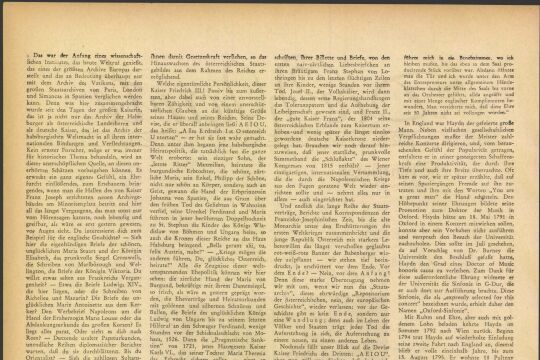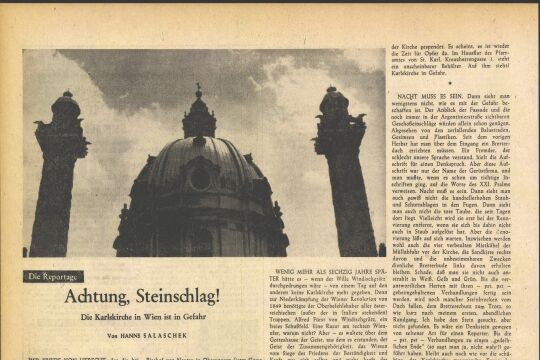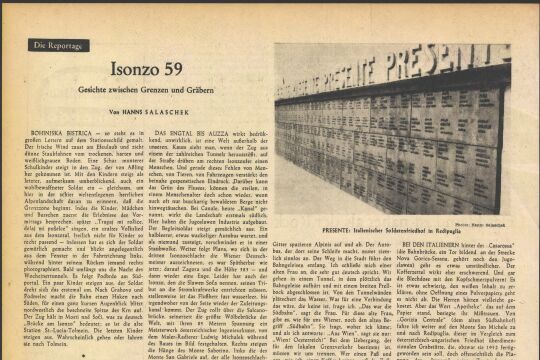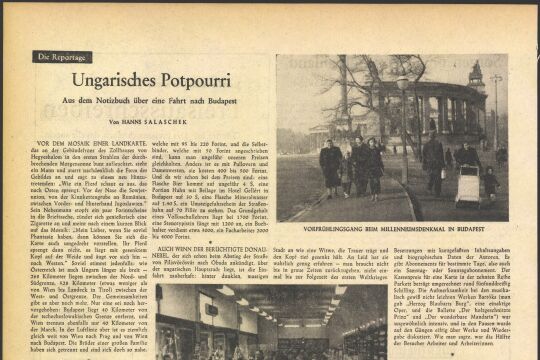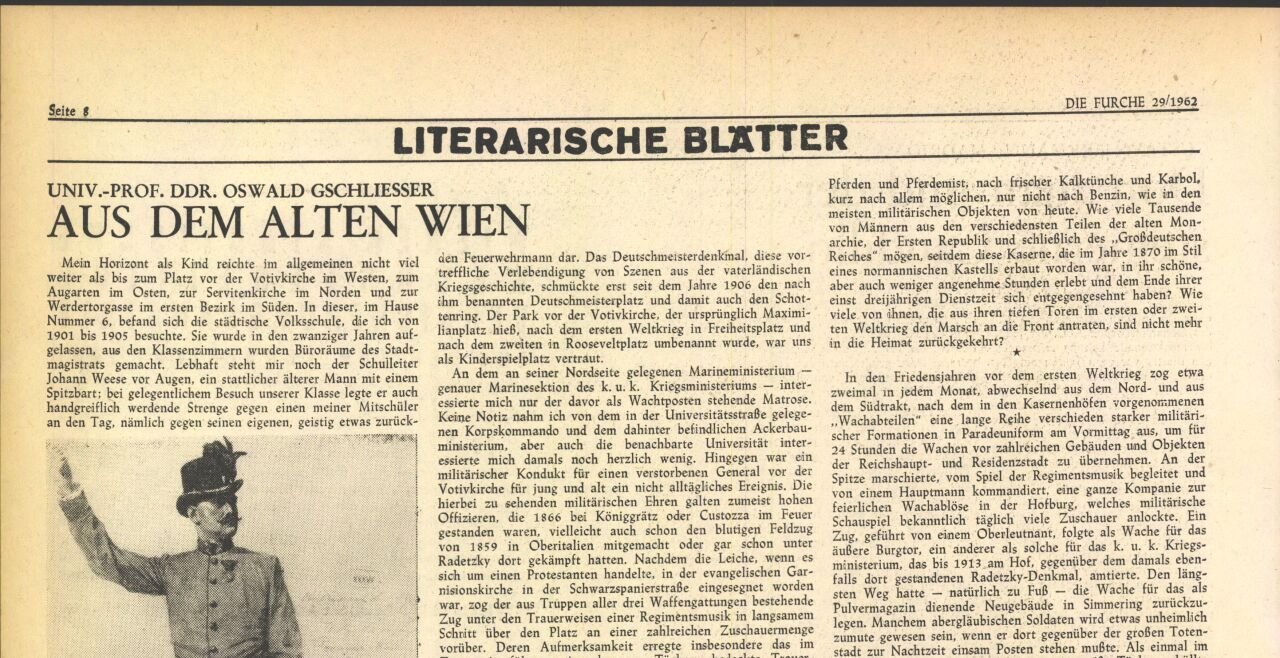
Mein Horizont als Kind reichte im allgemeinen nicht viel weiter als bis zum Platz vor der Votivkirche im Westen, zum Augarten im Osten, zur Servitenkirche im Norden und zur Werdertorgasse im ersten Bezirk im Süden, In dieser, im Hause Nummer 6, befand sich die städtische Volksschule, die ich von 1901 bis 1905 besuchte. Sie wurde in den zwanziger Jahren aufgelassen, aus den Klassenzimmern wurden Büroräume des Stadtmagistrats gemacht. Lebhaft steht mir noch der Schulleiter Johann Weese vor Augen, ein stattlicher älterer Mann mit einem Spitzbart; bei gelegentlichem Besuch unserer Klasse legte er auch handgreiflich werdende Strenge gegen einen meiner Mitschüler an den Tag, nämlich gegen seinen eigenen, geistig etwas zurückgebliebenen Sohn. Der Herr Direktor ist zweifellos längst in den ewigen Ruhestand getreten, von den einstigen Lehrern und Lehrerinnen könnte aber noch die eine oder die andere, damals ganz junge Kraft, hochbetagt leben. Den katholischen Religionsunterricht erteilten zwei Priester des Schottenstiftes, P. Jakob Wieser und P. Wenzel Czepa, der, ein glänzender Kanzelredner, die vielbesuchte 11-Uhr-Sonntagspredigt in der Schottenkirche hielt. Von meinen einstigen Mitschülern dürften gerade die aus wohlhabenden Familien stammenden, zum großen Teil während des zweiten Weltkrieges sehr traurig geendet haben, wurde doch die Schule von sehr vielen Kindern der in diesem Viertel wohnhaften und tätig gewesenen jüdischen Kaufleuten, namentlich der Textilbranche, besucht.
Auf meinem Schulweg mußte ich den Schottenring übersetzen. Wenn auch zu Beginn des Jahrhunderts ein Auto oder, wie man damals sagte, ein Automobil, ebenso ein Motorrad, eine große Seltenheit darstellte, so war das Überqueren der Ringstraße keinesweg gefahrlos. Man mußte außer auf die Einspänner auf die nicht wenigen in scharfer Gangart daherkommenden Fiaker oder Gummiradier sowie auf die Straßenbahnwagen achtgeben. Die ersten Jahre lang rollten noch von Pferden gezogene Wagen neben solchen von elektrischer Kraft betriebenen über die Trambahnschienen der Straßen Wiens, bis dann, wie ich mich noch erinnern kann, an einem schönen Frühlingstag des Jahres 1903 ein letztes Mal Pferde, zum Abschied mit Blumen und Bändern geschmückt, auf den Geleisen einhertrabten. Die unförmlichen, stark rüttelnden Stellwagen (Omnibusse), die für 10 oder 20 Heller den Fahrgast bis zum Stephansplatz brachten, holperten pferdebespannt noch etliche Jahre länger über das unebene Pflaster der Inneren Stadt. Die Straßenbahnwagen hatten in den Signalscheiben nicht, wie nun schon lange Zeit, durchweg Nummern oder Buchstaben, sondern erstere überhaupt nicht und letztere nur ausnahmsweise. Die meisten Linien waren vielmehr voneinander durch verschiedenfarbige Figuren in den Scheiben, wie Ringe, Kreuze, Sterne, Dreiecke, Streifen und dergleichen zu unterscheiden. Ein vollkommen weißer Kreis kennzeichnete einen auf dem kürzesten Weg bis zum Ring oder Franz-Josephs-Kai fahrenden Wagen. Weiße Scheiben mit Buchstaben gab es vier: Ein großes A (..Abzweigung“) zeigte einen auf Umwegen dorthin fahrenden, ein S („Stadt“) einen in das Innere des ersten Bezirkes vordringenden, ein R einen von irgendeinem äußeren Bezirk kommenden und den Ring rechts umkreisenden und ein
L einen solchen ihn links umkreisenden Wagen an.
Die Fahrbahn des Schottenringes säumte, wie auch noch gegenwärtig, beiderseits Baumalleen, doch war seinerzeit die äußere von ihnen, weil für Reiter bestimmt, mit Gerberlohe bestreut. Auf dieser Seite fesselten die Augen des vom Donaukanal zum Schottentor gehenden Knaben zunächst die in einer Tabaktrafik (heute Schottenring Nr. 35?) ausgestellten Bufallo-Bill-Indianerhefte und die Nick-Carter-Kriminalhefte. Mit Respekt schritt man an der Neubarockfront des Gebäudes der Polizeidirektion und mit einem leichten Schaudern an dem an der Stelle des abgebrannten Ringtheaters in ernster Neugotik erbautem Sühnehaus vorbei. Bei dem dazwischen gestandenen Häuserblock entzündete sich die kindliche Phantasie am färbigen, großen Aushängeschild eines Geschäftes für Leitern; es stellte einen auf einer unheimlich langen Leiter dem Mond zustrebenden Feuerwehrmann dar. Das Deutschmeisterdenkmal, diese vortreffliche Verlebendigung von Szenen aus der vaterländischen Kriegsgeschichte, schmückte erst seit dem Jahre 1906 den nach ihm benannten Deutschmeisterplatz und damit auch den Schottenring. Der Park vor der Votivkirche, der ursprünglich Maximilianplatz hieß, nach dem ersten Weltkrieg in Freiheitsplatz und nach dem zweiten in Rooseveltplatz umbenannt wurde, war uns als Kinderspielplatz vertraut.
An dem an seiner Nordseite gelegenen Marineministerium — genauer Marinesektion des k. u. k. Kriegsministeriums — interessierte mich nur der davor als Wachtposten stehende Matrose. Keine Notiz nahm ich von dem in der Universitätsstraße gelegenen Korpskommando und dem dahinter befindlichen Ackerbauministerium, aber auch die benachbarte LIniversität interessierte mich damals noch herzlich wenig. Hingegen war ein militärischer Kondukt für einen verstorbenen General vor der Votivkirche für jung und alt ein nicht alltägliches Ereignis. Die hierbei zu sehenden militärischen Ehren galten zumeist hohen Offizieren, die 1866 bei Königgrätz oder Custozza im Feuer gestanden waren, vielleicht auch schon den blutigen Feldzug von 1859 in Oberitalien mitgemacht oder gar schon unter Radetzky dort gekämpft hatten. Nachdem die Leiche, wenn es sich um einen Protestanten handelte, in der evangelischen Gar-nisionskirche in der Schwarzspanierstraße eingesegnet worden war, zog der aus Truppen aller drei Waffengattungen bestehende Zug unter den Trauerweisen einer Regimentsmusik in langsamem Schnitt über den Platz an einer zahlreichen Zuschauermenge vorüber. Deren Aufmerksamkeit erregte insbesondere das im Zuge mitgeführte, mit schwarzen Tüchern bedeckte Trauerpferd und ein vor den Leidtragenden eingeteilter geharnischter Reiter mit gezogenem Schwert; die Rüstung mit geschlossenem Visier verbarg einen Unteroffizier. Die in entwickelter Linie aufgestellten Fußtruppen leisteten beim Passieren des Leichenwagens die Ehrenbezeigung, die Fahne senkte sich und eine Ehrensalve schloß die eindrucksvolle Trauerfeier ab. Die Infanterie rückte, während der Leichenwagen dem Friedhof zurollte, unter flotten Märschen nach Entfernung der schwarzen Tücher von den Trommeln und des Trauerflors von der Fahne in die Kaserne ab.
Eine solche gab es zu Beginn des Jahrhunderts in unmittelbarer Nähe der Votivkirche, nämlich die auf dem heutigen Otto-Wagner-Flatz gestandene Alserkaserne. Nicht viel weiter entfernt, aber in anderer Richtung lag und liegt noch heute die Roßauer- oder Kronprinz-Rudolf-Kaserne, wie sie offiziell hieß. In deren, dem Schlickplatz zugekehrten Südtrakt, war zur Jahrhundertwende das 3. Regiment der Tiroler Kaiserjäger und nach ihm ein bosnisch-herzegowinisches Infanterieregiment einquartiert, im Mitteltrakt hingegen befand sich stets ein Kavallerieregiment, für dessen Dragoner oder Ulanen der mittlere der drei Kasernenhöfe als Reitschule eingerichtet war. In dem dem - Donaukanal zunächst gelegenen Nordtrakt waren von 1901 bis ' 1908 der Stab und drei Bataillone des oberungarischen k. u. k. Infanterieregiments Freiherr von Appel Nummer $>0, dessen Mannschaft sich aus der weingesegneten Gegend von Erlau (Eger) ergänzte und stahlgrüne Aufschläge hatte, untergebracht.
Der Haupteingang zum Nordtrakt, ebenso wie der zum Mittelteil, mit der täglich abgelösten Kasernenwache, lag gegenüber dem Labyrinth des im Jahre 1864 hierher verlegten Tandel-marktes, in dessen dunklen Gängen, eng über- und nebeneinander gestapelt, allerhand Altwaren eines Käufers harrten. Heute erhebt sich an seiner Stelle das elf Stock hohe Gebäude der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter. Der andern Längsseite des Tandelmarktes gegenüber lagen am Ende der Berggasse zu Beginn dieses Jahrhunderts noch einstöckige Vorstadthäuser, die dann im Jahre 1902 niedergerissen wurden, um den Neubauten der Telephonzentrale und des Polizeigefängnisses Platz zu machen.
Doch zurück zur Roßauer Kaserne. In der schönen Jahreszeit konnte man oft in den Abendstunden aus ihren am Ende der Türkenstraße gelegenen Mannschaftszimmern Zigeuner, welche beim sogenannten ungarischen Regiment dienten, fidein hören. Die ungarischen Soldaten litten in Wien gewiß nicht Hunger; sonst hätten sie nicht wiederholt aus den Fenstern auf den Rasen vor der Kaserne Kommißbrot geworfen, das von armen Zivilisten dankbar aufgelesen wurde. In der Kaserne selbst roch es, zum Teil in eigenartigen Verbindungen, nach diesem militärischen Schwarzgebäck, nach Gewehrfett und Mannschaftsschweiß, nach
Pferden und Pferdemist, nach frischer Kalktünche und Karbol, kurz nach allem möglichen, nur nicht nach Benzin, wie in den meisten militärischen Objekten von heute. Wie viele Tausende von Männern aus den verschiedensten Teilen der alten Monarchie, der Ersten Republik und schließlich des „Großdeutschen Reiches“ mögen, seitdem diese Kaserne, die im Jahre 1870 im Stil eines normannischen Kastells erbaut worden war, in ihr schöne, aber auch weniger angenehme Stunden erlebt und dem Ende ihrer einst dreijährigen Dienstzeit sich entgegengesehnt haben? Wie viele von ihnen, die aus ihren tiefen Toren im ersten oder zweiten Weltkrieg den Marsch an die Front antraten, sind nicht mehr in die Heimat zurückgekehrt?
In den Friedensjahren vor dem ersten Weltkrieg zog etwa zweimal in jedem Monat, abwechselnd aus dem Nord- und aus dem Südtrakt, nach dem in den Kasernenhöfen vorgenommenen „Wachabteilen“ eine lange Reihe verschieden starker militärischer Formationen in Paradeuniform am Vormittag aus, um für 24 Stunden die Wachen vor zahlreichen Gebäuden und Objekten der Reichshaupt- und Residenzstadt zu übernehmen. An der Spitze marschierte, vom Spiel der Regimentsmusik begleitet und von einem Hauptmann kommandiert, eine ganze Kompanie zur feierlichen Wachablöse in der Hofburg, welches militärische Schauspiel bekanntlich täglich viele Zuschauer anlockte. Ein Zug, geführt von einem Oberleutnant, folgte als Wache für das äußere Burgtor, ein anderer als solche für das k. u. k. Kriegs-msnisterium, das bis 1913 am Hof, gegenüber dem damals ebenfalls dort gestandenen Radetzky-Denkmal, amtierte. Den längsten Weg hatte — natürlich zu Fuß — die Wache für das als Pulvermagazin dienende Neugebäude in Simmering zurückzulegen. Manchem abergläubischen Soldaten wird etwas unheimlich zumute gewesen sein, wenn er dort gegenüber der großen Totenstadt zur Nachtzeit einsam Posten stehen mußte. Als einmal im Mondenschein vom Friedhof her eine in weiße Tücher gehüllte Gestalt sich einem Posten näherte und auf dessen Haltruf nicht stehen blieb, gab dieser einen Schuß ab. Der Spaß, den sich ein Bursche gegenüber der Wache herausgenommen hatte, kostete jenem das Leben. Zwei Wachabteilungeh zweigten am Anfang des Kai über die Augartenbrücke nach Norden ab, die eine von ihnen bezog wahrscheinlich die Wache vor dem großen Militärbettenmagazin in der Oberen Donaustraße, die andere die Wache vor dem Palais des Erzherzogs Otto im Augarten. Es standen ja vor der Behausung eines jeden Erzherzogs Ehrenposten. Der Eingang des Augartens wurde von Militärinvaliden, die hellblaue Mäntel mit roten Aufschlägen trugen, bewacht. Diese ergrauten Veteranen von denen mancher, auf den Schlachtfeldern Böhmens. Oberitaliens oder in Bosnien ein Bein oder einen Arm verloren hatte, fungierten in jenem Park auch als von uns Kindern mit Ehrfurcht oder Furcht betrachtete Aufseher.
Die Augartenbrücke über ' den Donaukanal hieß offiziell Maria-Theresien-Brücke. Im Jahre 1873 errichtet, verband sie mit ihren eisernen Ketten und ihrem Eisengestänge, gespannt zwischen den mit überlebensgroßen weiblichen Bronzefiguren besetzten Steinpfeilern, die Leopoldstadt mit dem anderen Ufer des Donaukanals sinnfälliger als die an ihrer Stelle zu Beginn der dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts «s-richtete, viel breitere, aber auch nüchterne Brücke, und jene Hängebrücke schnitt trota ihrer Höhe dem vom Kai gegen den Kahlenberg Schauenden das schöne Stadtbild nicht- so schroff entzwei, als es jetzt der Ringturm der Städtischen Versicherung tut. Während sich heute vor der Stadtbahnhaltestelle Schottenring Grünanlagen ausbreiten, umgaben sie zu Beginn des “Jahrhunderts Obst- und Gemüse-standeln. Unterhalb dieses Marktes, am sogenannten Schänzel, wurden unmittelbar am Ufer des Kanals Fische verkauft. Auf der Roßauer Lände schleppten in der warmen Jahreszeit Männer mit nackten Oberkörpern — damals ein ungewohnter Anblick — aus großen, Lastkähnen auf Schubkarren Granitwürfel aus Mauthausen, die Pflastersteine Wiens, ans Ufer. Aus den Galerien der Stadtbahn qualmte dichter schwarzer Rauch, sooft ein Zug durchfuhr. Vom jenseitigen Ufer trat die Dampftrambahn nach Floridsdorf die Fahrt an; das Stationsgebäude steht heute noch am Eingang des Wettsteinparkes. Aus viel älterer Zeit, nämlich aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, hat sich auf der anderen Seite der Augartenbrücke im heutigen Wilhelm-Kienzl-Park die St.-Johann-Nepomuk-Kapelle erhalten, die bis 1884 am stadt-seitigen Ufer am Schanzl stand. Ein Priester des Schottenstiftes las vor dem ersten Weltkrieg jeden Sonntag in diesem viel zu wenig beachteten Juwel barocker Baukunst um zehn Uhr eine heilige Messe.
Einige Zeit nach der Ermordung des Königs Alexander von Serbien und seiner Gemahlin Draga Maschin in der Nacht zum Fronleichnamstage des Jahres 1903 — die Bluttat machte auch auf die Wiener größten Bindruck — war ein paar Wochen lang die Donaujacht dieses letzten serbischen Königs aus dem Hause Obrenovitsch im Donaukanal neben der Augartenbrücke zu sehen. Noch eine welthistorische Erinnerung ist für mich mit dessen Gestade verknüpft: Im Jahre 1902 erregte dort mein Interesse ein Soldat in gelbbrauner Kolonialuniform. Es war, wie mir mein Vater erklärte, ein auf der Heimreise nach Deutschland Wien passierender Mann des deutschen Expeditionskorps, das gleich solchen anderer Großmächte den fremden- und christenfeindlichen sogenannten Boxeraufstand in China niederschlagen geholfen hatte. Die mehrstöckigen, im Stil des Neubarock oder der Neurenaissance errichteten Wohnhäuser, welche den Eingang der Unteren Augartenstraße flankierten, wurden im zweiten Weltkrieg von den Bomben zerstört, aber auch so manches noch ältere Haus in dieser Straße hat nach dem Krieg einem Neubau weichen müssen.
Aber zurück auf das rechte Ufer des Donaukanals. Im ersten und zweiten Stock der Schmalfront des Nordtraktes der Kaserne lagen diie Offizierswohnungen. In einer von ihnen wuchs auch ich seit dem siebenten Lebensjahr auf. Nicht nur das häufig aus- und einmarschierende Militär lockte uns Kinder immer wieder an die aussichtsreichen Fenster. Wir stürzten zu diesen insbesondere auch, wenn die Feuerwehrtrompete rasch hintereinander in erregender Quart erscholl und ein paar pferdebespannte, mit Feuerwehrmännern, Leitern und Schläuchen beladene offene Wagen, zuletzt oft der mit der großen Leiter, über die Augartenbrücke jagten.
In der Maria-Theresien-Straße, gegenüber der Langfront der Kaserne, gab es ein Geschäft für Peitschen, ein damals noch viel gefragter Artikel. In fast nicht abreißender Kette zogen, in der Regel vom Nordbahnhof kommend, über die mit Recht einst so genannte Lastenstraße, das ist über einen großen Teil der
Strecke der heutigen Zweierlinie — starke Gäule schwere, zumeist mit Kohle beladene Fuhrwerke. Nicht bloß Geschäfte, die außer Gebrauch oder Mode gekommene Ware führten, sind im
Laufe des letzten Halbjahrhunderts aus den Straßen und Gassen des Schottenviertels verschwunden, sondern auch nach sehr vielen anderen Läden mit auch heute noch begehrten Dingen wird man nun vergeblich suchen.
Für das Wiener Straßenbild in den Jahren vor dem ersten Weltkrieg waren nicht nur das Militär — einzeln oder in Abteilungen —, rasch dahin trabende Fiaker, von galoppierenden Pferden gezogene Feuerwehrwagen, Hofwagen mit vergoldeten Rädern sowie livrierten Kutschern und Lakaien, Wachmännern mit Spitzhelm, Herren mit Zylinder und elegante Damen, die am Sonntag vormittag mit mächtigen Hüten, Gesichtsschledern und langen, bis zum Boden reichenden Röcken auf dem Ring promenierten, charakteristisch, es gehörten dazu auch Typen wie die Bosniaken und die Gottscheeberer — erstere nach ihrer bosnischen Tracht und Herkunft, letztere nach ihrer Heimat Gottschee in Krain so genannt —, die beide in flachen großen Körben allerhand Gebrauchsartikel oder Schleckereien feilboten, ferner der Sodawasser-, der Brezel- und der Werkelmann, dessen Drehorgel übrigens auch in der Zeit der ersten Republik noch nicht ganz verstummt war. Des Abends schritt in den Straßen von Laterne zu Laterne ein mit ockergelbem Kittel bekleideter Mann, um mit einer langen Stange die Gasstrümpfe aufleuchten zu lassen. Von Zeit zu Zeit legte denselben Weg bei Tag ein mit einer Leiter ausgerüsteter Mann, der Laternenputzer, zurück. Aber das sind Bilder der Erinnerung aus dem alten Wien, die nicht auf das Schottenviertel beschränkt waren und daher über den Rahmen dieses Aufsatzes hinausreichen. Dieser wollte ja nur einen örtlichen Ausschnitt aus dem Wien vor mehr als einem halben Jahrhundert geben und bei manchem alten Wiener ähnliche Erinnerungen wecken, der jüngeren Generation aber den Wandel der Zeiten deutlich machen.