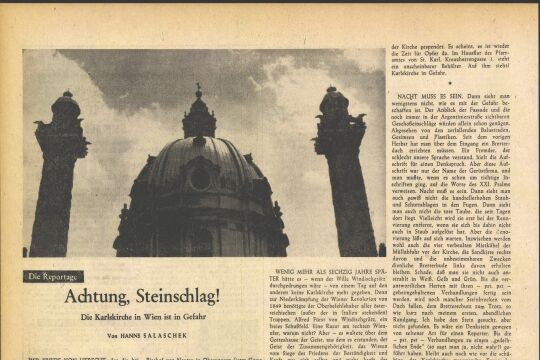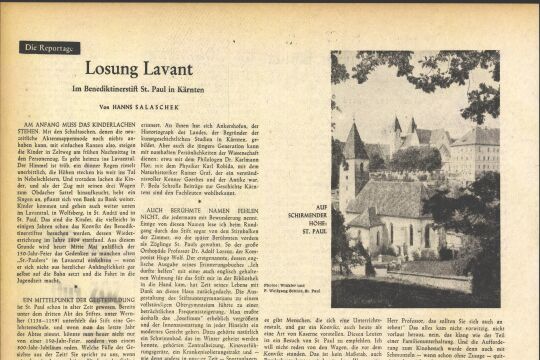Jeder der Bezirke zwischen dem Ring und dem Gürtel hat sein eigenes Gesicht, sein eigenes Fluidum, seine Individualität, geprägt von den topographischen Gegebenheiten der alten Vorstädte. Ja, man könnte sagen, der eingesessene und gelernte Wiener vermöchte nach dem Baucharakter, der Breite und Neigung der Straßen und vielen kleinen Einzelheiten, lokalen Unwägbarkeiten, sehr rasch zu erkennen, wo er sich befindet, wenn man ihn mit verbundenen Augen in ein bestimmtes Viertel führte und ihm dann die Binde abnähme. Er müßte sich erst gar nicht nach Straßen tafeln oder Nummernschildern orientieren.
Allen diesen Stadtteilen ist der Wechsel von Steigung und Senke gemeinsam, in großen Bodenwellen hügelan führend und wieder, einmal sanfter, einmal steiler ausschwingend. Uralter Weinboden liegt unter den Pflastersteinen und dem Asphalt, wer im Sonnenschein des hohen Sommermittags über diese Häuserhänge geht, der bekommt eine Vorstellung davon, daß die Hauer hier gute Fechsungen zu erwarten hatten, wo jetzt nur die harte Straßenrinde und die Mauern die Hitze zurückstrahlen. Von oben in der Überschau betrachtet: das sprichwörtliche Häusermeer, , die nivellierende Dächerflut mit ihren architektonischen Bojen, ihren ziegelfarbenen Riffen und ihren kreideweißen Klippen, den Hochhäusern. Aus der Nähe gesehen: in jedem Bezirk eine bestimmte, eigene Atmosphäre, ja geradezu ein unverkennbar eigenes Spiel der Lichter und der Schatten, der Genius loci, nicht in anspruchsvoller Drapierung, sondern im oftmals bescheidenen Gewand.
Nicht von ungefähr wählte ein international bekannter Filmregisseur nach eingehender Motivsuche in Wien Teile des dritten Bezirkes als Drehorte für Außenaufnahmen zu einem Technicolor-Schinken über die morganatische Liebe des Zaren Alexander II. „Diese Straßenzüge haben so etwas östliches“, meinte er. Die Assoziation ist nicht von der Hand zu weisen. Im Weißgerber-Viertel etwa, mit seinen trist-nüchternen Gassen aus den vierziger und fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mag man an Czernowitz, Lemberg, Krakau oder Kiew denken, hier könnten irgendwo die Menschen der Dostojewski-Welt hausen, östlich auch die Breite der Landstraße und des unteren Rennwegs, geschaffen für den Trieb von Rinderherden aus Ungarn.
Völlig anders etwa der neunte Bezirk in seiner Mischung von nobler josephinischer Einfachheit und kühler großbürgerlicher Zurückhaltung. Heimito von Doderer durchstieß die Oberfläche des alltäglich Vertrauten und entdeckte die Magie dieser Straßen rund um die Strudelhof-Stiege.
Die engste innere Verwandtschaft unter den alten Vorstädten aber haben die Wieden und die Josefstadt. In beiden verbindet sich die schöne Ausgewogenheit ererbter Lebensund Bauformen mit einem gewissen Zug zum
aristokratischen Wesen. Sie sind vielleicht jene Viertel zwischen Ring und Gürtel, in denen das spezifisch österreichische der Atmosphäre am stärksten zum Ausdruck kommt. In manchen der Seitengassen, wo die Zeile der ein- und zweistöckigen Wohnhäuser aus dem Spätbarock und der josephinischen Epoche kaum durch hohe, später errichtete Bauten unterbrochen ist, könnte man sich — und sei es auch nur für kurze Augenblicke, bis sich zum Weitergehen andere Perspek
tiven eröffnen — in irgendeine typische altösterreichische Garnisonsstadt irgendwo zwischen Prag und Agram versetzt fühlen. Ist es nicht voll tieferen Sinnes, daß gerade hier ein so herrliches Stück Österreich wie das Theater in der Josefstadt bewahrt blieb?
Aus Florenz, wo sein Ahnherr, geschworener Feind der Medici, in einem schweren, trotzigen Palazzo residiert hatte, kam Peter Graf Strozzi nach Österreich und trat in kaiserliche Dienste. Der Neunzehnjährige begleitete den Grafen Trauttmansdorff zu den ersten Friedensverhandlungen nach Münster und Osnabrück. Bei Beginn neuerlicher Kämpfe
gegen die Schweden trat er kurz entschlossen als gemeiner Pikenier in die Armee ein, wurde bald zum Offizier ernannt und focht 1654 als Oberst eines kaiserlichen Regiments in Italien. Damals war er achtundzwanzig Jahre alt, ein Fremdling, ohne Protektion, ohne Rücksicht auf erforderliche Dienstjahre, nur in Würdigung seiner Leistungen so rasch befördert. Wen wundert es angesichts der Karriere dieses tüchtigen Obristen, daß einige Jahrzehnte später ein anderer Fremd-
ling durch sein militärisches Genie noch rascher zu hohem Rang aufsteigen sollte?
Auch gegen die Türken bewährte sich Strozzi, ebenso in diplomatischen Missionen. Ein Mann des Schwertes und der Feder, wie man früher in solchen Fällen gern sagte, gleich einem anderen Wahlösterreicher nach ihm, dem Fürsten von Ligne. Als Graf Strozzi, bereits Feldmarschalleutnant und Hofkriegsrat, im Alter von achtunddreißig Jahren starb, ließ ihn der Kaiser in der Gruft der Augustinerkirche beisetzen.
Um volle fünfzig Jahre überlebte ihn seine Witwe, eine Tante des nachmaligen Feldmarschalls Khevenhüller. Sie erwarb das Gebiet des „dürren Lerchenfelds“ zwischen der heutigen Lerchenfelder Straße und der Josefstädter Straße. Nur wenige Menschen hausten auf diesem seit der Türkenbelagerung verwüsteten Grund, einfaches Volk, „Flecksieder“ und hofbefreite Handwerker. So wurde diese Gegend zum „Strozzigrund“, den man bald als die kleinste in die Reihe der Vorstädte aufnahm. Auf der Höhe der Josefstädter Straße ließ die Gräfin einen Sommerpalast erbauen und einen weitläufigen Garten anlegen. Rundum breitete sich Brachland, zogen sich da und dort schmale Weingärten hangaufwärts.
Nach ihrem Tod ging das Palais an einen Spanier über, an Antonio Francisco Folco de Cardona, Erzbischof von Valencia. Der Kirchenfürst hatte sich während des Spanischen Erbfolgekrieges offen als Anhänger Karls VI. bekannt und war schließlich nach Österreich ins Exil gegangen, in ein hochfeudales Exil, wo ihm die Huld seines Herrschers gewiß war, der sich bis zu seinem Lebensende eine große Vorliebe für alles Spanische bewahrte. Salomon Kleiner, der Architekturzeichner des barocken Wien, überliefert uns in seinen „Vorstellungen angenehmer und zierlicher Grundrisse der Lusthäuser und Projekte, welche außerhalb der Statt Wien sich befinden“ ein Bild des Strozzi-Palais, wie es
um 1720 aussah: es ist einer der verschwundenen Adelssitze vor den Basteien in jenem Nachmittagslicht, wie es Canaletto bei seinen Wieher Veduten liebte. Nicht groß, aber großzügig im Konzept, mit Figuren und Trophäen auf den Firsten und einer breiten, von Atlanten gestützten Freitreppe. Durch den Vorhpf, am kreisrunden Becken mit hoher Fontäne vorbei, fährt eben eine vierspännige Karogse zum Tor, voran eiligen Schrittes ein Läufer, kostümiert wie einer der Heroen aus einer, Barockoper.
Maria Theresia schenkte den Besitz dem Feldzeugmeister Johann Karl Graf Cho tek, der zwar offenbar keine Lorbeeren auf dem Schlachtfeld errungen, dafür aber das wichtige Į Problem der Truppenverpflegung in vorbildlicher Weise gelöst hatte. Seine Erben vermieteten das Schlössel auf dem Strozzi- grund. In einem winzigen Zimmer des Wirtschaftsgebäudes wohnte ein blutarmer, unbekannter junger Maler namens Friedrich Amerling. Als berühmter Mann kehrte er nach einem Italienaufenthalt zurück und bezog im Palais ein elegantes Appartement; in seineh Salon lud er Künstler und die vor- nehme Welt Wiens regelmäßig zu Gast. Später übersiedelte er nach Mariahilf, und in dem alten Sommerpalast hielten die sitt- samen Zöglinge des k. k. Zivil-Mädchen- Pensionates ihren Einzug. Umbauten veränderten das Gesicht des Schlosses vollständig.
Den bescheidenen Stand von siebenundfünfzig Häusern hat die Vorstadt Strozzi- grund, die sich rühmen durfte, den österreichischen Bindenschild im Siegel zu führen, bis įu ihrer Eingliederung in den neuen achten Gemeindebezirk nie überschritten. Jahrzehntelang blieb der ursprüngliche Baucharakter weitgehend erhalten, in einer Geschlossenheit, wie sie in anderen Bezirken kaum noch zu finden war, und noch im Jahr 1928 ermittelten die emsigen Heimatforscher, daß (mehr als fünfzig Prozent des Haus- bpstandes auf dem alten Strozzigrund aus der Entstehungszeit, also der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, stammten!
Meist waren es einfache Leute, die in diesen schlichten, aber in ihrer Fassadengestaltung | so harmonischen Häusern mit den baumbestandenen Gärten wohnten: Handwerker, Hofkanzlisten, Lakaien, Wundärzte, aber auch Vertreter sonderbarer Berufe wie die Brateibrater (Vorläufer der Würstelmänner), die Zifferblattstecher und Münzgraveure, die Bierversilberer und die Beutelstricker, lauter Bezeichnungen, die an bunte Alt-Wiener Bilderbogen gemahnen. Der k. k.
Hoftrompeter Anton Weidinger erfand auf dem Strozzigrund die Klappentrompete, vielleicht Tür an Tür mit dem kaiserlichen Tafeldecker Andreas Schmaus, eine Figur, die nicht vielleicht von Nestroy erfunden wurde, sondern tatsächlich existierte, genauso wie jener Strumpfwirker mit dem unheimlichen Namen Böskraut, der aber sicherlich nicht im entferntesten daran dachte, den Leuten ein böses Kräutlein in den Trank zu mischend
Im Jahre 1878 erlebte die Strozzigasse ihre Sensation: Ein Schlossergeselle feuerte in mörderischer Absicht einige Schüsse auf seine Geliebte ab; glücklicherweise kam sie mit dem Leben davon. Passanten entwanden dem Gewalttäter den Revolver. Das Verbrechen gab auch auf lange Zeit Gesprächsstoff für den Tratsch vor den Haustoren.
Statt nüchterner Nummernschilder gab es auf dem Strozzigrund, wie überall in den Vorstädten, einprägsame Hauszeichen. Heute findet man kein einziges mehr, weder die „Sieben Gaben des Heiligen Geistes“ noch „Die Freundschaft Christi“ oder „Mariens guten Rath“. Hoffnungsvoll mag man das Tor geöffnet haben, über dem die Verheißung „Zur Möglichkeit“ stand, doch wie es schon so geht im Leben, erblickte man gleich zwei Häuser weiter als deutsames Symbol wechselnden menschlichen Schicksals das Verdikt „Zur Unmöglichkeit“ mit der sorgsam gemalten Darstellung eines Schiffes, das unter vollen Segeln einen Berg hinauffährt. Kein übles Gleichnis für vergebliches Bemühen!
„Zum I®rsikanerhut“ hieß seit den Napoleonischen Kriegen das Haus Strozzigasse 8, auf dem Platz unseres heutigen Verlagshauses. Der Holzhändler Gottfried Schrey- vogl hatte es 1772 erbaut und „Zum heiligen Ludwig“ benannt. Sein Sohn Josef besaß es nur zwei Jahre, lange bevor er seine ehrende Berufung als Hofburgtheatersekretär erhielt.
Nummer 6, etwas aus der Baulinie vorspringend, war ein schönes, zweistöckiges, barockes Bürgerhaus, das feuilletonistische
Spaziergänger sofort zu dem Ausruf „Ein Stückeri Alt-Wien!“ hinreißen würde, wenn es noch bestünde. Doch existiert es nicht mehr. Bis in die späten zwanziger Jahre beleuchtete man dort nur mit Petroleumlampen, im Parterre gab es eine echte, museumsreife Greißlerei. Baufällig geworden, mußte das Haus schließlich abgetragen werden. Längst schon nehmen dort große Rotationspapierrollen ihren Weg in dią Druckerei, wo einst das Fräulein Lintschi
vom Zwölferhaus der Greißlerin während des Mehleinwiegens von den Nummern erzählte, die sie, laut Traumbuch, im kleinen Lotto setzen wollte
Seit 1928 ist der Prozentsatz der Altstadthäuser des Strozzigrundes erheblich gesunken. Immer wieder kommen die Demolierer
in die Josefstadt und setzen mit der Spitzhacke endgültige Schlußpunkte. Mit sentimentaler Retrospektive und Klagen über die böse Gegenwart ist nichts getan. Doch, so wollen wir fragen, -gehören Erwägungen über eine den Verhältnissen der modernen Großstadt angepaßte Erhaltung des noch vorhandenen Bestandes „Zur Unmöglichkeit“ oder sollte es vielleicht doch einen gangbaren Weg Möglichkeit“ geben? ' , ■'