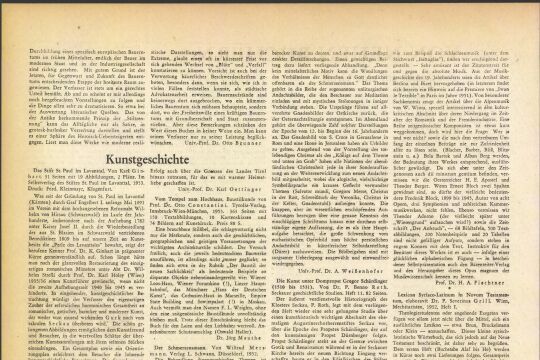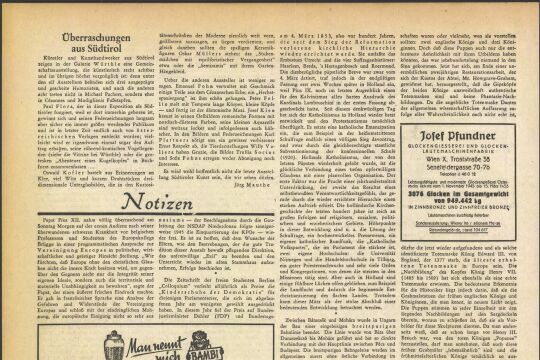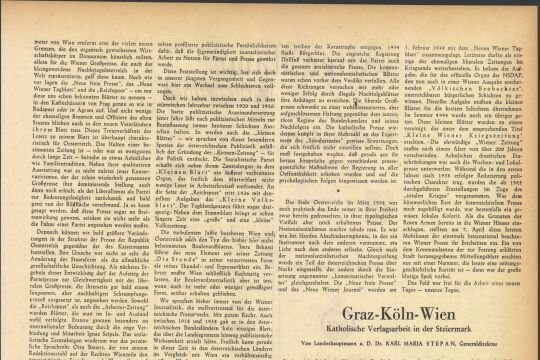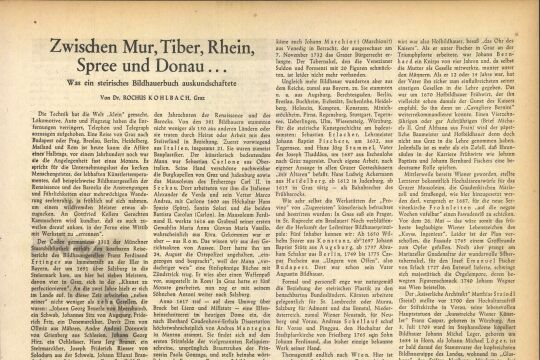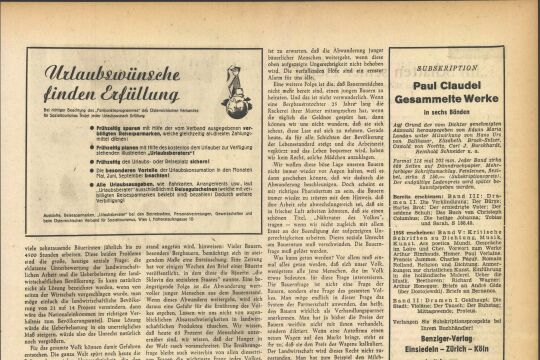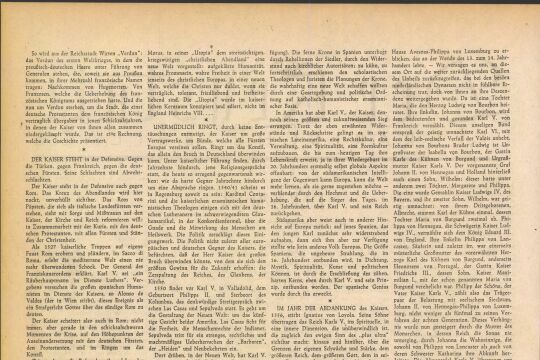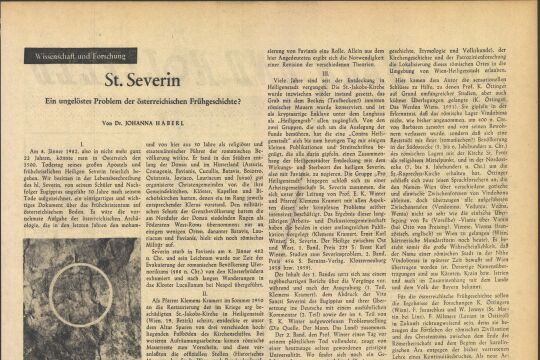Ein nicht geringer Teil des heutigen Österreichs lag zur Zeit der Babenberger noch außerhalb der heutigen österreichischen Grenzen, so Tirol, Kärnten und Salzburg. Diese Territorien fallen für eine Würdigung der Kunst zur Babenbergerzeit aus, was allerdings nicht so verstanden sein will, als wäre das sehr rührige künstlerische Schaffen jener Gebiete beziehunglos zu den gleichzeitigen Bestrebungen in den babenbergischen Landen gewesen. Salzburg zumal war ein so mächtiges künstlerisches Kraftzentrum, daß dessen Ausstrahlung sich auch im weiten Umkreis fühlbar machte. Aber auch die Steiermark, die damals außer ihrem heutigen Landgebiet und dem südlichen Viertel unter dem Wienerwalde auch den oberösterreidiischen Traungau mit Burg und Stadt Steyr umfaßte, kam erst 1192 unter Herzog Leopold V. (1177 bis 1194) unter babenbergische Oberhoheit. Umgekehrt wieder waren die Babenberger Leopold IV. (1136 bis 1141) und sein BruJer Heinrich Jasomirgott (1114 bis 1177) von 1139 bis 1156 Träger des bayrischen Herzogshutes, so daß streng genommen auch die Kunst Bayerns iener Zeit miteinbezogen werden müßte. Neben den Landesherren waren es besonders die geistlichen und weltlichen Grundherren, die als Auftraggeber oder wenigstens als Anreger und Förderer der Kunst aufscheinen. Der grundherrschaft-Liche Eigenbesitz der Landesherren war ja1 noch ein sehr beschränkter, der reichlbh durchsetzt war vom Besitz der Hochstifte und Bistümer Salzburg, Passau, Freising und jenem der deutschen Klöster und Abteien sowie dem mächtiger weltlicher Adeliger, die alle in ihrer Bautätigkeit durch ihre eigenen lokalen und Ordensüberlie'e-rungen sowie durch ihre landschaftlichen und verwandtschaftlichen Sonderbeziehungen bestimmt waren. Wer mit der Organisation und den Baugepflogenheiten der Zisterzienser einigermaßen vertraut ist, den wird es nicht befremden, in Heiligenkreuz burg“un-dischen Elementen zu begegnen; wer weiß, daß der Erzbischof Hartwig von Magdeburg aus dem mächtigen Geschlecht der Spanheimer und der ihm befreundete Abt Wilhelm von Hirsau die maßgebende Persönlichkeiten bei der Gründung St. Pauls waren, wird keine weitere Erklärung mehr suchen für die sächsisch-hirsauische Gestaltung dieser Klosterkirche in Kärnten. U'd so ließen sich viele Rätsel lösen, die aus der heimischen Überlieferung nicht oder nur teilweise zu erfassen sind.
Immerhin ist der unmittelbare Beitrag der Babenberger zur Bautätigkeit in ihren Landen bedeutsam genug. Klare Nadiweise lassen sich allerdings erst seit Leopold dem Dritten erbringen. Die älteste Ostmark, „eine winzige Grafschaft und eine kleine Mark“ (Ig. Zibermayr: Noricum, Bayern und Österreich), war ja nicht nur dem territorialen Umfange nach gering, sondern seit den verheerenden Ungarneinfällen, die auch nach 955 bis 1043 nicht aufhörten, eine ständige Bedrohung zu sein, auch schwach besiedelt. Die Neukolonisation dieser Gebiete wurde von verschiedenen kirchlichen Stellen mit methodischer Energie vorgetragen. Die Bischöfe der bayrischen Hochstifte ließen es sich sehr angelegen sein, ihre früheren Besitzungen wieder instand zu setzen und Neuland zu gewinnen. Bayrische Klöster, wie Tegernsee und Nieder-Altaich, gesellten sich dazu.
Mit der bloßen Existenzbestätigung weiß aber die kunstgeschichtliche Forschung so gut wie nichts anzufangen. Für die frühest :n Kirchenbauten, vielleicht einige Klosterkirchen ausgenommen, wird die vielumstrittene Bemerkung in der Lebensgeschichte des großen Bischofs Altmann von Passau (1065 bis 1091), er habe nur Kirchtn aus Holz vorgefunden, doch im wesentlichen volle Geltung haben.
Um so weniger dürfen wir baugeschichtlich verwertbare Nachrichten von Burgen und anderen Profanbauten erwarten. Ub&r die bauliche Gestaltung des Markgrafensitzes Melk, später in Tulln, nachzuforschen, bietet bei der Aussichtslosigkeit des Unterfangens wenig Anreiz. Hinsichtlich der Pfalzanlage in Klosterneuburg sind die Ergebnisse neuester Untersuchungen noch abzuwarten. Unser genaueres Wissen setzt mit dem Bau der Kirche und des Klosters in der babenbergischen Residenz Klosterneuburg unter Leopold III. (1095 bis 1136) ein. 1114 begann der Bau, 1136 war er vollendet, Chorherren nach der Regel des hl. Augustin wurden 1136 berufen, „Hier spürt man den Einfluß des Metropoliten (von Salzburg) künstlerisch jedoch gewiß nicht mehr, denn man wird mit Recht darauf hinweisen dürfen, daß die Ordenskongregation den Gründungsbau drei Jahre vor dessen Vollendung künstlerisch kaum noch merklich zu beeinflussen vermochte.“ (R. Pühringer.) Der Brand von 1158 konnte das Bausystem nicht grundlegend ändern. Bei den engen Beziehungen des Markgrafen zum kaiserlichen Geschlecht der Salier ist es sehr verständlich, daß „salische und nicht gregorianische Ideen verarbeitet wurden. Die auffälligen lombardischen Zierformen, die auch in den rheinischen Domen heimisch geworden waren, beweisen nichts für eine direkte Übernahme aus dem Süden. Klosterneuburg ist eine Schöpfung, die trotz oder gerade wegen des lombardischen Kleides ihre rheinfränkische Abstammung nicht verleugnen kann.“ (R. Pühringer.)
Indessen begann auch Wien zur Stadt heranzuwachsen. Die Babenberger verlegten zunächst den wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Schwerpunkt ihrer Herrschaft dorthin, sie bauten eine Kurie — „Am Hof“ —, die erst später durch einen Residenzbau ersetzt wurde. Leopold IV. (1136 bis 1141) übergab durch einen Tauschvertrag (1137), in dem Wien zum erstenmal civitas (Stadt) genannt wird, die pfarrlichen Rechte an den Bischof Reginmar von Passau. Dies war die Voraussetzung für den Bau der ältesten Stephanskirche, die in ihrer für eine Pfarrkirche außergewöhnlichen Größe und auch in ihrer Anlage das Klosterneuburger Vorbild zu erreichen suchte. An der Weiterführung des Baues waren allerdings dann Werkleute der normannisch-schottischen Bauschule maßgeblich beschäftigt. Sie waren anläßlich der Berufung der iro-schottischen Mönche aus Regensburg durch Herzog Heinrich II. nach Wien gebracht worden, um das Schottenkloster und seine Abteikirche zu bauen. Der romanisch-frühgotische Bau der Stephanskirche war ihre reichste Schöpfung.
Ihre fast in lückenloser Folge erhaltenen Bauten bilden ein auf deutschem Kulturboden in' solch reichem Denkmälerbestande einzigartiges' Beispiel der Tätigkeit einer Bauschule des 13. Jahrhunderts (R. K. Donin), wobei ihr Tätigkeitsbereich nicht nur in Kirchen und Karnern der näheren Umgebung sowie in Steiermark und Kärnten, sondern weit über die Grenzen des babenbergischen Territoriums nachzuweisen ist. Es ist dies das erstemal, daß Wien seinen Anspruch auf kulturelle Vormachtstellung in
Mitteleuropa anmeldet. Denn die fortgeschrittenen Schöpfungen dieser Bauhütte hatten in ihr normannisches Erbgut bereits viele Elemente unweigerlich heimischer Baugesinnung aufgenommen, zum Beispiel die oblongen Traveen, die in der Zisterzienserkirche zu Lilienfeld schon um 1230 erstmals verwendet worden waren. Mit diesen Bauformen kommt auch nach Wien (St. Stephan, Michaeierkirche) der erste Anhauch einer neuen Kunstrichtung, die als burgundische Gotik in Österreich hochwertige Verwendung fand. Wieder aus anderen geistigen Quellen gespeist sind die Kirchenbauten der Ritterorden und Bettelorden, der Minoriten und Dominikaner, die unter den späteren Babenbergern nach Wien verpflanzt wurden.
Im Zuge und in Nachwirkung der mächtigen Reformbewegung, die, von Cluny ausgehend, auf Hirsau übersprang, schäumte die kirchlidie Baulust auch auf Gebiete über, die von den Ideen des Schwarzwaldklosters nicht unmittelbar berührt waren. Eine Flut von Klostergründungen überströmt denn auch die österreichischen Länder. Regulierte Chorherren, Benediktiner, Zisterzienser bevölkern die Wälder und Täler. Die demokratischen Bettelorden, die ihnen bald folgen, erriditen fast in jeder größeren Ortschaft eine Niederlassung. Eine Aufzählung auch nur der bedeutendsten Stiftungen des 11. und 12. Jahrhunderts würde eine überraschend lange Reihe ergeben und zugleich tiefen Einblick in die ständig wechselnde Lagerung der kirchenpolitischen Kräfte gestatten. Politische und Kunstgeschichte entsprechen eich in seltener Deutlichkeit. Besonders lehrreiche Beispiele bieten Kärnten und Steiermark. Daß sich infolge solcher Verschiebungen in einzelnen Bauten hirsauische mit rheinischen, aber auch einheimischen Bauelementen zu einer übergeordneten Einheit verbinden, kann bei Kenntnis der Sachlage nicht weiter überraschen. Das willfährige Aufnehmen verschiedenster Anregungen und ihr verständiges, selbständiges Einschmelzen in die heimische Art ist überhaupt ein Zug des österreichischen Wesens, der von Jahrhundert zu Jahrhundert immer neue, zauberhaft schöne Blüten österreichischer Eigenart hervorbringt. Schon die Bauanlage von Klosterneuburg und die durchgehende Westempore in St. Stephan, der steingewordene Traum der Herzoge von einem Bischofsitze in Wien, bezeugen eine sdiarfe Gegensätzlidikeit zu hirsauischen Gepflogenheiten; dem entspricht auch die verhältnismäßig frühe Einführung des Zisterzienserordens im Kerngebiete der babenbergischen Ostmark.
Schon Leopolds III. geistvoller Sohn Otto, der spätere Bischof von Freising und hodi-verdiente Geschichtschreiber, hatte in Mori-mond das Mönchsideal dieses eben gegründeten Ordens der „grauen Brüder“ kennen gelernt und auf seine Veranlassung ließen sich zwölf Mönche aus Morimond am Sattelbach nieder. Von der Kreuzpartikel, die die neuen Zisterze als Geschenk Leopolds III. erhielten, bekam dieses Kloster den Namen Heiligenkreuz. Eine Reihe von Toditergründungcn bezeugen die frische Lebenskraft dieser Gründung, davon lag aber nur Zwettl (1138) im eigentlich babenbergischen Bereich. Noch unter Leopold VI., der wie sein Ahne Leopold III. e nes ausgeprägten frommen Sinnes war und den ein päpstliches Schreiben an seinen Nachfolger Friedrich II. als „dominus et vere pater totius cleri“ bezeichnet, erhielten 1202 die Möndic von Heiligenkreuz den Auftrag, Lilienfeld als Tochterkloster zu gründen. Um diese Zeit ungefähr bekam Wien auch sein erstes Frauenkloster, das der Zisterzen-serinnen St. Niklas vor dem Stubentor. Die Zukunft gehörte allerdings den Bettelorden. Die Dominikaner hielten ihren Einzug im damaligen Österreich, indem sie in Leoben, Wiener Neustadt, Wien, Krems ihre älteren Niederlassungen gründeten: die Minoriten maditen sich in Wien und in vielen Orten seiner näheren Umgebung seßhaft. Sie bauten ihre Kirchen nicht mehr selbst wie die älteren Orden, sondern nahmen unter der Aufsicht eines kundigen Bruders weltliche Bauleute in ihren Dienst. Ihr strenges Armutsideal übertrugen sie auch auf die Durchführung künstlerischer Aufgaben; höchste Einfachheit ist Gebot, das freilich nicht immer genau eingehalten wurde. Aber gerade die einfachen, wenig gegliederten Wamdflächen, die der Gesamterscheinung blockartigen Charakter geben, bringen in diese Anlagen einen Zug monumentaler Größe, der besonders dann das ganze Stadtbild bestimmen konnte, wenn sie an einer erhöhten Stelle im Zuge des Mauerringes lagen. Sie waren in ihrer Art neben den anspruchsvolleren Zisterziensern Schrittmacher einer Gotik, die in weitesten Schichten der Bevölkerung Anklang fand und sich auch in der Gestaltung von einfachen Pfarrkirchen als Vorbild verwenden ließ. Die Innenräume müssen vor allem den Anforderungen der Predigt entsprechen und vermeiden demnach komplizierte Grundrisse uhd Nebenkapellen. Gerade das süddeutsch-österreichische Wesen, das mehr Verständnis hat für ruhige Innenräume als für gewagte Konstruktionen wie überhaupt für alles, was mehr empfunden als gedacht werden kann, fühlte sich solcher Bauweise trotz ihres fremdländischen Ursprungs bald seelisch verwandt.
Überaus groß ist die Zahl der Pfarr- und Landkirchen, die in der Babenbergerzeit in Österreich entstanden, was bei der intensiven Kolonisationstätigkeit nur zu begreiflich ist. Denn auch kleinste Siedlungen ohne Gotteshäuser waren damals undenkbar. Wieviel solche Neugründungen allein Bischöfe wie Pilgrim und Altmann von Passau veranlaßt haben mögen, entzieht sich unserer Kenntnis, aber ihre Zahl würde überraschen.
Ist schon unser Wissen um die kirchliche Bautätigkeit in vieler Hinsicht sehr lückenhaft, um so weniger können wir Aufschluß über die profanen Bauten, auch der späten Babenbergerzeit erwarten. Über das Innere der herzoglichen Burg in Wien ist uns nicht die flüchtigste Notiz erhalten, gerade nur, daß wir ihre Lage im Stadtplan feststellen können. Die Burgen jener Zeit, soweit überhaupt noch etwas von ihrem ursprünglichen Bestände vorhanden ist, sind durch Umbauten gänzlich verändert. Die Stadthäuser waren fast ausnahmslos Holzbauten und sind auch den oft wiederkehrenden katastrophalen Bränden der Folgezeit zum Opfer gefallen oder wurden nach und nach durch gotische Bauten ersetzt. Schon die barocke Zeit hatte kaum mehr die Möglichkeit, ihre gewaltsame Umbaulust an romanischen Beständen auszutoben.
Das Kunstgewerbe stand am Hofe der Babenberger in hoher Blüte. Die byzantinischen Gemahlinnen der letzten Herzoge haben sicherlich wertvollste Erzeugnisse byzantinischer Goldschmiede- und Textilkunst mitgebracht. Von Kreuzzügen rückkehrende Ritter brachten von ihrer Fahrt ins Heilige Land manch kostbares Beutestück, erlesene Erzeugnisse orientalischen Gewerbefleißes nach
Hause, Händler aus Regensburg und wohl gar solche aus Köln und Flandern begegneten sich am Wiener Umschlagplatz mit Kaufleuten aus Venedig, wohin sich die Herzoge nach Erwerbung der Steiermark die wichtigsten Straßenzüge gesichert hatten. Das Leben in der Residenz der mächtigen Fürsten, die nach dem Böhmenkönig auch die reichsten ihres Standes waren, war besonders zur Zeit großer Empfänge und Festlichkeiten Ausdruck eines hohen Lebensstandards von sehr gepflegter Kultur. Auch in den Schatzkammern der Kirchen und Klöster, in den Kemenaten der adeligen Sitze gab es manches prächtige Stück künstlerischen Hausrates, der übrigens auch in den Häusern reicher Bürger nicht fehlen durfte. Die Miniatoren und Wandmaler wetteiferten in der Ausschmückung von Kodizes und Kircheninterieurs, Refektorien und' Kapitelsälen. Wie ausgiebig bemalt Kirchen sein konnten, beweisen neuestens die diesbezüglichen Aufdeckungen in der Stephanskirche.
Alles dies spricht dagegen, die Ostmark als kulturell völlig abhängiges, im Vergleich mit dem Westen zurückgebliebenes Kolonialland zu betrachten. Eine allzu bescheidene Einstellung der älteren österreichischen Forscher hat in der Kunstgeschichte des Landes manche verhängnisvolle Zuspät-datierung verschuldet. Die bitteren Klagen der Chronisten üb,er das Schwinden einer gjanzvollen „guten alten“ Zeit, das mit dem jähen Erlöschen des hochgemuten Fürstengeschlechtes zusammenfällt, mögen zunächst von politischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten her veranlaßt sein, sie sind aber audi ohne weiteres auf den kulturell-künstlerischen Bereich zu übertragen.