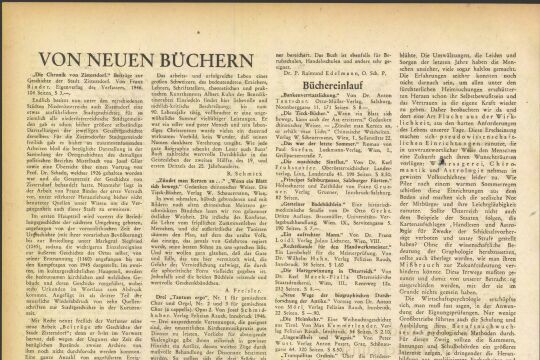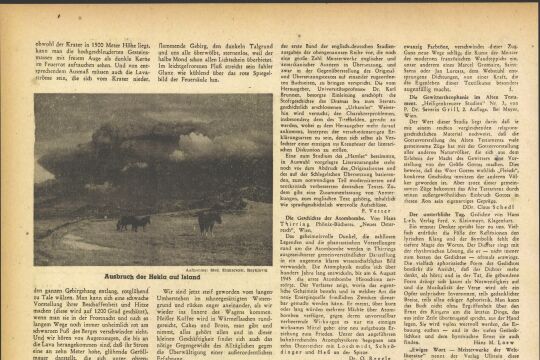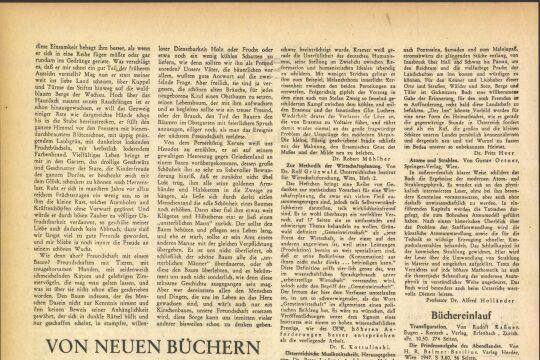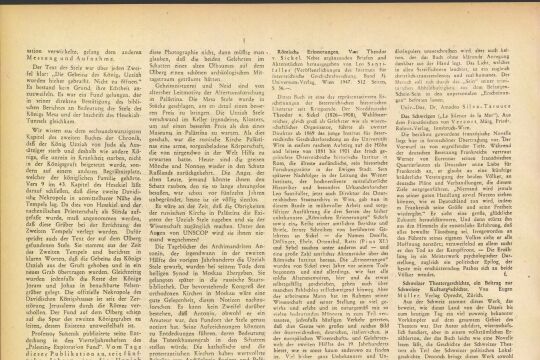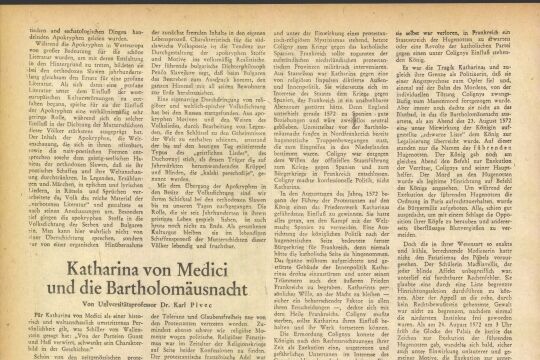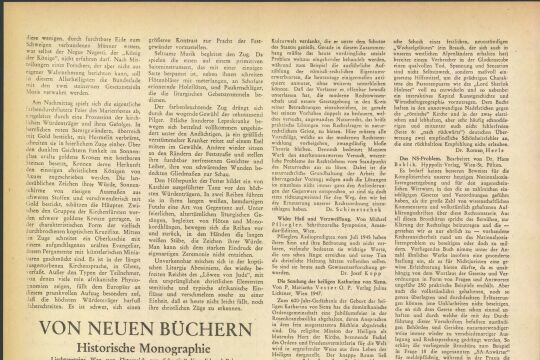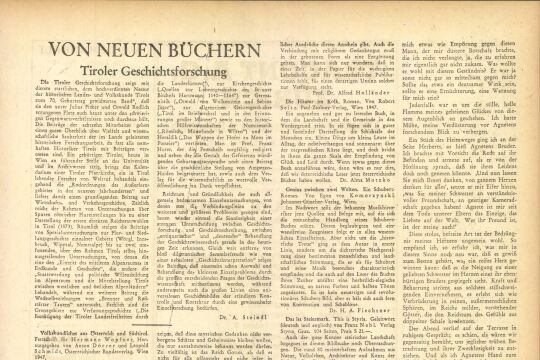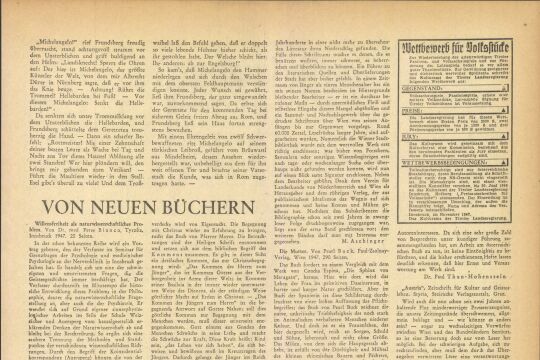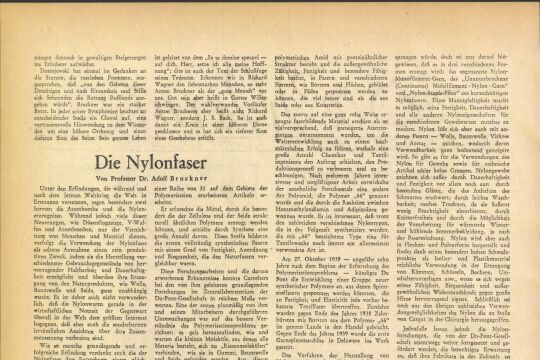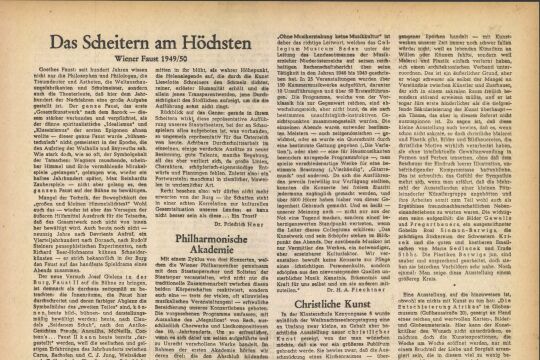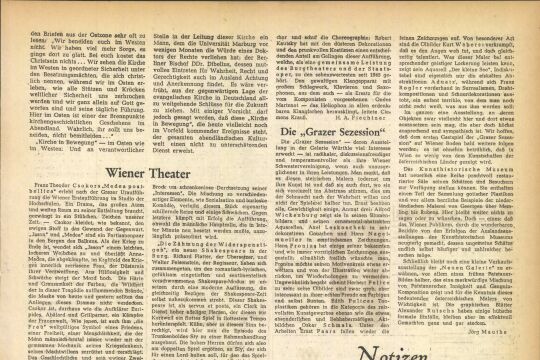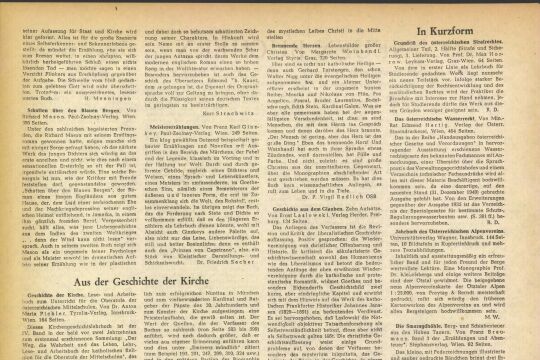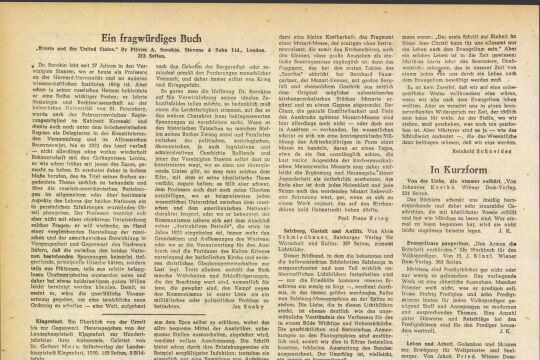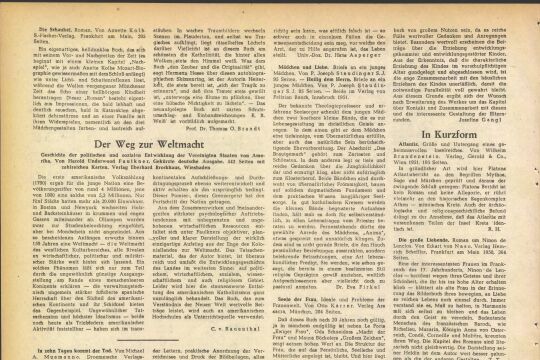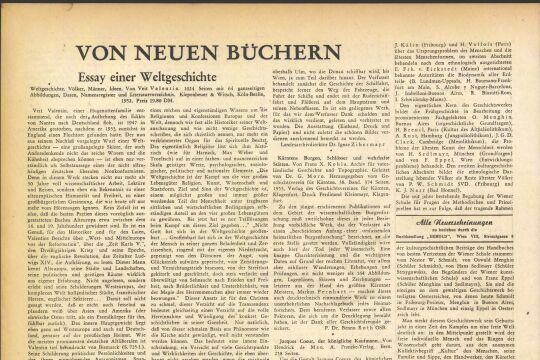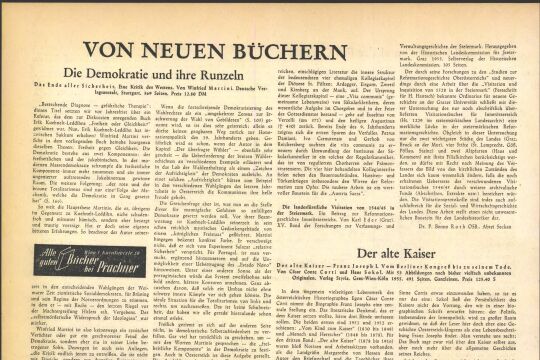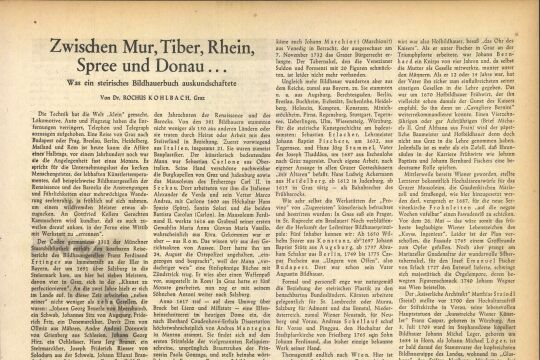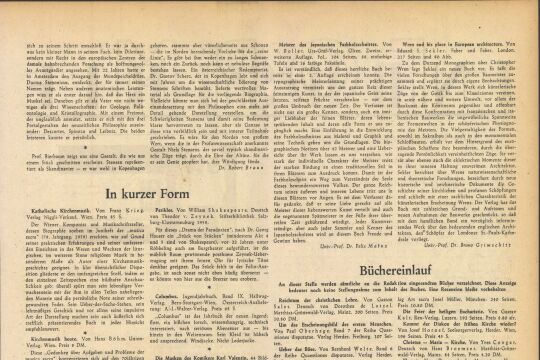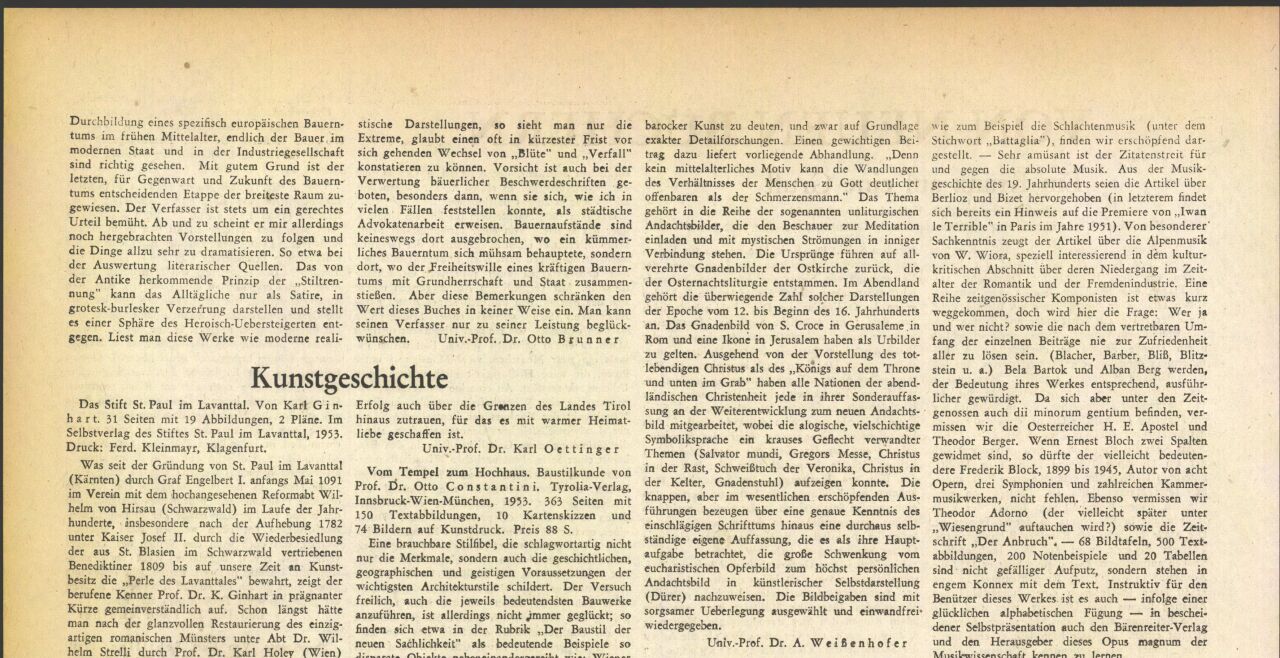
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kunstgeschichte
Uas Stirt st. faul im Lavanttal. Von Karl Cj 1 n-hart. 31 Seiten mit 19 Abbildungen, 2 Pläne. Im Selbstverlag des Stiftes St. Paul im Lavanttal, 1953. Druck: Ferd. Kleinmayr, Klagenfurt.
Was seit der Gründung von St. Paul im Lavanttal (Kärnten) durch Graf Engelbert I. anfangs Mai 1091 im Verein mit dem hochangesehenen Reformabt Wilhelm von Hirsau (Schwarzwald) im Laufe der Jahrhunderte, insbesondere nach der Aufhebung 1782 unter Kaiser Josef II. durch die Wiederbesiedlung der aus St. Blasien im Schwarzwald vertriebenen Benediktiner 1809 bis auf unsere Zeit an Kunstbesitz die „Perle des Lavanttales“ bewahrt, zeigt der berufene Kenner Prof. Dr. K. Ginhart in prägnanter Kürze gemeinverständlich auf. Schon längst hätte man nach der glanzvollen Restaurierung des einzigartigen romanischen Münsters unter Abt Dr. Wilhelm Strelli durch Prof. Dr. Karl Holey (Wien) 1935/36 einen Kunstführer gewünscht, wenn nicht die zweite Aufhebungszeit 1940 bis 1945 es verhinderte. In eingehender, kunstgeschichtlicher Betrachtung würdigt der Verfasser den eigenartigen Zauber der erfreulichen harmonischen Gesamtheit an romanischer, gotischer, barocker und moderner Kunst, der weder vom museal wirkenden G u r k noch vom sakralen S e c k a u überboten wird. Die schön gelungenen Abbildungen ermöglichen dem Kunstfreund und Besucher, in die wertvollen Schätze der überreichen Kunstsammlungen mit ihren seltenen Stücken einzudringen. Ein Gesamtplan sowie ein Orientierungsplan erleichtert dem Besucher die lohnende kunstgeschichtliche Betrachtung. Die Sammlung urgeschichtlicher Gegenstände, die der große Restaurator Abt Dr. Strelli mit größtem Interesse angelegt hat, ist leider ein Opfer der Aufhebung geworden. Daß heute St. Paul wieder den alten traditionellen Geist verständnisvoller Pflege benediktinischer Kultur zeigt, ist außer dem Abt Paulus Schneider insbesondere der LTmsicht des P. Hofmeisters Prof. Hartwig Labi zu danken. Dem Verfasser gebührt ebenso inniger Dank wie dem Verlag für die geschmackvolle und billige Ausstattung des willkommenen Kunstführers.
Kunstgeschichte der Stadt Innsbruck. Von Heinrich Hammer. Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien-München, 1952. 416 Seiten-mit 350 Abbildungen.
Der Autor, einst Ordinarius der Innsbrucker Universität, mag dieses Buch mit Recht als die Krönung seines Lebenswerkes betrachten. In einer von ihm und dem führenden Innsbrucker Verlag gewohnten Monumentalität des Inhalts wie der Buchgestalt gibt dieser prächtig illustrierte Band vollständige Uebersicht über das kunstgeschichtliche Geschehen auf dem Boden der Tiroler Haupt-«tadt. Aus dem von Vorzeit und römischer Antike bis zu den jüngsten Schöpfungen der Gegenwart reichenden Material treten einige Epochen und Werke besonders hervor als längst erkannte, zum Teil von dem Autor selbst seit langem erforschte Höhepunkte: die gotische Stadtarchitektur mit ihren Spitzenwerken, der nur. noch aus Dürers berühmten Schloßhofzeichnungen rekonstruierbaren Burg und dem Goldenen Dachl, das Grabmal Maximilians I. mit seinen weltberühmten Statuenreihen, Schloß Ambras und “der Künstlerkreis um Ferdinand von Tirol, die Barockbauten des Architektengeschlechtes der Gumpp, die dem Innsbrucker Palaststil ihr Gepräge verliehen haben und denen nur die Stadtpfarrkirche der Füssener Meister Herkomer und J. G. Fischer ebenbürtig zur Seite tritt, die Residenz mit den Festsaalfresken von Maulbertsch, das Bürgerrokoko der im 18. Jahrhundert teilweise erneuerten Fassaden, von denen das Helbling-Haus den Gipfel bedeutet. Auch die bedeutsamen Freskenfunde der letzten Jahre in Stift Wilten, welche die Tätigkeit der Pacher-Werkstatt beweisen und das tnun wiedererstandene Grabdenkmal des Erzherzogs Maximilian, des „Deutschmeisters“ in der Stadtpfarrkirche bieten Neues. Die Tiroler Maler des 19. Jahrhunderts: Koch, Defregger, Egger-Lienz, die zwar nur vorübergehend in Innsbruck geweilt, aber auf die Künstler der Stadt anregend gewirkt haben, werden einbezogen. Daß sie in Rom, München und Wien geschaffen haben, spiegelt übrigens eine vom Autor betonte Erscheinung wider, welche für alle unsere Provinzhauptstädte gilt: das Absinken ihrer künstlerischen Kraft im 19. Jahrhundert zugunsten der Weltstädte. Ist doch auch das Aufblühen Innsbrucks im 15. Jahrhundert mit der Residenz einer Habsburgerlinie verbunden, die bis weit in das 17. Jahrhundert hinein bestanden hat,wie ja auch noch die Schloßresidenz und der Triumphbogen, die beiden markantesten Denkmäler des 18. Jahrhunderts, Maria Theresia zu danken sind. So gehört das Beste der Stadt zu den Glanzschöpfungen unserer gemeinsamen österreichischen Geschichte, und deshalb darf man dem Buch einen
Erfolg auch über die Grtozen des Landes Tirol hinaus zutrauen, für das es mit warmer Heimatliebe geschaffen ist.
Univ.-Prof. Dr. Karl Oettinger
Vom Tempel zum Hochhaus. Baustilkunde von Prof. Dr. Otto Constantini. Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien-München, 1953. 363 Seiten mit 150 Textabbildungen, 10 Kartenskizzen und 74 Bildern auf Kunstdruck. Preis 88 S.
Eine brauchbare Stilfibel, die schlagwortartig nicht nur die Merkmale, sondern auch die geschichtlichen, geographischen und geistigen Voraussetzungen der wichtigsten Architekturstile schildert. Der Versuch freilich, auch die jeweils bedeutendsten Bauwerke anzuführen, ist allerdings nicht .immer geglückt; so finden sich etwa in der Rubrik „Der Baustil der neuen Sachlichkeit“ als bedeutende Beispiele so disparate Objekte nebeneinandergereiht wie: Wiener Loos-Haus, Wiener Forumkino (!), Linzer Hauptbahnhof, das Münchner „Haus der Deutschen Kunst“, das Corbusier-Haus in Marseille, Empire State Building und Sowjetpalast (!) in Moskau. Auch Vermißt man den Namen F. L. Wrights, ohne den eine zeitgenössische Baustilkunde unvollständig bleiben muß. Trotz dieser Einschränkung bleibt das Buch für den Laien und den Liebhaber wertvoll. Annehmbarerer Schutzumschlag (Oswald Haller).
Dr. Jörg M a u t h e
Der Schmerzensmann. Von Wiltrud Mersmann. Verlag L. Schwann, Düsseldorf, 1952.
Die Behandlung ikonographischer Themen ist gegenwärtig auch für den Kunsthistoriker wieder sehr zeitgemäß. Die Methoden der Kunstgeschichtsschreibung sind ja erfahrungsgemäß weithin abhängig von den gleichzeitigen Entwicklungsphasen der bildenden Kunst. Als auf die Tyrannei des Auges in radikaler Schwenkung die expressionistische Herausstellung des Geistigen und die dadurch bedingte Vernachlässigung, ja Zertrümmerung der sinnfälligen Form folgte, wurde auch ein erneutes Interesse für die Inhalte des Dargestellten wach. Es mehrten sich die Versuche, die uns schwer verständlichen Ideenverbindungen mittelalterlicher und barocker Kunst zu deuten, und zwar auf Grundlage exakter Detailforschungen. Einen gewichtigen Beitrag dazu liefert vorliegende Abhandlung. „Denn kein mittelalterliches Motiv kann die Wandlungen des Verhältnisses der Menschen zu Gott deutlicher offenbaren als der Schmerzensmann.“ Das Thema gehört in die Reihe der sogenannten unliturgischen Andachtsbilder, die den Beschauer zur Meditation einladen und mit mystischen Strömungen in inniger Verbindung stehen. Die Ursprünge führen auf allverehrte Gnadenbilder der Ostkirche zurück, die der Osternachtsliturgie entstammen. Im Abendland gehört die überwiegende Zahl solcher Darstellungen der Epoche vom 12. bis Beginn des 16. Jahrhunderts an. Das Gnadenbild von S. Croce in Gerusaleme in Rom und eine Ikone in Jerusalem haben als Urbilder zu gelten. Ausgehend von der Vorstellung des totlebendigen Christus als des „Königs auf dem Throne und unten im Grab“ haben alle Nationen der abendländischen Christenheit jede in ihrer Sonderauffassung an der Weiterentwicklung zum neuen Andachtsbild mitgearbeitet, wobei die alogische, vielschichtige Symboliksprache ein krauses Geflecht verwandter Themen (Salvator mundi, Gregors Messe, Christus in der Rast, Schweißtuch der Veronika, Christus in der Kelter, Gnadenstuhl) aufzeigen konnte. Die knappen, aber im wesentlichen erschöpfenden Ausführungen bezeugen über eine genaue Kenntnis des einschlägigen Schrifttums hinaus eine durchaus selbständige eigene Auffassung, die es als ihre Hauptaufgabe betrachtet, die große Schwenkung vom eucharistischen Opferbild zum höchst persönlichen Andachtsbild in künstlerischer Selbstdarstellung (Dürer) nachzuweisen. Die Bildbeigaben sind mit sorgsamer Ueberlegung ausgewählt und einwandfrei-wiedergegeben.
Univ.-Prof. Dr. A. W t i ß e n h o f e r
Die Kunst unter Dompropst Gregor Schärdinger (1510 bis 1531). Von Dr. P. Benno Roth. Seckauer geschichtliche Studien. Heft 11. 82 Seiten.
Der äußerst verdienstvolle Historiograph des Klosters Seckau, P. Roth, legt mit dem vorliegenden Heft wieder eine sehr gelungene Studie über einen kunsthistorisch wichtigen Abschnitt des ehemaligen Augustinerchorherrenstiftes Seckau vor, über die Epoche des Propstes Schärdinger, der auf den kunstsinnigen Propst Dürnberger folgte. Propst Schärdinger steht an der Grenze zwischen Gotik und Renaissance: während er in der Seckauer Kirche bereits der neuen Richtung Eingang verschaffte, baute er in den Filialkirchen des Stiftes noch gotisch. Besonders gelungen sind dem Verfasser die Schilderungen über das ehemalige Stiftergrab und die Renaissanceorgel sowie der Abschnitt über den Altar der zweischiffigen Kirche St. Mareln, ferner der Nachweis über die Zusammenhänge zwischen Seckauer und Brixener Kunst. Hoffentlich werden diese Studien, die, wie alle vorhergehenden, mit Heranziehung aller Quellen gearbeitet wurden, fortgesetzt und einmal zu einem Gesamtwerk über Kunst und Geschichte des Klosters Seckau verwertet.
DDr. Willy Loren
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!