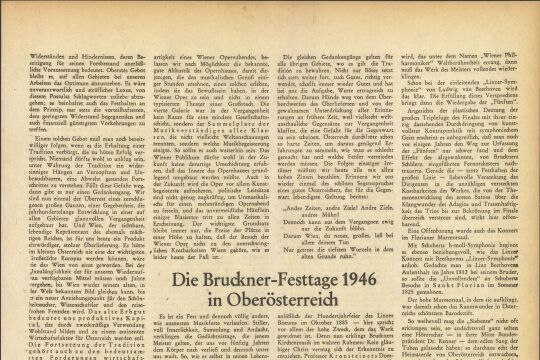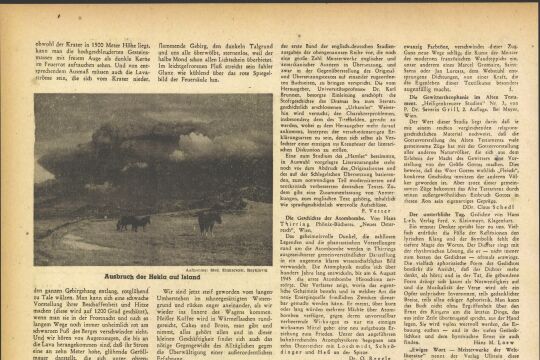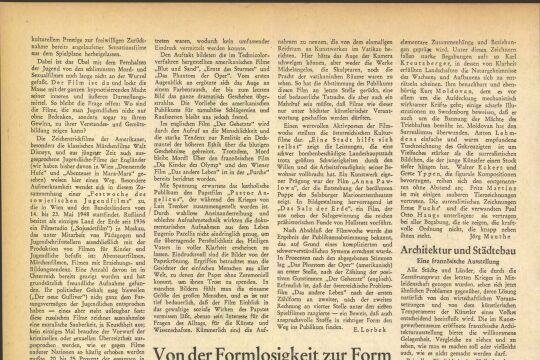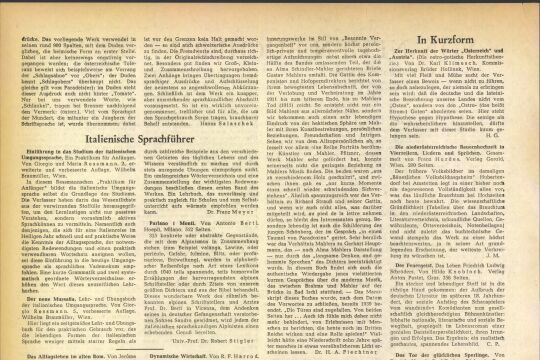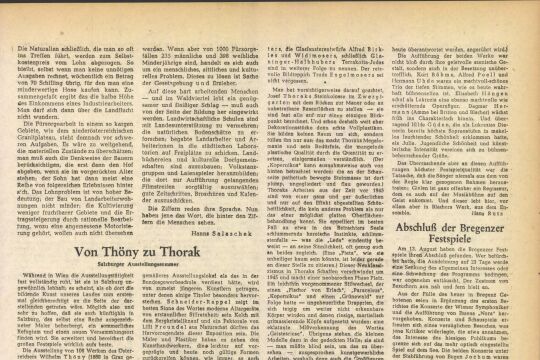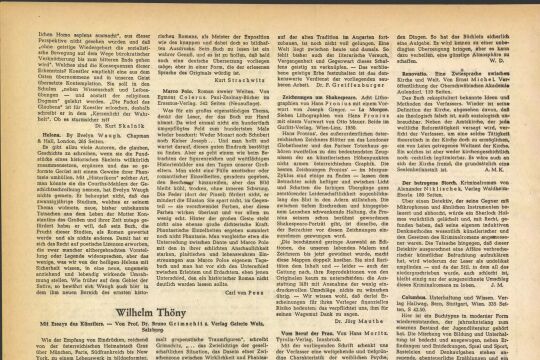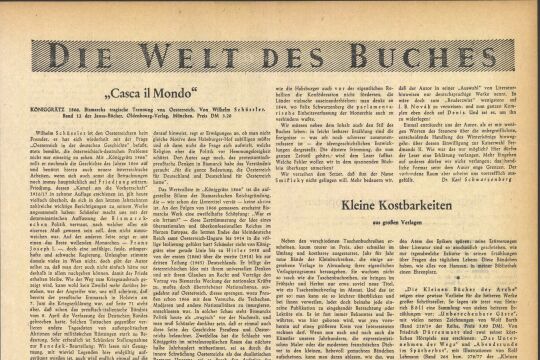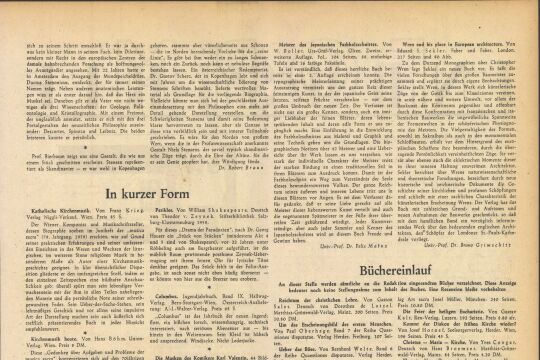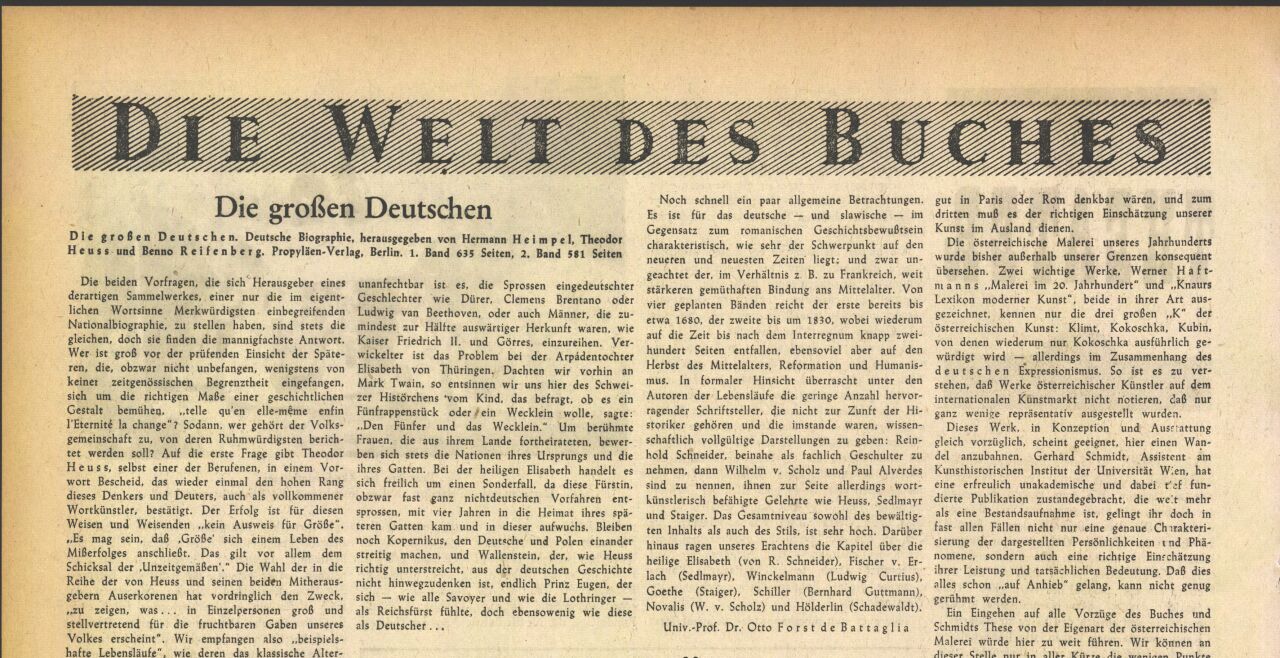
Neue Malerei in Oesterreich. Von Gerhard
Schmidt. Verlag Brüder Rosenbaum, Wien. 180 Seiten. Mit 3 Textabbildungen, 28 Färb- und 68 Schwarzweißtafeln. Preis 18 5 S,
Dieses Werk hat keine Vorläufer. Die ersten Deutungen der neuen Malerei in Oesterreich, die versucht wurden, erschienen noch mitten in der „heroischen Phase“ der modernen Kunst und tragen das Merkmal der Streitschrift und einer ersten Umschau inmitten einer noch in voller Entfaltung be- giiffenen Bewegung: das Buch „Neue Malerei in Oesterreich“ von Anton Faistauer, dessen Titel Gerhard Schmidt nun übernahm, und „Oester- reichische Kunst“ (Band III in der Reihe „Gegenwartskunst“) von Fritz Karpfen, beide im Jahre 1923 in Wien erschienen. Neben der richtigen Einschätzung der Bedeutung Egon Schieies steht bei
Karpfen z. B. die krasse Ueberschätzung Ambrosis, der gar mit Michelangelo verglichen wird, während eine Malerpersönlichkeit wie Richard Gerstl überhaupt vergessen wurde. Der Schwerpunkt der „Kleinen Geschichte der Kunst in Oesterreich" von Otto Benesch (Wien 1950) liegt nicht in der Deutung moderner Tendenzen.
So hat das Werk Gerhard Schmidts — dem, hoffentlich bald, ein zweites über „Neue Plastik in Oesterreich“ ergänzend zur Seite treten soll — Pionierdienste zu leisten. In mehrfacher Hinsicht: zum einen hat es eine gültige Bestandsaufnahme der bei uns heute vertretenen Bestrebungen und unter uns arbeitenden Künstler zu geben, zum zweiten hat es die Frage zu behandeln, ob es so etwas wie eine moderne Malerei österreichischer Prägung gibt oder ob unsere bedeutendsten Künstler genau so gut in Paris oder Rom denkbar wären, und zum dritten muß es der richtigen Einschätzung unserer Kunst im Ausland dienen.
Die österreichische Malerei unseres Jahrhunderts wurde bisher außerhalb unserer Grenzen konsequent übersehen. Zwei wichtige Werke, Werner Haftmanns „Malerei im 20. Jahrhundert" und „Knaurs Lexikon moderner Kunst“, beide in ihrer Art ausgezeichnet, kennen nur die drei großen „K“ der österreichischen Kunst: Klimt, Kokoschka, Kubin, von denen wiederum nur Kokoschka ausführlich gewürdigt wird — allerdings im Zusammenhang des deutschen Expressionismus. So ist es zu verstehen, daß Werke österreichischer Künstler auf dem internationalen Kunstmarkt nicht notieren, daß nur ganz wenige repräsentativ ausgestellt wurden.
Dieses Werk, in Konzeption und Ausstattung gleich vorzüglich, scheint geeignet, hier einen Wandel anzubahnen. Gerhard Schmidt, Assistent am Kunsthistorischen Institut der Universität Wien, hat eine erfreulich unakademische und dabei t'ef fundierte Publikation zustandegebracht, die weit mehr als eine Bestandsaufnahme ist, gelingt ihr doch in fast allen Fällen nicht nur eine genaue Chirakteri- sierung der dargestellten Persönlichkeiten t nd Phänomene, sondern auch eine richtige Einschätzung ihrer Leistung und tatsächlichen Bedeutung. Daß dies alles schon „auf Anhieb" gelang, kann nicht genug gerühmt werden.
Ein Eingehen auf alle Vorzüge des Buches und Schmidts These von der Eigenart der österreichischen Malerei würde hier zu weit führen. Wir können an dieser Stelle nur in aller Kürze die wenigen Punkte notieren, in denen wir anderer Meinung sind.
Von den im Werk genannten 99 österreichischen Künstlern unseres Jahrhunderts sind 66 mit mindestens einer Abbildung und einer Kurzbiographie (neben der Darstellung im allgemeinen Text) vertreten. Von diesen 66 erscheinen uns nur vier als zu Unrecht aufgenommen: Rudolf Hermann Eisenmenger, dessen Aera wohl mit den Stiefeln der SS-Legionen endgültig untergegangen ist, Oskar L a s k e, der als Illustrator akzeptiert werden mag, aber nicht als Maler (was er malt, versieht er mit einem Zuckerüberguß), Paul Meissner, der zwar als Präsident der Secession allseits geschätzt wird, in seinen Bildern aber nur anempfundene Moderne gibt, und Herbert T a s q u i 1, dessen Zeichnungen blasse Theorie bleiben.
Demgegenüber erscheinen die zwar vertretenen Abstrakten Johann Früh mann und vor allem Josef Mi kl unterschätzt: Fruhmann fand eine österreichisch verträumte und dennoch exakte Art der Abstraktion, Mikl gehört heute zu den wenigen Künstlern, von denen eine Weiterführung der Malerei erwartet werden darf. Dasselbe wie für Mikl gilt für die Kärntnerin Maria Lassn.ig. Auch Werner.Berg und Georg Merkel — denen es um anderes geht — sind in ihrer vollen Bedeutung nicht erkannt. Vollends übersehen (und gar nicht genannt) sind Rudolf H r a d i 1, Rudolf K o 1 b i t s c h und Alfons Ortner, die als Graphiker einiges geleistet haben und von denen man auch noch einiges erwarten darf.
Aber das sind nur einige kritische Anmerkungen, die, weil so geringfügig, die Gültigkeit des Buches nur unterstreichen können. Ganz einverstanden sind wir mit der Deutung der „Situation von heute", während uns allerdings der Altersstil Kokoschkas nicht als Weg in die Zukunft erscheint, so sehr er „typisch österreichisch" sein mag: denn hier wird der Mythos des Menschen intellektuell abgehandelt und nicht in seinem Wesen als Figur erfaßt!
Die Bildwiedergabe ist zum Großteil einwandfrei, die Herstellung der Klischees leider in einzelnen Fällen schlampig. So wissen wir von dem von Mikl reproduzierten Bild, daß es auf beiden Seiten um fünf Zentimeter beschnitten wurde. Aber das bleiben, wie gesagt, Einzelheiten, die den ausgezeichneten Gesamleindruck nicht zu trüben vermögen.
Anton Romako. Von Fritz Novotny. Verlag Brüder Rosenbaum, Wien. 16 Seiten Text und 24 Aquarelle. Reihe: Oesterreichische Aquarellisten. Band III. Preis 95 S.
Die erste Tafel in Gerhard Schmidts „Neue Malerei in Oestererich“ zeigt ein Porträt Anton Romakos (1832—1889). In der Tat ist er der bedeutendste Vorläufer der neuen Kunst in Oesterreich. Fritz Novotny, von dem 1954 das Standardwerk „Der Maler Anton Romako“ (mit Oeuvre- katalog! erschienen ist, hat nun aus dem knappen halben Hundert erhaltener Aquarelle Romakos die schönsten ausgewählt und mit einem einführenden Text versehen, der ein Musterbeispiel an Einfühlungsgabe in die einzelnen Blätter und die verschiedenen Phasen und Kräfte in Romakos Malerei darstellt. Frei von allem hintergründig tuenden Geschwätz, wie es in der Kunstbetrachtung an Stelle fachlichen Vermögens nur allzu üblich ist, weiß er aus den Einzelheiten ein in allem richtiges Bild der eigenartigen Dissonanzen und Diskrepanzen in Romakos Kunst herauszulesen.
Die Aquarelle Romakos geben zwar keine genaue Vorstellung von der Vielfalt des Werkes Romakos, wenn sie auch seine Entwicklung in ihren Grundzügen ąnzeigen. Einige von ihnen aber, die „Italienische Landschaft mit Bauernhaus“, „Fischerknabe und Fischermädchen an der Felsküste von Capri“ mit ihrem Gegensatz von impressionistisch empfundener Landschaft und „süßem Fleisch", das „Schloß Sassetot“ mit der schnörkeligen Unruhe in den Baumkronen und das hingetupfte „Singende Mädchen" sind echteste: Romako.
Gustav Khm Von Emil P i r c h a n. Mit einem
V'otwort von A. G i ü n b e r g. Bergiand Verlag,
Wien. 56 Seiten Text, 12 Farbtafeln und 155 einfarbige Bildbeigalen. Ireis 198 S.
Wichtiger als der Hauptteil des Buches, in dem Emil Pirchan erzählend und deskriptiv Detailmaterial ausbreitet, ist das Vorwort (richtiger wohl: die Einleitung) von A. G r ü n b e r g, der sich sorgfältig bemüht, die geistigen Umrisse der Gestalt Klimts (1862—1918) zu erfassen. Sehr richtig leitet Grünberg die Malerei Klimts aus dem Zeitgeist der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts her' und verweist auf die Forschung, die die Reiche der Antike und des Orients erschloß. Damals fand Heinrich Schliemann in den Schachtgräbern Mykenes die Goldmasken „Agamemnons" und seiner Leute und entdeckte in Troja den „Schatz des Priamos“ (nicht, wie Grünberg schreibt, den „Schatz der Helena“). Die Archäologie erschloß die Welt der „mykeni- schen Kultur“. Die Kunst des Fernen Ostens wurde wirksam, beeinflußte die Brüder Goncourt, Toulouse- Lautrec, van Gogh, Gauguin. Die Kunst des Islams wurde neu entdeckt, dem Ornament wieder Interesse zugewendet. Die Mosaiken von Byzanz und Ravenna, die Malerei der Ikonen formten die geistigen Vorstellungen Klimts.
Die Grenzen dieses Zeitgeistes sind auch die Grenzen, die dem Klimtschen Werke gesetzt sind. Das Interesse der Zeit an der Vergangenheit, an der Mythologie, am Exotisch-Fernen war nämlich zunächst ein historisch-romantisches, ein durchaus intellektuelles, und nicht aufs Wesentliche — auf das mythische Denken und Empfinden als solches —
dem Klappentext, der behauptet, daß „zum erstenmal in diesem neuen Werk . . . der große Moralist... ins Licht der Betrachtung gestellt" wird. Das ist eine Anmaßung. Schneditz weiß zwar spannend zu erzählen, sein Text steckt aber voller Stilblüten. Beispiele: ein Einzelgänger, den die Mode strömungen der Zeit nie berührt haben . . . weil er immer. .. auf dem perennierenden Strom der Zeitabläufe dahergeschwo'mmen ist.“ — „Der bis in diese Gebiete verwässert hinaufreichende Orient. .
— „Granatsplitter sausten ihm plötzlich um den Kopf, und einer. .. traf in ein philosophisches Werk, das der Künstler seinen Besuchern noch immer voll Entsetzen gerne vorweist.“ Voll Entsetzen oder gerne? „Zerzaust wie ihr Schlößchen ... aber innerlich heil treten die Kubins. . . neu ins helle Tageslicht.“ — „Die etwas längliche, schmale, in eine Spitze verlaufende Nase zeigt sich dort rötlich behaucht... Von oberhalb der Nasenflügel umgrenzen zwei schärfere Falten ausbiegend den Mund, der geschlossen genau so sprechend wirkt, wie wenn er seine sprudelnde Beredsamkeit-entfaltet. Lächelnd formen sich die Wangen zu den geröteten Bäckchen . .. Die etwas nach oben gezogenen Nasenflügel, scharf geprägt und die Spitze der Nase betonend, vibrieren im angeregten Gespräch."
So geht das nicht. Man hätte Kubin vor Schneditz schützen müssen. Peinlich wie diese Stellen wirken viele Einzelheiten, die der Autor mit sichtlichem Vergnügen präsentiert. Auch tut es der Sache nicht gut, daß ein offenbar mit der Materie nicht vertrauter Autor sie hemdärmelig abhandelt, als wäre gerichtet. Es verlor sich zu sehr an Einzelheiten und fand sein Genügen im Aufdecken seltsamer und anekdotenhafter Züge.
So gelang auch Klimt — der übrigens selber wie die Illustration einer Heroengestalt aus den „schönsten Sagen des klassischen Altertums“ aussah — nicht der Durchbruch zum Wesentlichen. Wie Theodor Däubler, dem er nicht nur im äußeren Habitus, sondern auch in der ornamentalen Geste des Werks verwandt ist, war er ein Sucher, aufgerufen und angezogen durch die heraufdämmernde Welt des Mythos, die ihm aber noch verschlossen blieb. Ihm ging es um einen neuen Stil — als einer neuen Lebensform — und er blieb doch der pausbäckigen Allegorie verhaftet. So glauben wir durchaus nicht, wie Grünberg meint, daß Gustav Klimts Zeit wieder kommen wird. Sie ist für immer vorbei, sie war innerlich zwiespältig, Altes und Neues mischte sich in ihr — wie in Klimts Werk — in eigener Weise. Es war eine Uebergangszeit. Anderen war es beschieden, den Weg weiter zu finden: den „Fauves“ zunächst, dann den Kubisten. Dagegen glauben wir, daß die Zeit eines der Schüler Klimts noch einmal kommen wird: die Egon Schieies.
Das alles ändert nichts an der Bedeutung Klimts. Jede neue Entwicklung ist dadurch gekennzeichnet, daß viele berufen sind, den Weg nach vorne zu suchen, von denen nur einer oder ganz wenige Zukunftweisendes finden.
Die Bildwiedergabe ist einwandfrei, doch sind manche Seiten zu sehr mit Bildern angeräumt. Weniger wäre da mehr gewesen. Auch vermißt man ein Literaturverzeichnis, das in einem Standardwerk, wie es dieses auf jeden Fall ist, nicht fehlen sollte. Ein Oeuvrekatalog nennt die feststellbaren Gemälde Klimts: viele von ihnen sind im zweiten Weltkrieg verbrannt.
Alfred Kubin. Von Wolfgang Schneditz. Verlag Brüder Rosenbaum, Wien. 108 Seiten. Mit 4 Textbildern, 5 Farbtafeln und 56 Schwarzweißtafeln.
Eine unglückliche Publikation, mit der dem Verständnis des Werkes Kubins nicht gedient ist. Schon der Ehrgeiz, nur bisher unbekannte Gemälde und Zeichnungen erstmalig zu veröffentlichen, ist von Nachteil: denn so entsteht ein sehr schiefes Bild der Kunst Kubins, dessen Entwicklung nur unzureichend dokumentiert wird. Mehr als die Hälfte der Abbildungen — etwa dreißig — stammen aus der Zeit um 1900, als der noch unfertige Kubin sich in größtenteils auch zeichnerisch nicht sehr bedeutsamen Gruselphantasien abreagierte. Er selbst verwarf diese Periode seiner Kunst später als „Scheinmetaphysik“. Es ist unverständlich, warum gerade sie so ausführlich hier vor uns ausgebreitet wird, während seine eigentliche Leistung nur angedeutet ist.
Auch der Text ist unzureichend Das beginnt mit er in ihr zu Hause. So auf Du und Du wat Schneditz mit keinem der Großen seiner Zeit, wie er gern£„.Q)t'.
Mit dem genannten Dichter Heymel ist wohl Georg Heym gemeint. Oder dachte Schneditz an Dehmel?
Oskar Kokoschka. Das Werk des Malers mit Oeuvreverzeichnis. Von Hans Maria WingTdr. Verlag Galerie Welz, Salzburg. 400 Seiten mit 600 Abbildungen. Preis 450 S.
Dieses Werk, das uns nicht zur Rezension vorlag, sei in diesem Zusammenhang der wesentlichsten österreichischen Künstlermonographien der letzten Zeit nur angezeigt. Es ist die bedeutendste bisher erschienene Publikation über Kokoschka (geb. 1886).
Anton Kolig. Von Richard M i 1 e s i. Verlag des Landesmuseums für Kärnten, Klagenfurt. 48 Seiten. Mit 52 Bildtafeln und einer Farbtafel. Buchreihe des Landesmuseums für Kärnten. Geleitet von Direktor Dr. Gotbert Moro. 1. Band.
Eine exakte Einführung in das Werk Koligs (1886—1950). Anton Kolig steht als ausgesprochen „plastischer“ Maler außerhalb der Entwicklung der neuen Kunst; es spricht für seine künstlerischen Qualitäten, wenn er trotzdem einen Ehrenplatz in der österreichischen Malerei unseres Jahrhunderts einnimmt. Er ging in seinen hauptsächlich männlichen Akten konsequent den Weg zu einer „Architektur des Menschen“, zu einer Verfestigung der Form, zu einem streng komponierten Bildgefüge. — Auf Tafel 51 soll es richtig Franz, nicht Alfred Wiegele heißen.
Wilhelm Thöny. Von Erwin N e u m a n n. Verlag Brüder Rosenbaum, Wien. 16 Seiten Text, 24 Aquarelle. Reihe „Oesterreichische Aquarellisten", herausgegeben von Fritz Novotny. Band IV. Preis 95 S.
Wilhelm Thöny (1888—1949) lebt in unserem Bewußtsein als Aquarellist, der seine Bilder „in den Himmel gemalt“ hat. Er war das nicht immer, ln seiner Münchener Studienzeit und in den Grazer Jahren bevorzugte er die Oelfarbe. Die Grazer Bilder sind melancholisch-düster gestimmt, ln Paris wird seine Kįmst heiterer und hellerer, seine Bilder, jetzt mehr und mehr in Wassermalerei, werden leichter und lockerer. Es ist, als habe Tau seinen Pinsel befeuchtet und nicht gewöhnliches Wasser.
Thöny war, wie Erwin Neumann sehr richtig bemerkt, nach seiner ganzen Konstitution ein Großstadtmensch. Seine Landschaften liegen fast immer in der Weltstadt. Sein Pinsel verwandelt sie in duftige Welten und macht Wolkenkratzer zart und bewohnbar.
Thöny war einer der bedeutendsten Maler, die Oesterreich je besaß. Sicher aber war er, trotz Rudolf von Alt, unser größter Aquarellist.