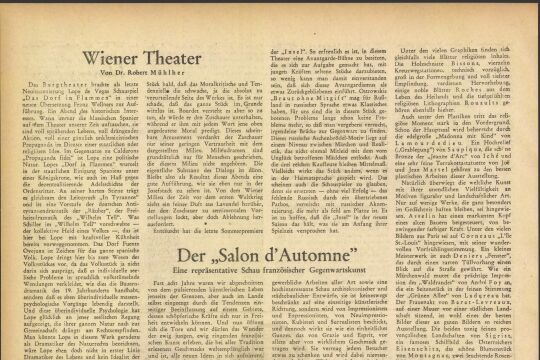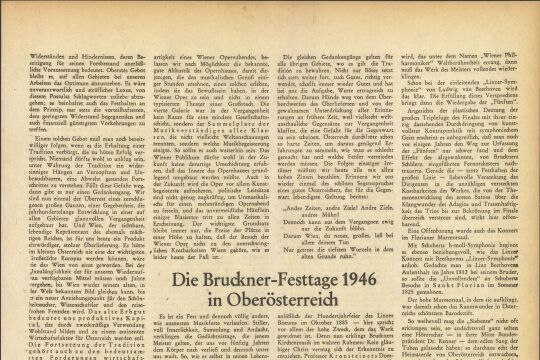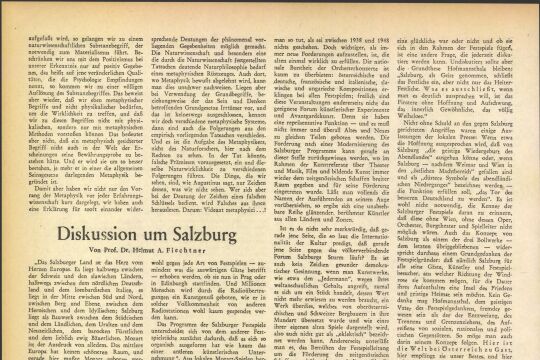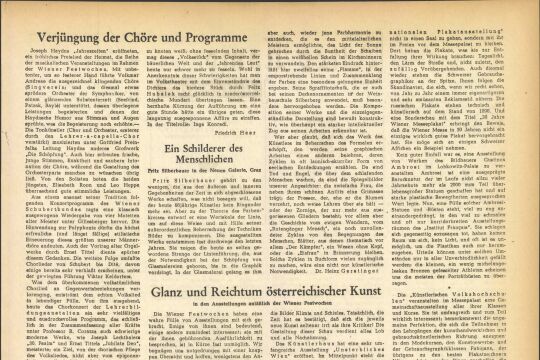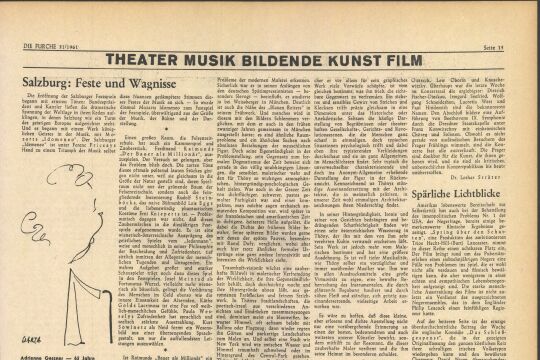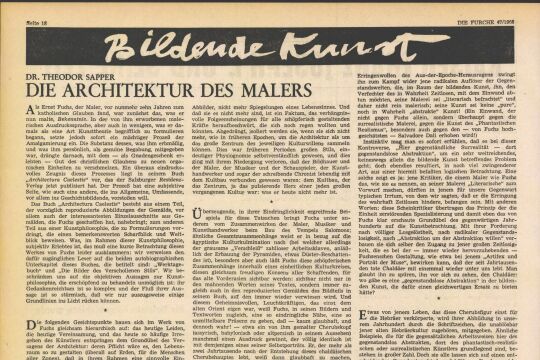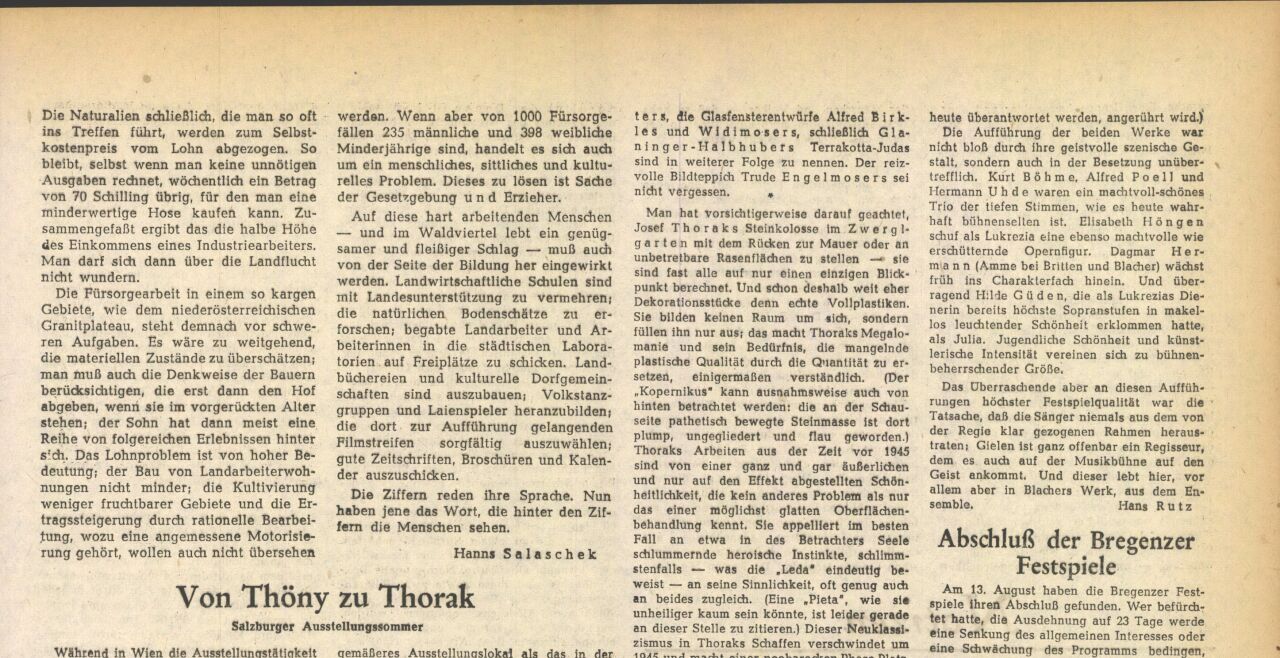
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von Thöny zu Thorak
Wahrend in Wien die Ausstellungstätigkeit fast vollständig ruht, ist sie in Salzburg ungewöhnlich lebhaft; es scheint, als ob dort die bildende Kunst unseres Landes zum erstenmal gleichberechtigt an die Seite der darstellenden getreten wäre. Möglich also und sehr zu hoffen, daß sie auch künftighin in Salzburg, das selbst eine Reihe ausgezeichneter Maler beherbergt, ein sommerliches Refugium und einen neuen Versammlungsort finden wird. Sie erweitert und bereichert die großen Festspiele wirklich aufs beste.
Die Ausstellung von 108 Werken des Österreichers Wilhelm Thöny (1888 in Graz geboren, 1949 in New York gestorben) in der Galerie Welz kommt fast einer Neuent-dedcung dieses hervorragenden Malers gleich, der in Österreich ob seiner langen Abwesenheit ganz vergessen worden wäre, hätte die Grazer Secession, deren Gründer Thöny im Jahre 1923 war, sein Andenken und seinen Einfluß nicht getreulich bewahrt. Diese Exposition dürfte denn daher die wichtigste dieses Festspielsommers sein. Thönys Stil und Eigenart sind in wenigen Worten kaum zu umschreiben; man möchte ihn spätimpressionistisch nennen, aber er ist doch auch wieder abstrakt. Dieser Maler sah die Wolkenkratzer New Yorks aufgelöst in Licht und Luft, wie nur je ein Impressionist sie sehen würde, aber er zerlegte das impressionistische Sehbild in seine einzelnen Teile und baute sie in gänzlich unimpressionistischer Art nach formalen Regeln, wie kein Abstrakter sie noch strenger befolgte, wieder zusammen. Thöny machte aus Augenblickseindrücken Zustände, er malte seine Denkbilder so, als wären sie Abbilder — wahrhaftig ein komplizierter Schaffensprozeß, der voll von Widersprüchlichem Ist. Aber er fand in der Tat jenen winzigen Punkt, in dem die Widersprüche gerade noch ein vibrierendes und sehr gefährdetes Gleichgewicht hielten; das macht eine Bilder so erregend, faszinierend und in all ihrer nervösen Labilität vielleicht sogar beängstigend. Wollte man den späten Thöny unter die großen Individualisten der modernen Malerei einreihen — und das gebührt ihm —, müßte man ihn in die Nähe Bonnards stellen, den er gewiß nicht an Fülle und Heiterkeit, wohl aber an Erlesenheit übertrifft.
Die Arbeiten Fritz Wotrubas haben im viel zu großen Carabinieri-Saal der Residenz, dessen Licht überdies nicht das beste ist, eine recht unglückliche Aufstellung gefunden. Die neueren unter ihnen, die im letzten Jahre entstandenen, scheinen uns immer noch eher Versuche denn endgültige Ergebnisse seiner jetzigen Stil- und Arbeitsperiode zu sein; Versuche, die auf verschiedene, aber stets entschiedene und rücksichtslose Weise und unter Ausschluß aller Reizmittel die Darstellung einer strengen und ernsten, auf alles Zufällige verzichtenden Harmonie bezwecken — einer sehr gedanklichen und gesetzmäßigen Schönheit. Sie sind immer interessant, manchmal so schön wie der steinerne ,Frauenkopf“, öfter auch so problematisch wie der .Bronzekopf“, der ein picasseskes Simultanmotiv ins Plastische übersetzen will. So befriedigend und in sich abgeschlossen, wie es in ihrer Art die früheren Wotruba-Plastiken waren, ist vorläufig noch keine, der „Sitzende“ vielleicht ausgenommen. Aber der Ernst, mit dem ein Künstler, der auf einer früheren Stilstufe den Beifall der .Modernen“ wie der Anhänger der .alten Kunst“ erhielt, seine schon gewonnene Sicherheit aufgab und sich auf neue und durch Askese erschwerte Wege begab, bleibt aller Anerkennung wert.
Eine sehr ambitionierle Ausstellung neuzeitlicher christlicher Kunst, die gleichfalls ein würdigeres und ihrem Ernste gemäßeres Ausstellungslokal als das in der Bundesgewerbeschule verdient hätte, wird von zumeist jüngeren Künstlern getragen, unter denen einige Tiroler besonders hervorstechen. Schneider-Rappel zeigt im besten Sinne des Wortes moderne Altargeräte von erstaunlicher Stilreinheit; sein Kelch mit dem Bergkristallknauf und ein Pektorale von LÜH Freundel aus Naturachat dürften das Hervorragendste dieser Exposition sein. Die Maler und Plastiker haben es neben den Kunsthandwerkern, die leichter auf vorgeprägte und heute noch gültige Formen zurückgreifen können, wie immer, so auch hier, schwerer; daß es dennoch möglich ist, zeitgemäße Formensprache mit dem Geiste der Devotion zu erfüllen, beweist die hochbegabte Veva Toncic mit einer schlichten „Maria mit den Tieren — warum der häßliche und materialwidrige Farbanstrich dieses Zementgusses? — und einem Portalbalken für eine Kapelle, zeigt Max R i e d e r mit seinem „Abendmahl“. Der Altarentwurf Max Spielmanns, die Kohlezeichnungen Franz Leiters, die Glasfensterentwürfe Alfred B i r k-les und Widimosers, schließlich Gla-ninger-Halbhubers Terrakotta-Judas sind in weiterer Folge zu nennen. Der reizvolle Bildteppich Trude Engelmosers sei nicht vergessen.
Man hat vorsichtigerweise darauf geachtet, Josef T h o r a k s Steinkolosse im Z w e r g 1-garten mit dem Rücken zur Mauer oder an unbetretbare Rasenflächen zu stellen — sie sind fast alle auf nur einen einzigen Blickpunkt berechnet. Und schon deshalb weit eher Dekorationsstücke denn echte Vollplastiken. Sie bilden keinen Raum um ich, sondern füllen ihn nur aus; das macht Thoraks Megalomanie und sein Bedürfnis, die mangelnde plastische Qualität durch die Quantität zu ersetzen, einigermaßen verständlich. (Der „Kopernikus kann ausnahmsweise auch von hinten betrachtet werden; die an der Schauseite pathetisch bewegte Steinmasse ist dort plump, ungegliedert und flau geworden.) Thoraks Arbeiten aus der Zeit vor 1945 sind von einer ganz und gar äußerlichen und nur auf den Effekt abgestellten Schön-heltlichkeit, die kein anderes Problem als nur das einer möglichst glatten Oberflächenbehandlung kennt. Sie appelliert im besten Fall an etwa in des Betrachters Seele schlummernde heroische Instinkte, Schlimmstenfalls — was die .Leda eindeutig beweist — an seine Sinnlichkeit, oft genug auch an beides zugleich. (Eine Pieta“, wie si unheiliger kaum sein könnte, ist leider gerade an dieser Stelle zu zitieren.) Dieser Neuklassizismus in Thoraks Schaffen verschwindet um 1945 und macht einer neobarocken Phase Platz. Ein leichthin vorgenommener Stilwechsel, der einen „Fischer von Erlach“, „Paracelsus“, „Kopernikus“ und einen „Grünewald“ zur Folge hatte — ungeheuerliche Drapprien, die sich teigig um weiter nicht erkennbare Körper winden und denen riesige, martialisch grimassierende Köpfe aufgesetzt wurden: eine eklatante Mißverkennung des Wortes „Geistesriese'. Übrigens stehen die kleinen Modelle dazu in der gedeckten Halle; sie sind — man müßte blind sein, um das zu übersehen — ausgesprochen kunstgewerbliche Arbeiten, weshalb denn auch die Großfiguren Monumentalkunstgewerbe, aber keinesfalls Denkmäler sind. Ohne Zorn und Eifer gesagt: dies alles ist innerlich unwahr, äußerlich aufgedonnert und weder das Geld noch die Aufregung wert, die es gekostet hat. Die Renovierung des Zwerglgartens ist das einzige Positive dieser Ausstellung, die sonst — wer Ohren hatte, hörte es — nur die Geister einer Vergangenheit beschwor, die man lieber ruhen lassen sollt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!