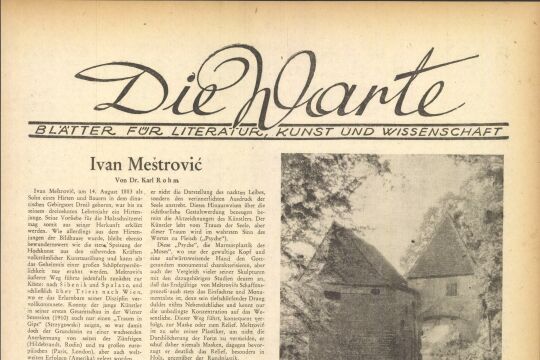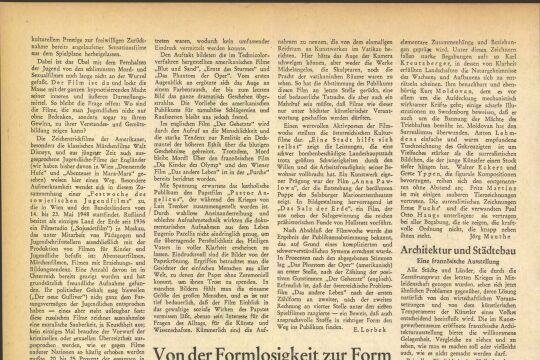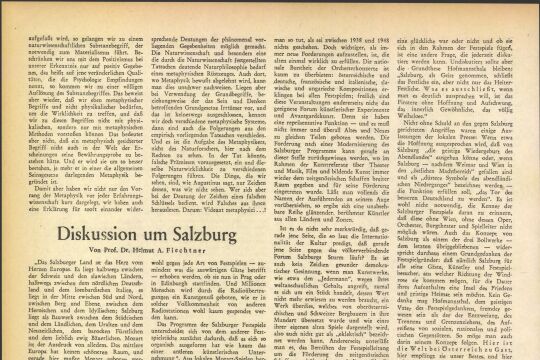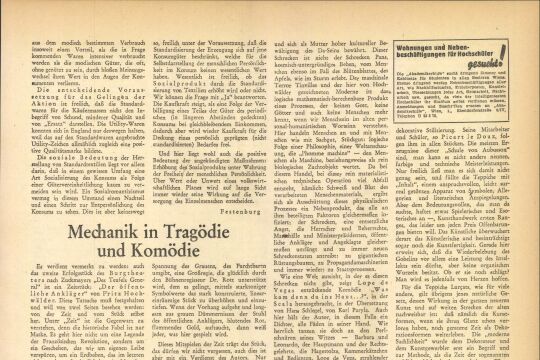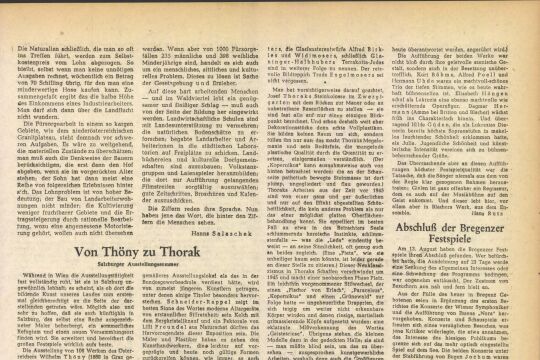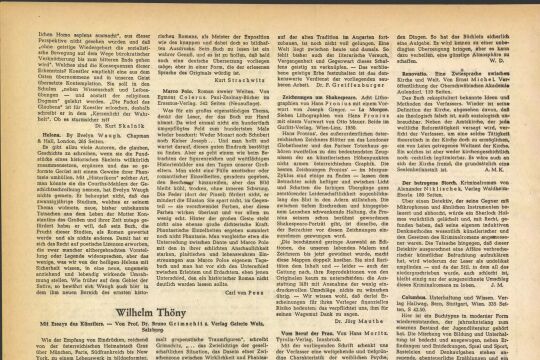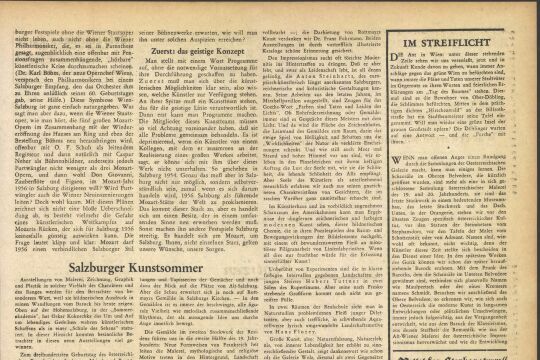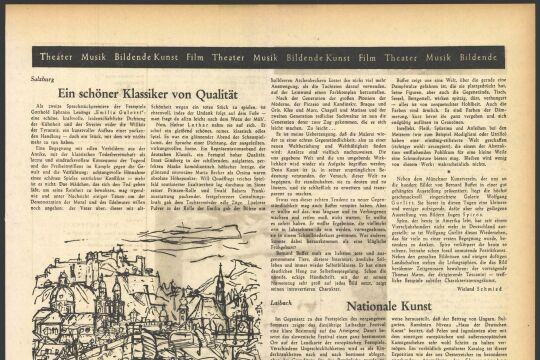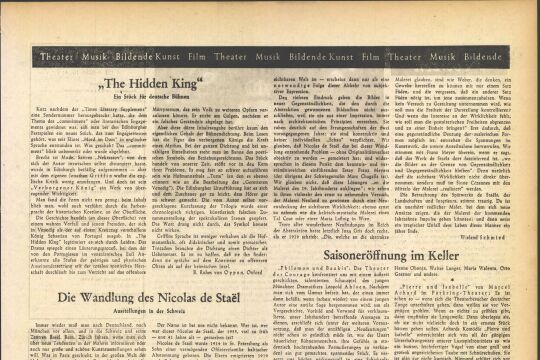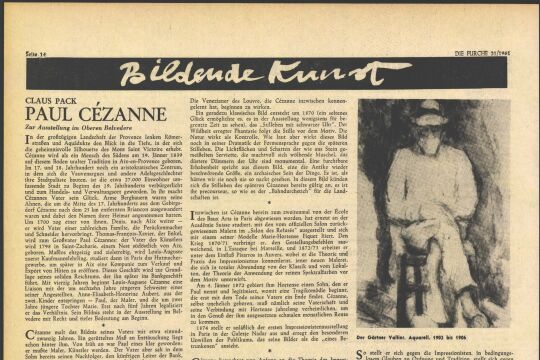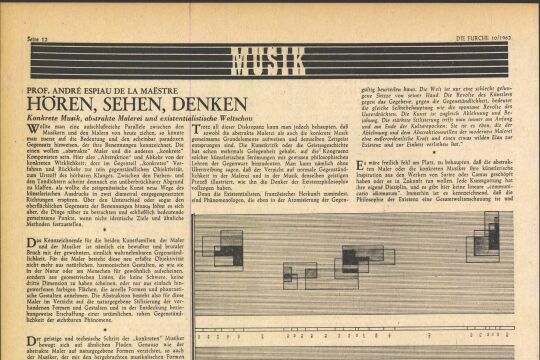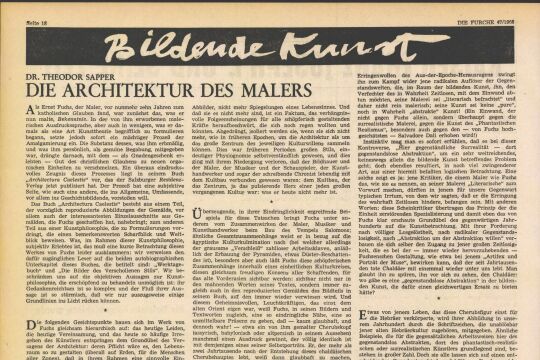Seit der großen Kokoschka-Ausstellung im Vorjahr im Wiener Künstlerhaus reißt die Diskussion um diesen, endlich heimgekehrten und nun auch offiziell anerkannten und gefeierten Künstler nicht mehr ab. Die Oeffentlichkeit ist bereit, sein Werk zu akzeptieren — da kritisiert die Kunstwelt Kokoschkas neue „monumentale“ Werke: seine Kraft sei dahin, er solle abtreten. Was ist davon zu halten? Snobismus? Eifersucht? Oder berechtigte Kritik? Kristian Sotriffer versuchte, sich vor den Bildern des 1886 in Pöchlarn, Niederösterreich, geborenen Meisters ein eigenes Urteil zu bilden.
„Eine lebendige Empfindung zu erwecken, ist Zweck der Kunst", hat August Macke gesagt. Diese Empfindung kann ihre Lebendigkeit verschiedenen Ursachen verdanken und den mannigfaltigsten künstlerischen Ausdrucksarten entspringen. Ohne sie wäre jedes Kunstwerk tot. Allerdings kann es vorkommen, daß ein bestimmtes Bild dem fragenden Betrachter keine Antwort gibt, während ihn ein anderes rasch anspricht und sich ihm sogleich erschließt. Das Befragen der Bilder nach der Notwendigkeit ihres Bestehens und nach ihrem geistigen Wert setzt eine Kenntnis ihres Eigenlebens und ein Erahnen des Zustandes, aus dem sie entstanden, voraus. Unter Menschen, die dąs Betrachten der Bilder verstehen und die mit ihnen leben, kommt eine starke Gegensätzlichkeit im Beurteilen eines Bildgehalts und seines künstlerischen Wertes selten vor. Was aber ist es, das die lebendige Empfindung (die oft noch viel mehr sein kann: ein plötzliches Verstehen und Erahnen von Zusammenhängen, ein Anflug des Glücks, ein Ausruhen und Gelöstwerden) hervorruft?
Kokoschkas frühe Bilder, die Porträts vor allem, sind von den Bildern großer Maler früherer Epochen, deren Verbindung von handwerklicher Geschicklichkeit und Realisation einer Idee (oder eines geistigen Erlebnisses), eindeutig unterschieden. Sie sind kaum gemalt, sondern eher skizziert und mehr mit zeichnerischen als mit malerischen Mitteln gestaltet. In diesen Bildern ist herumgekratzt und gewischt, die technische Fertigkeit weicht der Probe, dem Suchen nach einer neuen Sprache in der Malerei, da die überkommenen Ausdrucksmöglichkeiten zur Charakterisierung der Psyche eines Menschen und der eigenen Teilnahme am Sein nicht mehr ausreichen. Aber sie gewinnen dadurch in eminentem und bestürzendem Maße an Lebendigkeit und Faszination des Ausdrucks; die Seele, das Innerste ist dem Menschen herausgerissen, die Intimität seines Seins wird ihm genommen und alles: Tragik und Leidenschaft, Leid und Hoffnung, Lebensgier und Versagen, Sehnsucht und Schmerz, wird ihm ins Gesicht geschrieben. Wehrlos ist der Mensch dem sezierenden, hellsichtigen und bohrenden Auge des Malers ausgesetzt. Aber es ist die Malerei, die wir an den Bildern der Alten und auch an einigen aus unserer Zeit bewundern: man kann sich weder an einer glücklichen Farbenzusammenstellung, an von einem liebenden Malerauge entdeckten Kleinigkeiten, denen im Bild Bedeutung zuwächst, noch an einer tröstenden oder erhebenden Stimmung erfreuen (was aber, recht besehen, auch keine Forderung an die Kunst sein kann). Trotzdem und erst recht steht man wie gebannt vor diesen Werken bedingungsloser Hingabe eines Visionärs an das von ihm Gesehene. Man wird von ihnen gepackt, zur Teilnahme auf gefordert und muß in ihnen eine künstlerische Kraft von außergewöhnlicher Größe erkennen. Diese in einer psychogrammhaften Niederschrift zum Ausdruck gebrachte Größe kommt freilich in den Zeichnungen Kokoschkas, wahren Wunderwerken im Erspüren feinster seelischer Regungen, noch klarer und eindeutiger heraus. Kokoschka war und ist in erster Linie Zeichner, er hat die Malerei in seinen Bildern — für sich betrachtet — selten einer seinem schöpferischen Genie entsprechenden Höhe zugeführt. Seine besten Bilder, von den späteren Städte- und Landschaftsansichten abgesehen, sind mit dem Pinsel gezeichnet und mit harten Gegenständen in der Art graphischer Techniken bearbeitet.
Das Beispiel Kokoschka beweist, daß ein gutes Bild nicht unbedingt gut gemalt zu sein braucht, um nicht doch eines zu sein. Der ganze deutsche Expressionismus, der Fauvismus und vieles andere noch, was wir schätzen und hochhalten, wäre keine Kunst, betrachtete man diese Stilrichtungen nur unter dem Aspekt malerischer Bravour. Denn auf gute Malerei im herkömmlichen Sinn wurde kein Wert gelegt. Es kommt also noch auf andere Momente an, die ein Bild zum Kunstwerk erheben. Eine Voraussetzung muß immer erfüllt sein: die malerische Form darf nicht zur Schablone werden, sie muß auf eine ernsthafte künstlerische Absicht schließen lassen und das Können des Künstlers beweisen, der aus ganz bestimmten Gründen zu einem Mittel, seine Bildvorstellungen zu realisieren, gegriffen hat; sie muß die Notwendigkeit des angenommenen Malstils begreifen lassen. Viele späte Bilder Kokoschkas, etwa ab 1930, wirken leider schablonenhaft und mechanisch.
Kokoschkas frühe Bilder haben einen über zeugenden inneren Wahrheitsgehalt. Zugleich zittern sie vor künstlerisch bewältigter Nervosität und Unsicherheit und geben damit das Seismogramm einer Welt, die sich den ersten umfassenden Erschütterungen ausgesetzt sieht — vorläufig freilich noch von wenigen erfühlt oder erkannt.
Die Form verbindet sich mit der Farbe, durch die sie gehoben wird, und mit der Idee, der Bildvorstellung, die von Form und Farbe getragen wird und zur vermittelnden Erkenntnis einer als solcher erfühlten und erkannten Wahrheit wird. Das gute Bild ist verabsolutierte Wirklichkeit, ein geformter Weltstandpunkt und Wahrheitsbeweis für etwas, das ist, wenn es real vielleicht auch gar nicht faßbar wird. Es ist Sinnbild, Signum und ein fixiertes Ereignis. Im Betrachter bewirkt es ein Erkennen von nur vage oder unsicher erfühlten Ahnungen und Empfindungen; es löst dieselben Impulse aus, wie es ein paar Gedichtzeilen vermögen, in denen das Rätsel der Welt nicht gelöst, aber in seinem tiefsten Geheimnis begriffen und in ein faßbares Gleichnis gekleidet ist. All diese Komponenten ergeben, zusammengenommen in ihrer Realisation, das Kunstwerk. Die Akzente können sich jedoch auch verschieben und andere Einsichten, Gestaltungselemente und bildnerische Auffassungen können in das Bild eindringen: feste Regeln gibt es keine, und am Ende entscheidet sich der Wert eines Kunstwerks eben daran, ob es „eine lebendige Empfindung“ erweckt oder nicht. Eine genaue und unwiderlegbare Definition und eine Formel dafür, was Kunst und was Nichtkunst ist, gibt es nicht.
Kokoschka, der seine künstlerischen Möglichkeiten, durch die sich seine Bedeutung als einer der größten Maler des mitteleuropäischen Raumes in diesem Jahrhundert manifestierte, bereits in den ersten eineinhalb Jahrzehnten seines Schaffens entwickelte und ausreifen ließ, war zu jener Zeit den meisten seiner expressionistischen Zeitgenossen (den Malern der „Brücke“ zum Beispiel) deshalb voraus, weil er sich nicht allein mit Form- und Ausdrucksproblemen, die sich gestellt hatten, auseinandersetzte, sondern auch das traditionelle Element in seine Kunst einzuweben verstand und überdies von einer Feinfühligkeit und Ansprechbarkeit auf feinste seelische Emotionen und bestimmte Ausnahmssituationen war, wie sie den Mitstreitern um eine neue Ausdruckswelt nie in demselben Maß eigen war — sofern man bei den eigentlichen Expressionisten bleibt (die Maler des „Blauen Reiters“ bilden eine Gruppe für sich und wurden, von anderen Vorstellungen und Zielen geleitet). Damals war Kokoschka seinen wie er Neuland betretenden Zeitgenossen gelegentlich auch im Formalen überlegen, obwohl seine Stärke nicht gerade darin bestand — und bis heute nicht besteht; aber in seinen Dresdner Bildern (der Reihe „Dresden Neustadt“ etwa) gibt er schließlich einen wohlgelungenen Extrakt dessen, worum sich Nolde zum Beispiel ein Leben lang bemühte. Damals gewährte er vor allem der Farbe Einlaß in das Bildgefüge und erweiterte durch die mit' ihr gemachten Erfahrungen den Horizont seiner bildnerischen Fähigkeiten. Er behandelt sie jetzt kräftig, flächig, bringt sie miteinander in Beziehung (Cezanne hat dabei wohl auch ein wenig die Hand im Spiel) und steigert sie schließlich auch zu einer Reinheit der Form, der man wieder in den ersten und besten seiner großen Städte- und Landschaftsbilder begegnet: dem „Vierwaldstätter See“ (1924), der „Tower Bridge in London" (1925), in „Venedig“ (1924), dem „Hafen von Marseille“ (1925) und in „Lyon“ (1927) neben einer Reihe anderer. Geglückte, in hohem Maße bewältigte und ent deckungsfreudige Darstellungen dieser Art setzen sich auch in den Porträts noch bis zum Ende der zwanziger Jahre fort, etwa bis zum Bildnis des „Marcel von Nemes“ (1929).
Dann setzt die Periode ein, in der Kokoschkas bildnerische Kraft und seine künstlerischen Fähigkeiten nachlassen. Der „dramatische Impressionismus“, der nun, stets unterbrochen durch Bilder, die wieder an seine große Zeit erinnern, folgt, erlaubt ihm nicht viel mehr, als zum großen Teil form- und haltlose und alles andere als bewegende Ansichten von Gesichts-, Stadt-, Meer- und Berglandschaften in extremer Auflösung wiederzugeben. Diesen Bildern fehlt jener geistige Hauch und jene Entmateriali- sation oder Verdichtung, von der die frühen ausgezeichnet werden. Die Wahl der die Dramatik der Malweise noch steigernden Turmperspektive wiegt den Mangel an Klarheit und malerischer Disziplin nicht auf. Die Bilder sind nicht mehr gemalt. Sie lassen zwar den Meister erkennen, aber auch seine Routine. Jene Voraussetzungen, die wir als den Wert eines Kunstwerks bestimmend zu fixieren suchten, finden wir hier nur noch bruchstückhaft; den Glanz und die Wahrheit großer Malerei finden wir hier nicht. Mit dem Zerfall der Formen, der in erster Linie dem ungegliederten und rohen Pinselstrich zuzuschreiben ist, geht eine Minderung des Farbensinns parallel. Kokoschka, der einmal so herrliche Abstufungen von Blau und Grün kannte, vermischt nun alles, so daß sich in einigen Bildern kaum noch Konturen herausschälen.
Später geht er dazu über, sich an politischen, historischen und mythologischen Themen zu engagieren. Mitunter scheint es, als sei er, der manchmal heftig um sich schlägt und manchen seiner Brüder in der Farbe den Garaus machen möchte, selbst von seiner Kunst, wie er sie seit mehr als zwanzig Jahren ausübt, nicht so überzeugt, daß er es ihr überlassen könnte, durch sich selbst zu sprechen: er beginnt, sie zu kommentieren.
Kokoschka träumt von großen vergangenen Tagen, die er in seiner Kunst wieder heraufbeschwören und deren Glorie er fortsetzen möchte, um sie einer Welt entgegenzusetzen, in der es ihm nicht sonderlich gut gefällt. Er malt Weltansichten, wie das Thermppylen-Tryp- tichon, mit durchaus erkennbaren und ernsthaften Absichten, aber in so undelikater Manier, so ungeformt und das Element der Farbe so disharmonisch und willkürlich einsetzend, daß es keine Freude bereitet, vor diesem gemalten Epos zugleich tragischer und hoffnungsvoller Weltgeschichte zu stehen. Die Allegorie ersetzt kein Kunstwerk. Sie löst keine lebendige Empfindung aus.
Der Künstler ist sehr von Altdorfers „Alexanderschlacht“ eingenommen (um ein Beispiel dafür zu nennen, wie sehr er sich der in diesem Gemälde schon zum Ausdruck kommenden Kunst des Barocks verpflichtet weiß), über die er auch einmal ein paar vortreffliche Bemerkungen gemacht hat. Aber anstatt solch ein großes Vorbild, ein Muster an Aufbau und geformter Bewegung, in seinen Grundprinzipien zu übernehmen und so auch in seinen Bildern anzuerkennen, nimmt er von ihm eher weiten Abstand.
Der Mensch, dessen fehlendes Bild in der modernen Malerei Kokoschka beklagt, wird zum ungeschlachten, in brutaler Malweise wiedergegebenen Typus und läßt jene Liebe und jenes Bemühen vermissen, das den Menschen, sein ewiges Suchen, Streben und Erkęnnenwollen, in Bildern anderer Maler entstehen läßt, ohne daß er selbst in ihren Bildern auftauchte. Es gibt auch heute eine feinere, gelöstere und klarere Kunst als die Kokoschkas. Das Bild des Menschen kann sich schließlich auch in Bildern bewahren, die auf reale Gegebenheiten, auf die sogenannte Wirklichkeit, gar keinen offen erkennbaren Bezug nehmen. In Kokoschkas Bildern aber, wo der Mensch sichtbar dargestellt wird, verliert er an Kraft und Bestand durch einen heftig gestikulierenden Pinsel, der ihn zu halten und zu bewahren sucht und ihn doch nur zerreißt. Kokoschka, dem es im Grund darum zu tun ist, „die Einsicht in den Sinn menschlicher Tätigkeit, Gestaltung zu bewahren“, dem es um die Humanitas geht, findet die Realisation dessen, was er sagen möchte, nicht. Er überzeugt nicht mehr. Die vielen Betrachter, die man voller Verständnislosigkeit und bestürzt vor den „Thermopylen“ stehen sah (Menschen, die vor anderen Bildern des Malers in Ekstase geraten konnten), bezeugen es. Seine Mittel reichen hier und auch anderswo zur Verwirklichung seiner Ideen und Vorstellungen nicht mehr aus. Kokoschka scheiterte am liebermaß seines Wollens.
Trotzdem ist uns dieser große Künstler nicht verlorengegangen. Was groß an ihm war und ist (es verhält sich nicht so. daß er überhaupt keine guten Bilder mehr zu malen verstünde — aber zwischen diesen und den anderen muß unterschieden werden), wird uns bleiben. Und es ist immer noch sehr vieles groß an ihm.