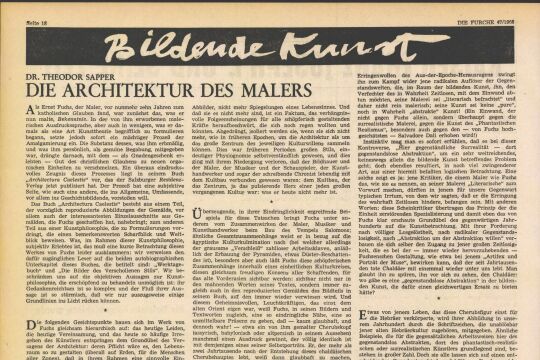T’Vie Künstler zuckten mit den Achseln, hoben die Hände oder hielten wenigstens ein mitleidiges Lächeln bereit. Für sie und viele andere war es wieder einmal ein Zeichen der Rückständigkeit, als sie am Vortag der Eröffnung der „größten Weltparade der zeitgenössischen Kunst“ vernommen hatten, daß Seine Eminenz, der Patriarch von Venedig, Monsignore Giovanni Urbani, die Gläubigen vor dem Besuch der Ausstellung warnte und sie für den Klerus verbot. Die Kirche hat seit jeh nicht viel übrig gehabt für die fortschrittliche Kunst, hörte man sagen. Daß aber der Staatspräsident, entgegen der Ankündigung, nicht zur feierlichen Eröffnung kam, wurde rundweg als Botmäßigkeit des italienischen Staates gegenüber der katholischen Kirche gedeutet. Als dann auch noch der „Osservatore Romano“ mit einer unmißverständlichen Stellungnahme herausrückte, schloß sich für die meisten der Kreis: der Patriarch von Venedig hat nur auf Anweisung der Kurie gehandelt, hieß es. Die schönen Zeiten der goldenen Freiheit unter Papst Johannes sind vorbei. Paul VI. will zwar in den Fußstapfen seines Vorgängers weiterschreiten. Doch er zeigt sich unentschlossen und läßt den anderen die Initiative. Die Kurie der Pacelli-Zeit nimmt nochmals überhand, und der Quirinal beugt sich ihrem Willen.
So stand die Biennale im Kreuzfeuer der Kritik, noch ehe sie begonnen hatte. Die Weltpresse beschäftigte sich mit dem Skandal, bevor die bedächtigen Kunstkritiker und gewissenhaften Journalisten ihre ausgewogenen Kommentare verfaßt hatten. In unserer sohnellebigen Epoche werden die Schlußfolgerungen rasch gezogen. Die auf Neuigkeit um jeden Preis erpichte Tagespresse nimmt die Antworten vorweg, reimt sich das Unbekannte mit einigen Klischeevorstellungen zusammen, hat keine Zeit, die Hintergründe der Geschehnisse aufzuspüren. So ist ein Kirohenfürst, der den Gläubigen vom Besuch einer Kunstausstellung abrät, rückständig, und ein Staatspräsident, der einen Tag später nicht zu ihrer Eröffnung kommt, ist botmäßig, und beide sind bloße Schachbrettfiguren einer oberen Instanz, wenn diese schließlich die Vorkehrungen bestätigt und begründet.
Nun soll nicht bestritten werden, daß der „Osservatore Romano“ nicht gut beraten war, als er in seinem vielbeachteten Artikel, „Die letzte Schande“, die Biennale in einen Topf mit dem Minikini warf. Indem der Chefredakteur der vatikanischen Zeitung die Bewunderer der Badekostüme mit der entblößten Brust auf die gleiche Ebene stellte wie die Verehrer der sogenannten „pop art“, konnte der Eindruck aufkommen, der Patriarch hätte dem Klerus den Besuch der Biennale untersagt, weil auf ihrem Gelände erotisch gewagte Bilder und Skulpturen zu sehen wären. Dies ist aber nicht der Fall.
„Es gab vielleicht noch keine Biennale, die derart bar ist jeglicher Obszönität. Wenn es in der ganzen Ausstellung zehn Bilder gibt, die entblößte Frauenbrüste zeigen, so ist es viel", sagte Professor Umbro Appollonio, ein bekannter Kunstkritiker und Biennale-Direktor. „Das Repertoire unserer ,Zweiunddrexßgisten’ ist besonders originell. Es reicht von den Autowracks der Amerikaner bis zu den ,Kraft- durch-Freude’-Bildern der Russen, von den zuckenden Fangarmen der belgischen Avantgarde bis zu den kupfernen Computer-Eingeweiden italienischer Skulpturen, von den riesigen weißen Leinwänden der Monochromen bis zu den farbsprühenden Ölwänden der allerletzten Tachisten, von den Neo-Figurativen bis zu den Hyperabstrakten. Man kann unserer jetzigen Ausstellung alles vorvjerfen, außer, daß sie das Obszöne schonungslos zur Geltung bringe.“
Ein Rundgang durch die 26 Pavillons, in denen 34 Staaten
— drei mehr als vor zwei Jahren — dreieinhalbtausend Manifestationen von 500 Malern und Bildhauern vorzeigen, was ihre allein verantwortlich auswählenden Kommissare als moderne Kunst verstehen, bestätigt das Urteil unseres Professors. Wer die Schönheit der Frau, ihre Nacktheit und Weiblichkeit zum Gegenstand nimmt, wird in der heutigen Kunst unweigerlich zu den Vorvorgestrigen gezählt. Die Ex- und Impressionisten sind vergessen, die Naturalisten überholt, die Neofigurativen stecken noch, im Schlepptau der abstrakten Kunst. Dies ist es eben: die meisten heutigen Maler sind derart dem Abstrakten verhaftet, daß für sie die Darstellung des Figürlichen — wenn überhaupt — erst schwach durchschimmert. Bei Karei Appel, dem holländischen Maler, kann man es beispielsweise beobachten. Seine „Komposition 1961“ verliert sich im Nebelhaften, doch ein Jahr später tritt eine Gestalt hervor, erst undeutlich und versponnen. Zweimal muß man hinschauen, um zu erkennen, daß es Jasmine, eine junge (übrigens mit Kleidungsstücken wohlversehene) Frau, ist!
In der Biennale 1964 herrscht das Dekorative, Ornamentale, der künstlerische Ausdruck des Technischen vor. Käme ein Marsbewohner auf die Erde und verstünde er unsere Zeichen, so würde es ihm leicht fallen, zu begreifen, daß wir mitten im Maschinenzeitalter stehen. Viele Künstler begnügen sich damit, lediglich die Vorbilder der Technik zum Ausdruck zu bringen. Die „Schöpfungen“ eines Colla unterscheiden sich kaum von den nur den Gesetzen der Funktionalität folgenden Produkten der Ingenieure.
Während Colla jedoch im Statischen verharrt, bedient sich die Gruppe T aus Mailand der Elektrizität, der Elektromechanik und des Magnetismus, um die Aufmerksamkeit der Besucher zu erwecken. In der Rokokozeit erging man sich in schönen Wasserspielen. Jetzt bedarf es raffinierterer Reizeffekte, um noch bemerkt zu werden. Zu verschiedenen Geschwindigkeiten rotieren zwei Zylinder um die eigene Achse und werfen ein Blinklicht, das mit jeder Verkehrsampel nach zehn Uhr abends konkurriert. Anceschi führt Eisenstäbe vor, die — wie viele heutige Menschen — sich schnell bewegen und doch nie vom Fleck kommen. Die „Magnetische Oberfläche“ von Boriani zeigt ein Bild, das sich in einemfort auflöst und zusammensetzt. Es ist der Ausdruck einer Gesellschaft, in der sich jeder einzelne frei fühlt und doch von unheimlichen, hintergründigen Mächten geschoben wird.
Alle diese Manifestationen vermögen im besten Fall das Interesse des Betrachters gefangen zu nehmen. Sie als schön zu betrachten, ihnen auch nur das Attribut der „Kreation“ zuzusprechen, fällt einem schwer.
Die besten unserer modernen Künstler versuchen, dem heute technisch Gegebenen einen ästhetischen Ausdruck zu verleihen. Zu ihnen möchte ich den Berner Bernhard Lugin- bühl, vor allem aber den Ungar-Schweizer Zoltän Kemeny zählen. Ihre Schöpfungen füllen den Schweizer Pavillon und sichern ihm einen regen Besuch. Beide Künstler setzen sich mit der heutigen Welt, die wohl oder übel eine technische geworden ist, auseinander. Sie flüchten sich nicht in eine vielleicht schönere, aber nicht mehr wirkliche Vergangenheit wie ein Accardi, der sich in herrlichen Farbenspielen verliert, die angesichts der Nöte unserer Zeit einen manierierten Eindruck hinterlassen. Kemeny und Luginbühl ergeben sich nicht den billigen Anliegen eines Alviani, der Metallplättchen so zusammenfügt, daß sie wundersame Lichteffekte erzielen, doch mehr in eine Mustermesse als in diese Kunstausstellung passen. Luginbühl und Kemeny schufen auch nicht bloße Spiegelbilder des Volkes und der Wahlheimat, denen sie angehören, und vermögen darum mehr Menschen anzusprechen als jene russischen, bulgarischen, tschechischen, polnischen und spanischen Maler und Bildhauer, die zum Wohlgefallen ihrer totalitären Regime arbeiten und uns unwillkürlich verkrampft Vorkommen müssen.
Ein schreckliches Gefühl überkam mich, als ich das Bild von Glandin auf mich einwirken ließ. Das Kind in den Armen seines Vaters ist kein Kind, sondern ein altkluges, gefühlloses Kolchosenkinderheimprodukt. Der Vater ist kein Vater, sondern das Arbeitspotiental 34529673 des Staates, mehr Robot als Mensch, wie die Mutter, ein willfähriges Produkt der Gesellschaft, das nicht mehr nur in der Gesellschaft und durch sie lebt, sondern für sie lebt und zur Freude des Regimes den eigenen Willen völlig dem kollektiven Willen untergeordnet hat. Daß dies das Los nicht nur dieser russischen Arbeiterfamilie, sondern auch manches Sowjetkünstlers ist, daß zehn Jahre Chruschtsdhow-Ära die dreißigjährige stalinistische Periode nicht zu überwinden vermochte, daß Dargestelltes und Darsteller die gleiche traurige Wirklichkeit zum Ausdruck bringen, hat Glandin mit erschütternder Eindringlichkeit dargestellt.
Wir dürfen uns glücklich preisen, daß unsere Künstler noch frei schaffen dürfen, daß ihnen niemand den Gegenstand, die Kunstrichtung und die Ausdrucksmittel vorschreibt. Und doch muß man sich fragen, ob denn der Unterschied zwischen den Kunstwerken diesseits und jenseits des
Eisernen Vorhanges so riesengroß ist, wie wir es uns gerne einbilden. Niemand schreibt Luginbühl und Kemeny vor, was und wie sie arbeiten müssen. Doch ihre Ergebnisse zeigen gleichwohl die Verkrampftheit unserer heutigen seelischen Situation. Wohlverstanden: diese Verkrampftheit ist nicht von außen aufgezwungen wie in einem totalitaristi- schen Staate, heiße er nun nazistisches Deutschland, faschistisches Italien oder stalinistische Sowjetunion. Sie ist aus freien Stücken gewollt, auf eigenen Antrieb erstrebt. So wie der einzelne Arbeiter oder Angestellte im freien
Westen gerne Überstunden macht, um sich einen besseren Wagen leisten zu können und sich darob versklavt, um im allgemeinen Wettlauf des Noch-Mehr und Noch-Größer nicht ins Hintertreffen zu gelangen, so zeigt ein Kemeny die selbstgewählte Sklaverei unserer sogenannten freien Welt. Wenn der einzelne darauf verzichtet, seine Freiheit auszunützen und zum Opfer seiner immer höheren Ansprüche wird, kommt es letztlich auf das gleiche hinaus, ob er von außen her gezwungen oder von innen — den in sich aufgenommenen allgemeinverbindlichen Regeln und Gesetzen — her genötigt wird. Unter den Voraussetzungen einer selbstgewählten Sklaverei kann ein totalitaristisches Regime fast über Nacht Fuß fassen. Die besten unserer heutigen Maler und Bildhauer zeigen dies mit erschreckender Eindringlichkeit. Sie halten uns einen Spiegel vor, an dem wir nicht vorbeisehen sollten.
Doch sind wir modernen Menschen überhaupt imstande, den traurigen Anblick auszuhalten? Ist es nicht besser, wir klammern uns an die Maßstäbe einer vergangenen, geordneteren Zeit? Von alters her ist es das Anliegen der katholischen Kirche, die Gläubigen, wenigstens die Geistlichkeiten vor gewissen Auswüchsen einer chaotisch gewordenen Zeit zu bewahren. Dieser Gedanke war auch wegleitend für die Entscheidung des Patriarchen. Wir konnten dies nicht seinem Mund entnehmen. Nach der Eröffnung der Biennale ist Seine Eminenz abgereist. Durch ein Hintertürchen ist es uns aber gelungen, zu seinem Sekretär, Don Silvio Zardön, vorzudringen. Doch dieser ist an seine Schweigepflicht gebunden. — Wir konnten nur Einblick nehmen in das Kommunique der Kurie von Venedig. „Nach ausgewogenem Urteil zuständiger Fachleute“, heißt es in der Verlautbarung, „ist von der Besichtigung einiger Werke der 32. Biennale völlig abzuraten. Die kirchliche Autorität sieht sich darum genötigt, den Ministranten, Geistlichen und Ordensleuten — auch jenen, die nur auf der Durchreise sind
— den Besuch der Biennale zu untersagen." Im Kommentar der Diözesanzeitung „L’Avvenire d’Italia“, die unter dem Motto „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“ steht, wird jedoch nicht die Obszönität gewisser Bilder, sondern „der Sadismus und die Ekelhaftigkeit einiger Manifestationen der sogenannten popular art als „Ausflüsse einer schweren moralischen Krise“ gebrandmarkt. Der Kommentar hebt hervor, daß damit „kein Urteil über die Ausstellung in ihrer Gesamtheit“ gefällt wird. Die Kirche ist „keineswegs feindlich eingestellt gegenüber den modernen Ausdrucksformen; nur sollten diese verwendet werden, um den Menschen zu erheben, nicht aber, um ihn zu erniedrigen und ihm lediglich sein Sklavendasein zum Bewußtsein zu bringen“.
Daß viele Manifestationen der pop art ein Gefühl des Ekels und des Abscheus hinterlassen, kann nicht bezweifelt werden. — Es fragt sich jedoch, ob es nicht wenigstens mittelbar wertvoll ist, daß auch mit solchen starken Herausforderungen das Gewissen einer sich in zunehmendem Maße dem äußeren Tand ergebenden, selbstgefälligen, in diesem Sinne luziferischen Menschheit aufgerüttelt wird, auf daß gerettet wird, was noch gerettet werden kann. Es braucht heute besonderer Reizmittel, um überhaupt nur beachtet zu werden. Mit einer Rückbesinnung auf die Vorbilder der Vergangenheit ist den meisten — auch den meisten Kunstbeflissenen — nicht geholfen. Die Zukunft vorwegzunehmen, ist auch nicht jedermanns Sache. Viele moderne Maler, Bildhauer, Komponisten und Filmschaffende sind der Ansicht, daß eine nicht zeitflüchtige, wahre Kunst gar nicht anders kann, als auch den Schattenseiten einer äußerlich schönen, aber innerlich in manchen Belangen morsch und häßlich gewordenen Welt Ausdruck zu verleihen. In dieser Hinsicht ist die pop art nur das Endprodukt einer bereits vor etwa 50 Jahren beginnenden Entwicklung.