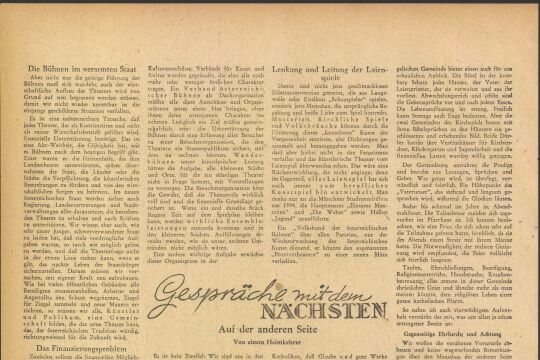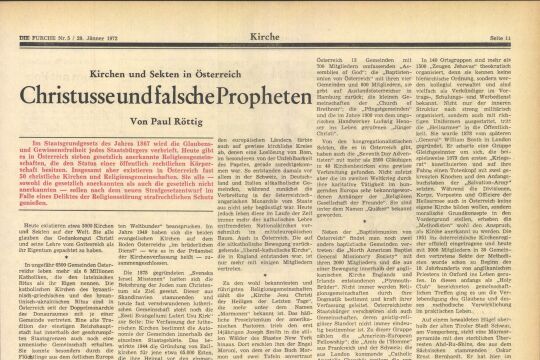DER JUSTIZMINISTER IST ZURÜCKGETRETEN, unerwartet selbst für den Koalitionspartner, überraschend für die Öffentlichkeit. Kein Wunder, daß sich, abgesehen von einem parteioffiziösen Kommunique, ein Rattenschwanz von widerspruchsvollen Kommentaren und Mutmaßungen an diese Demission knüpft. Aber gleichgültig, welche Gründe immer Doktor Tschadek zu diesem Schritt veranlaßt haben, nun ist, selbst nach dem Willen des scheidenden Ministers, der Weg frei, das Justizministerium, wie es dem Wunsch einer breiten Öffentlichkeit entspricht, in eine parteifreie Atmosphäre zu überführen. Diesem Wunsch schließen sich auch die Parteifreunde Dr. Tschadeks — aus welchen Gründen immer — nun an, freilich mit der Klausel „von nun ab bis zur Neuwahl des Parlaments“. Und nachher? Wird es nicht dann erst recht notwendig sein, an der einmal gewonnenen Erkenntnis festzuhalten?
KEIN BELIEBIGER KLEINER PARTEIREDNER, kein Hitzkopf und Radikalinski, sondern der österreichische Innenminister, der schon wiederholt Beispiele staatspolitischer Mäßigung gab, hat eine scharfe Attacke gegen jene Partei gerichtet, mit deren Vertretern er seit über sieben Jahren auf der gemeinsamen Regierungsbank sitzt. Was bekam man da nicht alles zu hören!
„Innerhalb der ÖVP existieren Gruppen, die monarchistische Tendenzen entwickeln. Es gibt aber auch eine Richtung, die den Dollfuß-Kurs anstrebt. Die Unbelehrbaren, die nie aufgehört haben, für Diktatur und Ständestaat zu wirken, machen sich in letzter Zeit besonders bemerkbar. In den letzten Monaten zeigt sich unverkennbar, daß auch führende Kreise innerhalb der ÖVP dem Treiben der Dollfuß-Gruppe zustimmen Meint dieser faschistische Flügel innerhalb der ÖVP wirklich, daß wir und alle, die ehrlich auf dem Boden der Demokratie stehen, die Erfahrungen der Vergangenheit vergessen haben?“
„Reaktionäre", „faschistischer Flügel" usw. — waren das wirklich die Worte des sozialistischen Innenministers der Republik Österreichs? Sie könnten viel eher aus dem Mund irgendeines kommunistischen Parteichefs in irgendeinem östlichen Nachbarland stammen, der damit den Auftakt zur neuen Säuberung gibt. Auch die ungarische, die tschechische und die polnische Sozialdemokratie wurden einmal wegen eines ominösen „faschistischen Flügels" öffentlich gerügt, bis sie rein und sauber waren — würdig und bereit für den großen Schmelztiegel der Einheitspartei. Abgesehen davon: Was soll es, wenn — wieder einmal — die Waffen des politischen Tageskampfes aus alten Arsenalen bezogen werden? Wir können uns genau so wie der österreichische Innenminister das Echo aus dem anderen, dem angegriffenen Lager vorstellen: die Erinnerungen an die Tage des Schutzbundes, die Rufe von den „marxistischen Bruderparteien“ — die „Rote Katze“. Wie die übergroße Mehrheit aller Österreicher sind wir gegen beide Spielarten ein und derselben Demagogie.
HELDEN ODER OPFER: das ist die Frage. Bei den Toten des zweiten Weltkriegs im allgemeinen, bei den gefallenen Österreichern im besonderen. Die Überlebenden der großen Katastrophe beschäftigt sie zur Zeit mit besonderer Heftigkeit. Anlaß gab der Beschluß einer Vorarlberger Gemeinde, den Text ihres Gefallenenmales von „Den Helden der Heimat“ auf „Die Heimat ihren Söhnen“ zu ändern. Begründung: die toten Soldaten seien eher Opfer als Helden zu nennen. Die Reaktion war heftig. Nachdem zuerst ein Salzburger Blatt eine Beleidigung der Gefallenen in diesem Schritt gesehen hatte, glaubte ein Wiener Montagblatt sich gar berechtigt, von „schäbiger Gesinnung“ sprechen zu können, „denn sie spricht dem Kämpfen und Sterben der gefallenen Soldaten aller Völker jede Mannesmoral und ethische Haltung ab und degradiert sie zu einer Herde, die sich auf die Schlachtbank treiben lassen mußte“. Und die Wirklichkeit? Einige Beispiele für Millionen: Der Offiziersanwärter, der sich vor der Matura kriegsfreiwillig gemeldet hatte und den irgendwo in Rußland die tödliche Kugel traf, glich in seinem Tode wenig der Pose steinerner Heldenmäler. Oder: Der durch List und Versprechungen zur SS gelockte junge Musiker aus Wien, der in Frankreich in einem Anfall tiefster Depression und Verzweiflung gegen sich selbst die Pistole richtete. Held oder Opfer? Die vielen kalten Toten auf den Höhen von Hollerath und Rocherath während der Rundstedt- Offensive 1944, von der Artillerie des Gegners reihenweise gefällt, stumm, ohne Laut und ohne eine Tat waren sie gestorben — und mit ihnen Millionen in Ost und West, in Nord und Süd, in Feldgrau und Khaki —, Opfer des größten Wahnsinns
der Weltgeschichte. Sie alle sind stumm. Deshalb müssen die Lebenden reden, wenn — es ist wieder einmal so weit — hohle Töne an den Gräbern der Toten laut werden und da und dort Versuche unternommen werden, ihren Opfergang in politisches Kleingeld umzuwechseln.
DIE BEVÖLKERUNGSSTATISTISCHEN TABELLEN unseres Zentralamtes für Statistik verdienten eine nachdenklichere Beachtung, als ihnen allgemeinhin geschenkt wird. Gelegentlich fährt der biedere Staatsbürger auf, wenn er wieder einmal durch eine Zeitungsnotiz daran erinnert wird, daß die österreichische Geburtenziffer mit 14,8 Prozent im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung den schwächsten Bevölkerungsnachwuchs unter sämtlichen von der Statistik der UNO erfaßten Staaten ausweist, die teilweise sogar um ein Vielfaches die österreichische Geburtsrate übertreffen. Immer noch quillt das Leben unseres Volks am kräftigsten nicht aus den Bereichen der wohlhabenden Gesellschaft; es ist vielsagend, daß von den 1951 gezählten 86,176 in Österreich ehelich Geborenen fast die Hälfte (49 Prozent) Arbeiterkinder waren; 19 Prozent waren Kinder von Angestellten und 29 Prozent von Selbständigen, unter den letzteren wiederum gehörten 71 Prozent dem bäuerlichen und forstwirtschaftlichen Stand an. Vermerkt sei, daß in bezug auf die unehlichen Geburten Salzburg neuester Zeit mit Kärnten in Konkurrenz und genau wie dieses ein Viertel (24,2 Prozent) unehelicher Kinder unter allen Neugeborenen zählt. Doch werden die Durchschnittsziffern beider Bundesländer Überboten von dem obersteirischen Bezirk Murau, der mit 35 Prozent unehelich Lebendgeborenen an der Spitze steht; den Gegensatz dazu stellt der burgenländische Bezirk Pullendorf, der mit acht Prozent die niedrigste Verhältnisziffer in Österreich ausweist. Die Unehelichkeit des Kindes hat eine sehr ernste Seite, die gern übersehen wird; sie bedeutet oft Mangel an Geborgenheit und Rechtssicherheit.
ZU SPÄT UND ZU FRÜH: dieses Motto steht über dem Lebenswerk und Schicksalsweg des Grafen Carlo Sforza, der als Repräsentant Alteuropas eben in dem Augenblick starb, in dem Neueuropa in Gestalt der wirtschaftlichen und politischen Union der westeuropäischen Völker (Schuman-Plän, Montanunion, Straßburg) seine ersten Gehversuche auf der weltpolitischen Bühne unternimmt. Als italienischer Außenminister übernahm er am Ende des ersten und wiederum am Ende des zweiten Weltkrieges eine undankbare, von niemandem bedankte Rolle auf sich: Mittler zu sein einer Völkergemeinschaft, die in Haß und Ressentiment auseinandertrat. Weder Jugoslawien noch Polen, weder Frankreich noch England, von anderen Nationen zu schweigen, haben ihm gedankt dafür, daß er nicht allen alles geben wollte, aber doch allen etwas. Sein eigenes Vaterland hat ihn mit Spott und Hohn überschüttet: als den „Lakaien“, den willfährigen Diener der „Feinde“, der die Ansprüche der Nation verriet. Die Wirklichkeit: das Scheitern eines Diplomaten, in einer Welt, die sich nicht mehr zu diplomatischen Spielregeln bekennen wollte. Das Scheitern eines Europäers in einem Europa, das durch die überhitzten Forderungen nationaler Leidenschaften und Eitelkeiten einfach nicht mehr zu jener Ruhe kommen konnte, derer es bedurfte, sollte ihm Genesung und Friede werden. „Der bedeutungslose Herr Sforza“; mit diesem Wjrt hat Mussolinis Propagandaministerium den Mann abgetan, der Werte und Grundsätze vertrat, die von allen, und gerade auch von seinen natürlichen Bundesgenossen zu wenig geachtet und realisiert wurden: Europa als eine Partnerschaft von Völkern, die das Maß, die Grenze achten und um Selbstbescheidung wissen. Grund genug, ihn zwischen 1925 und 1945 zu verachten. Grund genug, auf sein Wort nach 1945 zu hören, als er, lange Zeit allein, als erster im Westen für eine maßvolle und gerechte Beurteilung des deutschen Phänomens eintrat. Dann nahmen ihm andre das Wort ab; es wurde wieder still um ihn. Nun ist er gestorben. Alle aber, die in Europa leben und leben wollen, sollten den Lebensweg des Mannes bedenken, der im Zwischeneuropa, zwischen dem alten und dem neuen Europa bemüht war, etwas von dem sichtbar werden zu lassen, was ehdem — vor und noch nach dem Wiener Kongreß — Europa war: eine Gemeinschaft von Gegensätzen, die sich alle ihrer eigentümlichen Größe und ihrer eigentümlichen Grenze bewußt sind. So also tritt er ein in die Ehrenhalle der ruhmvoll Gescheiterten: seine Ruhestätte ist neben Stresemann und Briand. Seine Irrtümer sind begraben. Sein letzter Wille aber ist eine Verheißung: das eine Europa.
richte aufgerichtet hat, sowie die Verfolgungen der Christenheit in vielen Teilen der Welt lassen die Trennungswände zwischen den Kirchen in eigentümlicher Weise „transparent" werden. An der Spitze des wandernden Gottesvolkes marschieren die jungen Kirchen auf den Missionsfeldern, die sich je länger je mehr weigern, den Ballast der Traditionen der alten Kirchen weiterzuschleppen, und die neuen Gemeinschaften, die quer durch die verschiedenen Kirchen hindurch im Zeichen der Verfolgung entstehen. Von diesen unübersehbaren Tatsachen in der neuesten Geschichte der Christenheit muß sich auch das theologische Denken in der Ökumene in entscheidender Weise bestimmen lassen.
Wenn die Kirchen, so führten die anderen oben genannten Redner aus, die Botschaft von Amsterdam 1948 ernst nehmen, dann können sie nicht auf die Dauer in der Statik des Konfessionalismus verbleiben, sondern müssen Schritte wagen, um die Einheit in Christus, zu der sie sich bekannt haben, in sichtbarer Weise zur Darstellung zu bringen. Bezeichnend für den Geist, in dem die Beratungen in den einzelnen Sektionen geführt wurden, war die Tatsache, daß niemand von unübersteigbaren Schwierigkeiten sprach, sondern jeder bereit war, offen zu sein für neue Erkenntnisse und vertiefte Einsichten, durch die Trennungen und Unterschiede überwunden werden können. Ebenso war mit gleichem Ernst das Bewußtsein lebendig, daß der Glaube an die eine Kirche Christi tot ist, wenn er nicht durch die Tat des Gehorsams ergänzt wird, die diese Einheit auch sichtbar für die Welt werden läßt.
Aus der Fülle der Beratungen sei hier im besonderen auf die Frage der Kontinuität der Kirche in der Geschichte hingewiesen. Daß hier die verschiedenen Auffassungen über die Bedeutung der „apostolischen Sukzession" offenbar wurden, ist angesichts der Anwesenheit anglikanischer und orthodoxer Kirchenmänner einerseits und freikirchlicher Theologen (Presbyterianer, Methodisten usw.) andererseits begreiflich. Doch kann es als ein Fortschritt im ökumenischen Gespräch angesehen werden, daß fast allgemein die Notwendigkeit des geordneten Amtes für das Fortwirken der Kirche in Zeit und Welt anerkannt wurde. Freilich lag der Nachdruck der Diskussion auf dem Hinweis, daß die Kirche nur dann die Kontinuität mit der Urgemeinde wahre, wenn sie in drei Grundelementen mit dem apostolischen Zeitalter übereinstimme: in der Verkündigung (Kerygma), in der Gemeinschaft (Koinonia, Gottesdienst, Sakrament) und im Dienst (Dia- konia, Agape).
Im Zusammenhang mit der Frage der Kontinuität spielte das Problem der Apostasie (des Abfalls) in den Gesprächen eine große Rolle. Vor allem wurde auf die Gefahr der verhüllten Apostasie aufmerksam gemacht, die sich mit christlicher Redeweise und christlichen Ausdrucksformen tarnt und eine Loyalität an den Tag legt, die mit der gehorsamen Hingabe an Gott in Konflikt gerät. In unserer Zeit, so wurde ausdrücklich erklärt, hat die Kirche die dringliche Pflicht, ihre ausschließliche Hingabe an Christus von neuem deutlich zu machen, angesichts des hinterhältigen Vordringens des Säkularismus, angesichts der Herausforderung von seifen des Staatsabsolutismus, der die Gedanken des Menschen zu kontrollieren sucht und die Möglichkeit seiner Existenz als Christ in Frage stellt, ferner angesichts der drohenden Bedrückung der Christenheit in allen ihren Formen (wirtschaftlich, politisch usw.) und in allen Teilen der Welt.
Eines der schwierigsten und brennendsten Probleme der Konferenz wurde in der Sektion über die „I n t e r k o m m u- nion" behandelt. Die Orthodoxe Kirche erklärte von vornherein, daß sie außerhalb dieser Diskussion stehe, weil für sie eine Gemeinschaft in der Eucharistie nur zwischen Gliedern der Orthodoxen Kirche möglich sei. • Freilich hat auch sie dem Satz zugestimmt, daß sie das Sakrament den Gliedern anderer Kirchen in Fällen dringender Notlage nicht verweigere, was aber als Ausnahme ihre Lehre nicht ändere. Im Verlauf der Gespräche entwickelten sich immer deutlicher zwei Standpunkte. Die einen erklärten, daß die Interkommunion (die Abendmahlsgemeinschaft von Gliedern getrennter Kirchen)
kein Mittel zur Herstellung der Einheit der Kirche sei, sondern am Ende der ökumenischen Bemühungen stehen müsse, denn die Interkommunion sei Ausdruck für die Darstellung der Einheit der Kirche. Die Mehrheit dagegen war der Meinung, daß unter den Gliedern des ökumenischen Rates der Kirchen eine so grundlegende Einheit vorhanden sei, um eine gemeinsame Teilnahme am Tische des Herrn zu rechtfertigen oder sogar zu fordern, in dem Bewußtsein, daß die Interkommunion mit Recht und mit Nutzen der Wiedervereinigung vorausgehen könne. Dabei bekannten auch sie, daß dieses Problem erst vollkommen gelöst ist, bis volle und restlose Einheit erreicht wird. Die dem ökumenischen Rat angehörenden Mitgliedskirchen sollen daher ersucht werden, Gottesdienste mit „offener Kommunion" abzuhalten, das heißt Gottesdienste, bei denen die Glieder der anderen Kirchen eingeladen werden, am heiligen Abendmahl teilzunehmen. Ein solcher offener Abendmahlsgottesdienst wurde am 17. August im Dom zu Lund in der Form eines Hochamtes der Lutherischen Kirche Schwedens gehalten, bei dem an der Kommunion nicht nur Lutheraner, sondern auch Reformierte, Anglikaner und Vertreter aller Freikirchen teilgenommen haben. Die Sektion war sich darüber einig, daß das Problem der Inter-
kommunion mit besonderem Nachdruck auf das Gewissen der Kirchen und der Leiter der ökumenischen Bewegung gelegt werden sollte, denn das gemeinsame Arbeiten und Beten ist erst dann wirklich vollständig, wenn es auch sichtbar durch die gemeinsame Teilnahme am Tische des Herrn zum Ausdruck kommt.
Die theologischen Beratungen bildeten selbstverständlich nur die eine Seite der Konferenz, die andere hatte ihren Schwerpunkt in den gottesdienstlichen Veranstaltungen, in den Morgen- und Abendandachten, die jedesmal nach dem liturgischen Ritus einer anderen Konfession gestaltet waren. Ihren gottesdienstlichen Höhepunkt erlebte die Konferenz in dem eigentlichen Konferenzgottesdienst am 24. August, an dem der schwedische König teilnahm,, und bei dem der Erzbischof von Upsala predigte, nachdem in einer würdigen und großartigen Prozession die Delegierten, Sachberater und Gäste in den Dom eingezogen waren.
Welch eine ökumenische Weite diese Konferenz besaß, wurde einem bewußt, als ein Begrüßungstelegramm des Berliner Katholikentages mit herzlichen Segens- und Gebetswünschen für die Verwirklichung der vollkommenen Einheit eintraf, und als am Beginn der Konferenz der Erzbischof Brilioth die Anwesenheit von Beobachtern der römisch-katholischen Kirche mit den Worten unterstrich, „daß
die große römische Kirche den Bestrebungen nach einem besseren Verständnis zwischen den Christen verschiedener Traditionen nicht gleichgültig gegenübersteht, und daß eine Freundschaft der Seelen möglich ist trotz ecclesiastischer Schranken, die unüberbrückbar erscheinen".
Auf 25 Jahre Arbeit schaut die ökumenische Arbeit für „Glaube und Kirchenverfassung" zurück, eine kleine Spanne Zeit angesichts der Tatsache, daß es zur Eigenart der Kirche gehört, in großen Zeiträumen und weiten Horizonten zu denken und zu planen. Im Rahmen der ökumenischen Bewegung hat die Kommission für „Glauben und Kirchenverfassung" die Hauptlast zu tragen, denn im Bereich der Christologie und der Ecclesiologie (Lehre von Christus und von der Kirche) fallen die letzten Entscheidungen über das Schicksal aller Bemühungen um die Wiedervereinigung der Kirchen.
Hat die ökumenische Arbeit, die in Lund geschah, trotz aller Hemmungen und Schwierigkeiten eine Verheißung für die Zukunft? Lund ist, wie die ganze ökumenische Bewegung, nur „ein winziger Teil jenes stetigen, wenn auch weithin verborgenen Einigungswerkes, das von Christus selbst durchgeführt wird". Christi Wille, daß ein Hirte und eine Herde sei, ist Grund, Weg und Ziel aller Ökumene.