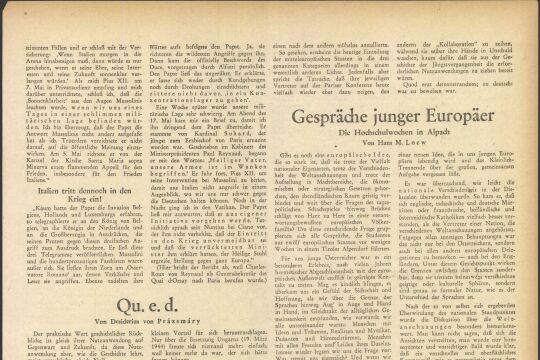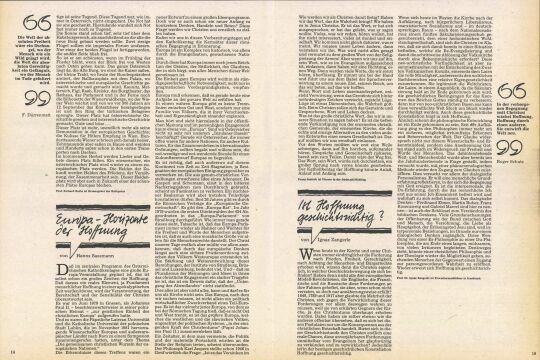Seit dem Ende des Krieges hat die Idee der europäischen Einheit in der öffentlichen Meinung unbestreitbare Fortschritte gemacht. Was noch vor 25 Jahren, zur Zeit Briands und des Erscheinens der ersten Bücher Coudenhove-Kalergis, eine Utopie schien, nimmt heute greifbare Gestalt an. Der Europäische Wirtschaftsrat ist bereits ins Dasein gerufen worden; in wenigen Monaten wird in Straßburg das Europäische Parlament zu seinem ersten Versuch zusammentreten; in allen Ländern tun sich Journalisten und Philosophen etwas zugute, den „europäischen Geist“ zu entdecken und zu analysieren, der — wie sie sagen — alle Mitglieder der künftigen Lhiion beseelt. Eine in mehreren Ländern Westeuropas durchgeführte Untersuchung zwingt uns jedoch zur Feststellung, daß sich unter der offiziellen Begeisterung noch viele Vorbehalte, Gleichgültigkeit, ja sogar böser Wille verbergen.
Es ist nicht erstaunlich, daß sich Spanien, das geographisch und ideologisch vom übrigen Europa geschieden ist, gegenüber den Einheitsprojekten in stolze Reserve hüllt. Die spanisch-amerikanische Welt, deren Mutterland es ja ist, übt auf Spanien eine viel stärkere Anziehungskraft aus. Dazu kommt noch, daß der spanischen Nation jede Zusammenarbeit mit den Nationen Europas, die mehr als zur Hälfte in ein modernes Heidentum gesunken sind, als eine Preisgabe ihrer Sendung erscheinen möchte, die sie darin erkennt, für die künftigen Generationen das Ideal des christlichen Staates rein zu bewahren.
Seit 1648 gibt es keine Einheit des christlichen Europa mehr; Spanien glaubt nicht, daß eine andere Lehre als der katholische Glaube die Einheit des Kontinents wiederherstellen könnte.
Dagegen ist Italien, das für jedes Wehen von Katholizität natürlicherweise empfänglich ist und das die Bedenken ideologischer Reinheit, die der Stolz seiner lateinischen Schwester ist, nicht kennt, durchaus bereit, in die europäische Föderation einzucreten; es befürchtet nur mit Recht die wirtschaftlichen Folgeerscheinungen der Union, denn es hat erst jüngst die Erfahrung seiner nationalen Vereinheitlichung gemacht. Das leistungsfähigere und reichere Norditalien hat immer mehr Macht und Reichtum an sich gezogen: der Süden ist ständig schwächer und ärmer geworden. Italien befürchtet, die politische Union mit den reicheren Ländern West- und Mitteleuropas könnte den Ruin seiner Wirtschaft bedeuten und es in die Lage des „Mezzogiorno“ Cala- briens und Apuliens zurückversetzen, Befürchtungen, die durchaus verständlich sind.
Weniger berechtigt erscheinen die Vorbehalte Deutschlands. Dort spricht man sehr viel vom europäischen Föderalismus. Wie jedoch ein Mitarbeiter der „Gegenwart“ erst jüngst zugegeben hat, wird im Bereich Deutschlands die europäische Idee oft nur als Mittel betrachtet. Um sich in der Welt von heute Gehör zu verschaffen und seinen Platz in Europa wieder einzunehmen, müsse sich Deutschland den gängigen Sprachschatz zu eigen machen! Reden wir also von Europa, so argumentieren die Deutschen, und wiederholen wir überall, daß wir uns in den Dienst des geeinten Europas stellen wollen. Wenn wir dann einmal in den politischen und wirtschaftlicher) Räten Europas sitzen, dann wird uns un-1 „Die Flucht nach Europa“, Februar 1949. sere Macht schon Achtung verschaffen und wir werden wiederum die führende Rolle spielen können, die uns die Natur zugewiesen hat. In solchen Gedankengängen wird der Grund gesehen, warum die deutschen Wirtschaftler, soviel sie auch über den europäischen Föderalismus reden und schreiben, sich weigern, aufrichtig das einzige einsichtige und aufbauende Experiment zu machen, das nach dem Krieg hätte versucht werden können und das als Vorbild hätte dienen können, um dann auch auf andere Schlüsselgebiete Europas ausgedehnt zu werden: dia wirtschaftliche Internationalisierung des Ruhrgebietes. Das ist eine rein sachliche Erwägung, abseits der politischen Fehlentwicklung der letzten Jahre.
Frankreich tritt wie Deutschland in Wort und Schrift sehr für die europäische Union ein, und es hat den Anschein, daß seine Staatsmänner mit größter Aufrichtigkeit sich um ihre konkrete Verwirklichung bemühen. Aber auch ihnen macht man zum Vorwurf, daß sie auf diesem Umweg für Frankreich die führende Stellung wiedergewinnen wollen, die es durch seine wirtschaftliche und militärische Schwäche verloren hat. Ich glaube nicht, daß M. Blum, M. Bidault und vor allem M. Schuman, die drei Außenminister Frankreichs in den letzten vier Jahren, solchen Macchiavelis- mus schuldig geworden sind, man muß jedoch zugeben, daß, rein sachlich gesehen, ihre Politik diesen Eindruck erweckt hat. Man muß aber auch darauf hinweisen, daß Frankreich aus seiner gesamten Geschichte niemals die Erfahrung des Föderalismus gesammelt hat: die Einheit des Landes kam dadurch zustande, daß von Paris aus die Provinzen fortschreitend absorbiert wurden. Die großen Schwierigkeiten bei der Umwandlung des Kolonialreiches in die Französische Union offenbaren eine gewisse Unfähigkeit der Franzosen für ein föderalistisches Spiel. Die gleichen, die sich darüber entrüsten, daß sich die Deutschen weigern, das Ruhrgebiet zu internationalisieren, denken gar nicht daran, daß eines Tages ein identisches Statut für die Bergwerke in Lothringen geltend gemacht werden müßte. — Deshalb wird Straßburg nur ein vorläufiger Sitz des Europäischen Rates sein, bis Wien imstande sein wird, die Aufgabe zu übernehmen, zu der es seine Geschichte so wunderbar vorbereitet zu haben scheint.
Aber denkt Wien selbst im Ernst daran, sich für diese schwierige Mittlerrolle vorzubereiten? Ist es dafür nicht zu sorglos und passiv? Verläßt es sich nicht allzusehr auf äußere Stützen — früher Deutschland und jetzt die Vereinigten Staaten? Ist es nicht zu sehr von der Vorstellung befangen, daß sein kultureller und künstlerischer Primat genüge, um ihm für ewig seine Rolle in Europa zu sichern? Dazu kommt noch, daß, um Wien als wahres politisches und kulturelles Zentrum zu ermöglichen, sich die östlichen Länder der europäischen Idee erschließen müßten. Unabhängig vom Druck, den die UdSSR gegenwärtig auf diese Länder ausüben kann, um sie von der westlichen Völkergemeinschaft fernzuhalten, beweisen alle Zeugnisse aus dem Osten, daß diese Länder sehr wenig Verlangen danach tragen, ehrlich und aufrichtig einer europäischen Föderation beizutreten. Wie lange wird es zum Beispiel brauchen, um Polen und Deutschland miteinander zu versöhnen?
Wir könnten unsere Reise durch Europa fortsetzen und wir würden sehen, daß überall dort, wo die europäische Idee lebendig ist, sie mehr oder weniger bewußt in Funktion und Dienst des nationalen Egoismus verstanden wird. .Und das ist nicht zu verwundern: die Nationen sind nicht selbstloser als die Familien oder die Individuen. Aber diese wenig ermutigende Feststellung ist nicht so tragisch, wie sie auf den ersten Blick erscheinen könnte. Die instinktive nationale Haltung ist, selbst wenn sie egoistisch ist, im Grunde doch gesund, und sie weist auf die natürlichen — wirtschaftlichen und psychologischen — Widerstände hin, die der Politiker nicht vernachlässigen darf, wenn er ein solides Gebäude aufführen will.
Um verwirklicht zu werden, muß die europäische Einheit zugleich wirtschaftliche, politische und psychologische Schwierigkeiten überwinden. Hier, in dieser Gleichzeitigkeit der . Bemühungen, liegt der Schlüssel des Problems. Die Begeisterung, die vor zwei Jahren die Ankündigung des Marshall-Planes erweckte, ist allmählich angesichts der politischen Hindernisse von Seiten des östlichen Blockes verflogen. — Dort wo keine politischen Schwierigkeiten bestehen, wie zwischen den
Benelux-Staaten oder wie zwischen Frankreich und Italien, dort erweisen sich die wirts chaftlic he n Hindernisse gegen eine Föderation bisweilen als fast unüberwindlich, jedenfalls aber als viel schwerer, als man sich dachte. (Die föderalistischen Bewegungen, die ursprünglich politische Bewegungen sind, befassen sich im allgemeinen nicht genügend mit den wirtschaftlichen Folgeerscheinungen der Unionspläne, die sie befürworten.)
Schließlich erweisen sich verschiedene christliche Friedensbewegungen und gewisse kommunistische Bewegungen, vom naiven Glauben getragen, die Schwierigkeiten seien einzig psychologischer Natur: sie meinen, mit dem Gesetz „Liebet einander!“ oder „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ seien alle Probleme gelöst. Aber so brüderlich und von gegenseitiger Sympathie getragen die internationalen Treffen von Studenten und Arbeitern auch sein mögen und so nützlich und wohltuend sich die internationalen Bauhütten der Jugend zum Wiederaufbau auch erweisen, so schaffen sie doch die wirtschaftlichen Rivalitäten nicht aus der Welt. Und so kommt es, daß ungeachtet der in den letzten drei Jahren erzielten sehr schönen Ergebnisse, auf die wir zu Beginn hingewiesen haben, die eure päische Idee nach der anfänglichen Begeiste rung heute überall ein wenig auf Skeptizis mus stößt. Da die Staatsmänner und Tech niker nicht gleichzeitig mit den sehr ernster wirtschaftlichen, politischen und psychologischen Schwierigkeiten fertig werder wollen oder können, verlieren sie den Mut Sie warten untätig darauf, daß die beiden „Großen“ über ihr Los entscheiden, oder sie berechnen klug, wie sie die Lage am besten in den Dienst ihrer rein persönlichen Interessen stellen können. Kann man nicht etwa als „europäischer Funktionär“ des Marshall-Planes oder des Straßburger Rates ebenso Karriere machen wie als Funktionär der UNO oder der UNESCO?
Ein großer Teil der Jugend der verschiedenen Länder Europas ist skeptisch geworden: es fehlt ihr an Charakter und an Mut; sie hat an der „res publica“ kein Interesse, denn sie verwechselt das politische Leben mit der Partisanenanwerbung, deren herabwürdigende Wirkungen sie genügsam erfahren hat und noch immer erfährt. Vielleicht liegt das eigentliche Versagen unserer Zeit in. der Trägheit, dieser siebenten „Hauptsünde“, die die Väter der Wüste auch „geistliche Traurigkeit" nannten. Auch unsere jungen Christen unterliegen ihr häufig. Denn leider kann diese Trägheit durchaus Zusammengehen mit großer Begeisterung für ein Studium oder auch mit unfruchtbarer apostolischer Agitation. Durch die intellektuelle Konfusion, die sich bisweilen in unseren katholischen Friedensbewegungen geltend macht, fördern diese, ohne es zu wollen, noch mehr die Mutlosigkeit: indem sie behaupten, man brauche nur ernstlich den Frieden zu wollen, um die Struktur Europas in eine neue Christenheit umzuwandeln, bereiten sie die schlimmsten Enttäuschungen vor. Könnte man denn nicht klarer unterscheiden zwischen den beiden Ebenen unserer Bemühungen?
Zunächst haben wir als Glieder der Kirche, des Leibes Christi, vor der Welt ein sichtbares und spürbares Zeugnis für Einheit und Katholizität abzulegen (die Welt kann an die Kirche nicht glauben, wenn sie diese wesentlichen „K enn- zeichen" der Kirche nicht sieht.) Und das setzt unsererseits einen wahrhaft evangelischen, bisweisen heroischen Verzicht auf unsere nationalen Vorurteile und Vorgefühle voraus: „Wer seinen Vater und seine Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert.“ Die Liebe zum Vaterland ist die Verlängerung der Liebe zur Familie: wie diese ist sie heilig; aber sie kann auch ebenso wie diese zu einem schweren Hindernis im Dienste Gottes werden, wenn sie zum Beispiel einen daran hindert, aus ganzem Herzen zu verzeihen oder jenen wohlzuwollen, die einem Übles getan haben oder einen ausländischen Flüchtling wie seinen Bruder aufzunehmen.
Dann haben wir als Glieder der menschlichen Gesellschaft die Pflicht, mit allen Menschen zusammenzuarbeiten, um eine gerechtere und friedlichere Welt aufzubauen. Im ,19. Jahrhundert haben es die Katholiken allzusehr nur den Gegnern der Kirche überlassen, für die Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit Sorge zu tragen und zu arbeiten; im 20. Jahrhundert dürfen sie es ihnen nicht allein überlassen, für die internationale Gerechtigkeit — die nur ein anderer Name für Frieden ist — zu sorgen. Der Christ muß überall zugegen s e i n„ wo an der menschlichen Gesellschaftsordnung gebaut wird. Auch das ist für ihn eine Weise, für die Kirche Zeugnis abzulegen, wenn er sich dabei auch jedes religiösen Proselytismus enthält. Um die internationale Gerechtigkeit zu verwirklichen, bedürfen wir junger Christen, die in den politischen und wirtschaftlichen Fragen Fachleute sind und über diplomatische Fähigkeiten verfügen. Das aber kann man nicht improvisieren. Die internationale Gerechtigkeit kann auf verschiedene Weise verwirklicht werden: die europäische Förderation ist nicht die einzig mögliche Formel, um diese Gerechtigkeit in Europa in die Tat umzusetzen. Was aber unbedingt notwendig ist, das ist, daß die Christen ihre ganze Intelligenz und ihren ganzen Willen für die politische und wirtschaftliche Gestaltung der Zukunft einsetzen. Es ist notwendig, daß die Christen überall aktiv bei der so schwierigen und schmerzhaften Geburt des Friedens mit-
helfen. Die Jugendtreffen sind wohl nützlich, denn sie räumen die psychologischen Schwierigkeiten zwischen den Völkern aus dem Weg, aber sie genügen nicht: wir brauchen Wirtschaftler, Diplomaten, Staatsmännner, die wirklich Fachleute sind und sich ihrer christlichen Verantwortung für die Vollendung der Welt bewußt sind. Und was Wien betrifft, so wird es seine natürliche Mittlerrolle in Europa dann wiederfinden, wenn aus ihm eine Generation junger Menschen hervorgeht, die offen sind für die Probleme des Ostens wie des Westens, die über das beste Wissen und zähe Energie verfügen und, dank ihrer psychologischen Fähigkeiten, ihrer politischen Geltung und ihres technischen Könnens, sich in der Welt von morgen durchsetzen.