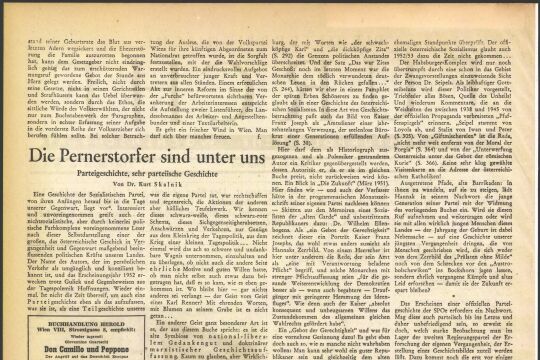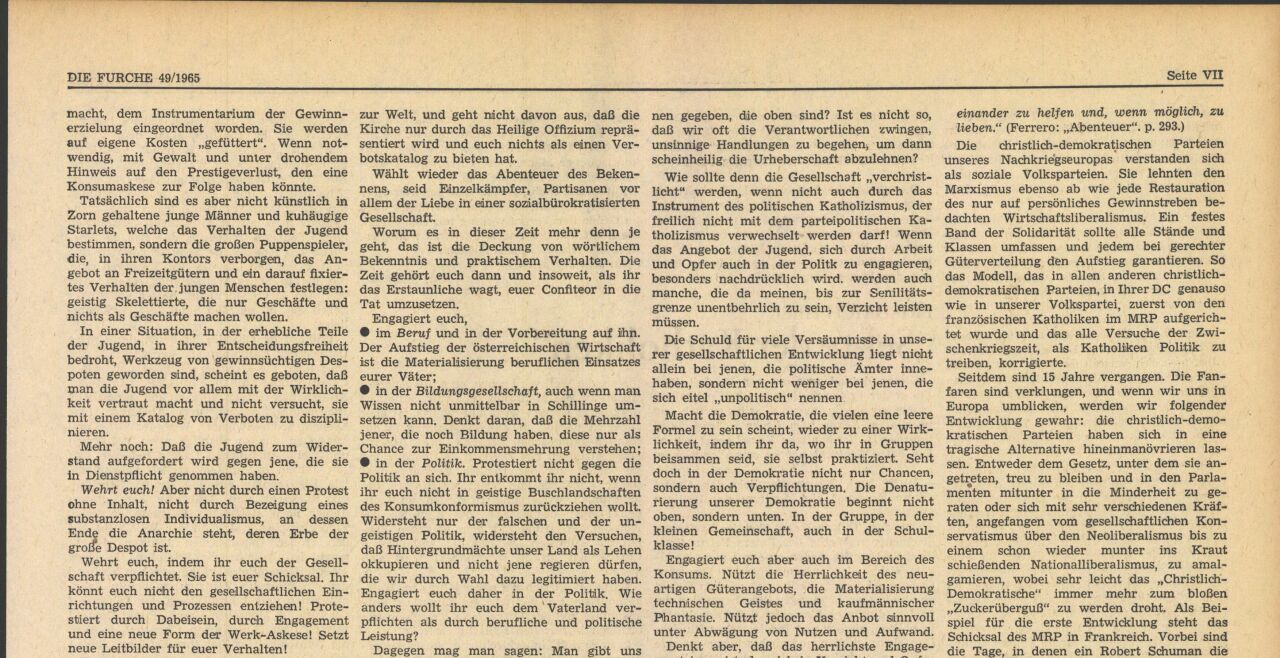
Dieser Artikel wurde am 7. Jänner 1961 veröffentlicht. Unser Chefredakteur hat die Form eines „Briefes an Amintore Fanfani“ gewählt, um Probleme der christlichen Demokratie in aller Freimütigkeit zu erörtern. Selbstverständlich fehlt in diesem Brief eines katholischen Journalisten an den damaligen italienischen Ministerpräsidenten auch das Thema „Südtirol“ nicht. Die aufgeworfenen Fragen haben in der Zwischenzeil an Aktualität nicht verloren. Im Gegenteil.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident!
Die Tage der Olympiade 1960 in Rom sind Vergangenheit. Verlassen stehen die Aschenbahnen des Foro Italico; irgendwo in ihrer Heimat betrachten vielleicht gerade jetzt um den Jahreswechsel die Olympioniken ihre wohlerworbenen Medaillen, während in der Villa Borghese, in der sich noch vor wenigen Monaten kühne Reiter auf edlen Pferden ein Rendezvous gaben, längst der Alltag eingezogen ist.
Ein anderer Kampf geht indessen weiter. Auf ihn richten sich freilich nicht die Fernsehaugen der Welt. Man müßte auch lügen, wollte man behaupten, die Massen verfolgen seine Gefechte mit angehaltenem Atem. Jene aber, denen der Alltag mit seinen Geschäften bisher ebensowenig das Denken abgewöhnen konnte, wie der Jubel und Trubel der in unseren Breiten etablierten Konsumgesellschaft nicht den Blick von den wirklichen Schicksalsfragen der Gegenwart abzulenken imstande war, wissen, wie hoch der Einsatz ist, um den es geht, wo immer in Europa vom kleinsten Gemeindeausschuß bis herauf in die nationalen Führungsgremien um die christliche Demokratie gerungen wird.
Vielleicht ist der Beginn des neuen Jahres 1961 gerade der richtige Zeitpunkt, um einmal innezuhalten und in Rückschau und Vorausblick den Standort der christlichen Demokratie zu überprüfen, ihrer Tragödie sich gewiß zu werden und ihre Zukunft abzuwägen.
Wenn ich, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, für diese politische Gewissenserforschung den Weg eines Offenen Briefes an Ihre Adresse wählte, so bitte ich Sie, sich darüber nicht allzusehr zu verwundern. Es hat dies seine guten Gründe, auf die zurückzukommen im Rahmen dieser Ausführungen gewiß noch Gelegenheit geboten sein wird. Zum Eingang nur dies: Ihre Partei führt nicht nur als einzige von allen Schwesterparteien den Namen „Christliche Demokratie“ ohne Abstrich und ohne Zusatz. Die Richtungskämpfe und inneren Auseinandersetzungen der DC, die vielen flüchtigen Beobachtern in den letzten Jahren als Symptome der Schwäche erscheinen mußten, entschlüsseln sich dem Eingeweihten gerade als ein Zeichen, daß die Grabplatte monolithischen Denkens noch nicht zugefallen ist, sondern daß hier lebendige Kräfte entgegen allen Pressionen von links und Verlockungen von rechts um den Weg der Mitte ringen, der allein der Weg christlicher Demokraten sein kann. Und noch etwas. Etwas Persönliches:
Sie haben, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, als Politiker Höhen und Tiefen kennengelernt. Wellenberge sind Ihnen ebenso vertraut wie Wellentäler. Aber noch mehr. Als Sie vor ungefähr zwei Jahren erkennen mußten, daß Ihr Konzept weder in Ihrer Partei noch in Ihrem Lande zur Stunde durchzusetzen war, da warfen Sie nicht über Nacht alle Grundsätze über Bord, machten da einen Abstrich und arrangierten sich dort mit jenem, um nur ja um jeden Preis „oben“ zu bleiben. Im Gegenteil. Mit einem jähen Entschluß begaben Sie sich aller Macht im Staat und in der Partei. Sie übten eine Tugend, die die Politiker unserer Gegenwart — nicht zuletzt jene, die sich christlich-demokratische Politiker nennen — heute vielfach vergessen haben. Daß die Macht nicht alles ist, daß ein Politiker, will er sich selber treu bleiben, in gewissen Situationen seinen Abschied nehmen muß. Sie traten zurück — und Sie kamen wieder. Stärker als zuvor. Vielleicht gerade deshalb, weil Sie nicht ängstlich an eroberten Positionen klebten, weil Politik Ihnen eben eine Aufgabe und nicht eine Futterkrippe ist. Welchen europäischen Katholiken und Politiker könnte man sich also als einen ernsteren Gesprächspartner wünschen, wenn die christliche Demokratie zur Debatte steht.
Die christliche Demokratie!
Beinahe zögert man heute schon, dieses Wort niederzuschreiben. Wie vieldeutig ist es geworden! Was den von einem neuen Tota-litarismus bedrohten Überlebenden einer großen Weltkatastrophe in vielen Ländern Europas nach 1945 und auch noch einige Jahre später als die Vision vom Neubau der Gesellschaft aus christlichem Geist fern allen überlebten Modellen der Vergangenheit erschien und sich auch in der nüchternen Tagespolitik durch eine Kette politischer Erfolge überall dort manifestierte, wo die Völker Europas frei über ihre Zukunft mit dem Stimmzettel entscheiden konnten, hat in dem an sich unausbleiblichen Abnützungsprozeß hohe Tribute entrichtet. Für die einen bald der große „Regenschirm“, unter den man sich vor drohenden Ungewittern aus allen Richtungen flüchtete, um ihn dann undankbar in die Ecke zu stellen. Für die anderen die billigste „Unfallversicherung“ gegen den Kommunismus, für die dritten bald die schnellste Steigleiter zur Macht, für die vierten der Tummelplatz ihrer sehr persönlichen Geschäfte, für die fünften, sechsten und siebenten letzten Endes der willkommene Paravent vor dem Aufmarsch jener Kräfte, die ganz anderen Leitbildern als deren der christlichen Demokratie folgen.
Als die christliche Demokratie vor eineinhalb Jahrzehnten in Europa allüberall ihre Fahnen entrollte, war sie eine junge Kraft, getragen vor allem von Katholiken, die in Beherzigung der Lehre der Geschichte alle bisherigen Modelle einer „christlichen Politik“, vor allen jene der Zwischenkriegszeit, als überholt betrachteteten. Man ging in Gedanken weit zurück. Man knüpfte an bei jenen Männern, die vor mehr als hundert Jahren in Frankreich, zunächst viel verkannt und verketzert, dann um die Zeitung „Sillon“
(„Die Furche“) — nicht umsonst wählte unser Blatt diesen Namen als Verpflichtung — im Widerstreit zur herrschenden katholischen Tagesmeinung, die noch auf dem Bündnis von Thron und Altar beharrte, die Verketzerung der großen Revolution nicht mitmachte und jenen Gedanken den Weg geebnet hat, die niemand anderer, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, als Ihr Landsmann, der Historiker Guglielmo Ferrero, klassisch formulierte:
„Der Dreiklang ,Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit' wurzelt im Evangelium. Die Freiheit ist das Recht auf Opposition, die unvermeidliche Folge der Vermenschlichung der Macht, die eine der großen Leistungen des Christentums gewesen ist Sobald die Mächtigen der Erde nicht mehr als Götter oder Wesen göttlichen Ursprungs, sondern wie alle Menschen als elende Sünder betrachtet wurden, konnten sie nicht der Pflicht entrinnen, Rechenschaft über ihre Taten abzulegen. Die Gleichheit ist die Abschaffung der Erbvorrechte; sie wurde gefordert, sobald man alle Menschen auf gleicher Weise als Gotteskinder erkannte und sah, daß ein guter Sklave mehr taugt als ein schlechter König, und Monarchie und Adel nicht Prinzipien, sondern menschliche Notbehelfe darstellen, die nach ihrem Erfolg zu beurteilen sind. Die Brüderlichkeit ist nichts als die Pflicht, einander zu helfen und, wenn möglich, zu lieben.“ (Ferrero: „Abenteuer“, p. 293.)
Die christlich-demokratischen Parteien unseres Nachkriegseuropas verstanden sich als soziale Volksparteien. Sie lehnten den Marxismus ebenso ab wie jede Restauration des nur auf persönliches Gewinnstreben bedachten Wirtschaftsliberalismus. Ein festes Band der Solidarität sollte alle Stände und Klassen umfassen und jedem bei gerechter Güterverteilung den Aufstieg garantieren. So das Modell, das in allen anderen christlich-demokratischen Parteien, in Ihrer DC genauso wie in unserer Volkspartei, zuerst von den französischen Katholiken im MRP aufgerichtet wurde und das alle Versuche der Zwischenkriegszeit, als Katholiken Politik zu treiben, korrigierte.
Seitdem sind 15 Jahre vergangen. Die Fanfaren sind verklungen, und wenn wir uns in Europa umblicken, werden wir folgender Entwicklung gewahr: die christlich-demokratischen Parteien haben sich in eine tragische Alternative hineinmanövrieren lassen. Entweder dem Gesetz, unter dem sie angetreten, treu zu bleiben und in den Parlamenten mitunter in die Minderheit zu geraten oder sich mit sehr verschiedenen Kräften, angefangen vom gesellschaftlichen Konservatismus über den Neoliberalismus bis zu einem schon wieder munter ins Kraut schießenden Nationalliberalismus, zu amal-gamieren, wobei sehr leicht das „Christlich-Demokratische“ immer mehr zum bloßen „Zuckerüberguß“ zu werden droht. Als Beispiel für die erste Entwicklung steht das Schicksal des MRP in Frankreich. Vorbei sind die Tage, in denen ein Robert Schuman die Fäden der europäischen Politik in den Händen hielt, Pierre Teitgen durch die Gaben seiner Rede fesselte. Mit Pierre Pflimlin, der als umsichtiger Hausvater heute die Stadt Straßburg verwaltet, haben sich die dem sozialen Katholizismus verpflichteten Franzosen entschlossen, gleichsam in politische Winterquartiere zu gehen. Werden sie einen neuen Frühling erleben, mitgestalten oder gar mitherbeiführen?
Die Mehrzahl der christlich-demokratischen Parteien in Europa ging jedoch einen anderen Weg. Sie wurden „bürgerlich“. Der mögliche Verlust der Mehrheit bei einer Wahl erschien und erscheint ihnen als das größere Übel als der Abbau an Substanz. Die von Amerika herüberflutende Welle der „Entideologisie-rung“ begünstigte diesen Prozeß. Nebenbei: nichts gegen eine geistige Entrümpelung, die niemandem willkommener sein kann als der Kriegsgeneration, zu der sich der Schreiber dieser Zeilen bekennt. Bei dem großen Abverkauf wurden aber auch achtlos jene Werte zu niedrigsten Preisen angeboten, die dem Haus Gediegenheit und Charakter gaben und seinen Bewohnern das Gefühl der Geborgenheit boten. An Stelle der auf einem festen weltanschaulichen Standort ruhenden Volkspartei ließ man sich zu sehr in die Rolle des Advokaten einer kleinen und verhältnismäßig mühelos zu Besitz und Wohlstand gekommenen Schicht hineinmanövrieren. Die alten Schreckbilder der Zwischenkriegszeit werden herumgereicht. Um eingebildete oder wirklich drohende sozialistische Mehrheiten zu vermeiden, sind bestimmte Kreise, deren Einfluß bis in die Führungskader der christlich-demokratischen Parteien hineinreicht, heute wiederum bereit, Kombinationen und Koalitionen mit allen und mit jedem einzugehen. Um diese potentiellen Bundesgenossen ja nicht zu vergrämen, wagt man mitunter nicht mehr, ein eigenes Gesicht zu zeigen. Und wer zum Beispiel in unserem Land schüchtern erinnert, daß niemand anderer als der als Stammvater der christlichen Demokratie in Österreich gerne gefeierte Dr. Karl Lueger das Wort vom „christlichen Sozialismus“ prägte und mit ihm den Satz: „Ich war immer der Meinung, daß das, was im öffentlichen Interesse gelegen ist, auch von öffentlichen Organen verwaltet werden soll“, wird über Nacht schon zu einem halben Bolschewiken gestempelt.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich bemerke ein feines Lächeln um Ihren Mund. Ich weiß es wohl zu deuten. Ist es doch gut bekannt, daß wohlwollende „Parteifreunde“ mitunter belieben, Sie als „weißen Kommunisten“ vor den Augen eines ängstlichen Bürgertums zu disqualifizieren und auch manche Autoritäten kopfscheu machen. Das Fatale ist nur, daß dies alles — ich spreche jetzt zunächst von den Ländern nördlich der Alpen — sich angesichts eines Sozialismus vollzieht, der den Abschied der christlichen Demokratie vom Konzept einer sozialen Volkspartei ausnützt und nach Sprengung des marxistischen Rahmens einer Klassenpartei alten Stils als „neue Volkspartei“ in die politische Arena tritt.
Ich weiß, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, daß südlich der Alpen das Bild anders ist: Hier stehen Sie einer mächtigen KP und einer mit dieser durch eine jahrelange Kampfgemeinschaft verbundenen sozialistischen Klassenpartei alten Schemas gegenüber. Auf der anderen Seite haben Sie eine virulente Rechte, die weit bis in die Reihen der DC sich vorgearbeitet hat. Das Ringen ist hart. Allein die Kräfte der christlichen Demokratie sind hier noch mehr als ein Aushängeschild. Sie haben in Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, einen Führer gefunden, der die Zukunft der DC nicht in einer „Rechtsfront“ sieht, die gegen eine „Linksfront“ anzutreten hat, der sich weigert, in eine bürgerliche Maginot-Linie — wie fragwürdig sind alle Maginot-Linien im 20. Jahrhundert geworden — einzurücken, dem das Wort „keine Experimente“ nicht der politischen Weisheit letzter Schluß ist. Sie wollen den Bewegungskrieg. Wenn Sie, durch herbe persönliche Erfahrungen belehrt, heute vorsichtig Zug um Zug setzen zu jener einzig möglichen Lösung, die Italien morgen aus dem Rückfall in reaktionäre Bahnen und übermorgen aus der Überwältigung durch die Kräfte der extremen Linken befreien kann, so fechten Sie gleichzeitig die große Schlacht für die Selbstbefreiung der christlichen Demokratie in vielen Ländern Europas, die stattfinden muß, sollen nicht andere Kräfte die Ernte einbringen, die unter Blut und Schweiß gesät worden ist. Wie recht hatte doch der obenzitierte Ferrero, den ich noch einmal bemühen darf:
„Eine der schwersten Verirrungen der menschlichen Trägheit ist die Ansicht, daß man die Ordnung der Welt aufrechterhält, indem man sie bewahrt, wie sie ist, man erhält sie nur aufrecht, wenn man sie beständig neu aufbaut.“ („Wiederaufbau“, p. 367.)
Eine lebendige, von starken geistigen Impulsen beseelte christliche Demokratie ist imstande, unsere Ordnung des freien, nach Gottes Ebenbild geschaffenen Menschen in der technischen Zivilisation neu zu konstituieren. Den sich christlich-demokratisch nennenden liberal-konservativen Parteien unserer Gegenwart wird man nicht so optimistische Horoskope ausstellen dürfen.
Dieser Brief geht zu Ende. Ein katholischer Journalist hat ihn an einen gegenwärtig in höchster Verantwortung stehenden Politiker geschrieben. Er kommt aus Österreich und er geht nach Italien. Gerade deshalb kann er nicht geschlossen werden, ohne auf jenes Problem noch zu sprechen zu kommen, das wie eine eiternde Wunde Gift in die Beziehungen unserer Staaten und Völker hineinträgt. Sie wissen genau, von welchem Problem ich spreche. In Ihrem Staatsverband leben Menschen, die mit ihren Stammesgenossen in Österreich durch Jahrhunderte gemeinsamer Geschichte und dasselbe Volkstum verbunden sind. Was sie von Ihrer Regierung verlangen und wozu sie vertrags-und gefühlsmäßig unser aller Unterstützung haben, ist Gerechtigkeit und Großzügigkeit. Jene Großzügigkeit, die der nationalistische Kleinbürger aller Staaten nicht zugestehen will, die zu gewähren aber Rom — das Rom der Pax Romana — wohl imstande ist. Ich bin mir voll bewußt, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, daß diese „kleine Frage“ innig mit der „großen Frage“ verknüpft ist, ob und wie sehr Sie sich in der Zukunft politisch freispielen können. Es wäre pharisäisch, zu verleugnen, daß auch nördlich des Brenners, wenn auch nicht — noch nicht — in solcher Schärfe, die Probleme ähnlich sind. Dennoch: sprengen wir den Teufelskreis, in den eine Renaissance des europäischen Nationalismus uns alle zu ziehen droht. Schaffen wir in einem kleinen Raum eine Ordnung, die den Ideen, unter denen wir als Christen und Demokraten in der Politik angetreten sind, gerecht wird. Im Norden stehen Katholiken wie im Süden. Sollen unsere Gegner höhnen: „Seht, wie sie sich lieben“? Die Zeit ist vorgerückt. Es ist spät geworden, um hier im Herzen Europas einen Krankheits- und Krisenherd zu heilen. Aber noch nicht zu spät. Freilich, verstreicht auch dieses Jahr 1961 ungenützt, dann kann leicht der Nationalismus späte Triumphe feiern. Kein Trost, daß sie kurz sein würden. Denn früher oder später mag dann jene „Nationalitätenordnung“ angeboten werden, mit der der Osten schon in manchem Wetterwinkel unseres Kontinents „Ruhe“ und „Ordnung“ geschaffen hat. Eine Ruhe und Ordnung des Friedhofs.
Die christliche Demokratie! Eine Erinnerung politischer Veteranen der vierziger Jahre? Eine Hülle mit sehr verschiedenem Inhalt? Eine Hoffnung? Fassen Sie es, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, nicht als billige Schmeichelei auf, wenn dieser Brief mit der Feststellung schließt, daß die Antwort auf diese Fragen innig verknüpft ist mit Ihrer Person und mit den Intentionen, die Sie und das um Aldo Moro gescharte Team zukunftsoffener Männer der christlichen Demokratie zu geben imstande sind.
Ein Grund mehr, Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, zu allem, was dieses Jahr an Größe der Verantwortung mit sich bringt, die Kraft und den Segen dessen zu wünschen, in dessen Dienst wir alle dienen.
Ihr sehr ergebener
Kurt Skalnik