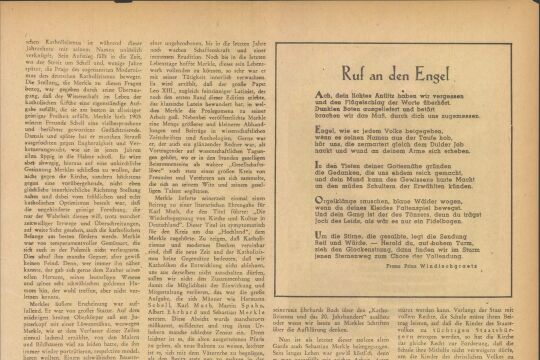Von der Öffentlichkeit erst jetzt lebhaft diskutiert, ist eine Erscheinung in Österreich aufgetreten, die den davon betroffenen Eltern, Bürgermeistern und allmählich auch den Politikern Sorgen bereitet: der Mangel an Lehrern. Hunderte von Dienstposten (Wien ausgenommen) sind unbesetzt, Klassen müssen zusammengezogen, Schulen vorübergehend oder ganz geschlossen werden; die im Dienst stehenden Kollegen müssen die Arbeit der fehlenden durch Mehrleistungen übernehmen.
Dabei ist keine wesentliche Besserung abzusehen. Im Gegenteil: Die ansteigende Geburtenrate bringt in allen Ländern, selbst in Wien, steigende Schülerzahlen. Das Gesetz verlangt die Herabsetzung der Klas-senschülerzahlen auf 40 bzw. 36. Außerdem soll im Jahr 1966 das neunte Schuljahr durchgeführt werden, wozu gleichfalls hunderte Lehrer zusätzlich erforderlich sind. Dies alles, obwohl heute schon die Schulbehörden kaum noch die Möglichkeit haben, für länger andauernde Krankheitsfälle oder Urlaube einen Ersatz zu stellen.
Sorgen auch anderswo
Der Mangel an Lehrpersonen ist eine Sorge, mit der heute fast alle europäischen Staaten und vor allem auch die Vereinigten Staaten zu tun haben. Dort sieht man sich ja bereits allen Ernstes nach einem technischen Ersatz für den Lehrer um; derartige Versuche, vor denen uns in Europa heute noch ein wenig graut, sind bereits in das Stadium ernsthaften Erwägens getreten. Gerade in der von der Konjunktur erfaßten Wirtsohaftswunderwelt prägt sich der Mangel an Pädagogen besonders aus. Die Bundesrepublik Deutschland stellt bereits Hausfrauen als Hilfskräfte ein, aber die skandinavischen Länder und die Schweiz sind nicht viel besser daran. Italien hat Lehrer genug, und Österreich hatte sie bis vor zehn Jahren auch. Und in der wirtschaftlich labilen Ersten Republik gab es hunderte stellenlose Junglehrer in allen Bundesländern.
Unterdessen haben sich die Verhältnisse grundlegend geändert. Man arbeitet heute nicht „um jeden Preis“. Der einzelne hat es nicht notwendig, einen Arbeitsplatz zu erringen, die Wirtschaft kommt zu ihm ins Haus. Sie bietet „beste Bedingungen“, „Dauerstellung“, ein „vorzügliches Betriebsklima“, „ausgezeichnete Aufstiegsmöglichkeiten bei selbständigem Wirkungsbereich“ und selbstverständlich die Fünftagewoche. Und was bietet der Staat dem jungen Lehrer? Mäßige, in den Anfangsjahren sogar schlechte Bezahlung, geringe Aufstiegschancen, wenig Raum für initiative Tätigkeit in einer bis ins letzte verwalteten Schule, Sechstagewoche und ständige Kontrolle der Arbeit durch Kinder, Eltern, Schulleiter, Fachreferenten aller Grade. Die Sicherheit eines pragmatischen Dienstverhältnisses, einstmals die Sehnsucht Hunderttausender, wiegt in der Zeit der dynamischen Rente nicht viel. Wer das nicht sieht, dem ist der realistische Blick abhanden gekommen.
Es ist ohne Einschränkung richtig: Das Wirtschaftswunder ist an den Angehörigen der Sozialberufe, und dazu gehören die Lehrer, fast spurlos vorübergegangen. Und die Folgen stellen sich prompt ein. Nun sollte man meinen, daß sich die so rar gewordene Arbeitskraft des Lehrers eben teurer verkaufen ließe! Ja, man müßte meinen, daß die gewerkschaftlichen Vertretungen mit wuchtigen Schlägen in diese Kerbe hieben. Statt dessen wird um Herabsetzung der Lehrverpflichtung gefeilscht, ein im Zeichen des Mangels an Lehrern schier unverständliches und unpopuläres Beginnen. Der Lehrer, glaube ich, will nicht weniger arbeiten, er will einen seiner Tätigkeit entsprechenden gerechten Lohn!
Sind finanzielle Gründe allein verantwortlich für den geringen Zuzug zum Lehrberuf? Keineswegs; das hieße, das Problem zu einfach sehen.
Das Gespenst des „Inspektors“
Junge Menschen, in besonderer Weise junge Männer, wollen sich im
Beruf initiativ entfalten können. Sie sind gerne bereit, auch eine schwere Bürde an Verantwortung zu übernehmen. Sie wollen in ihrem Beruf aber auch vorwärts kommen. Wie steht es damit im Lehrberuf? Es dürfte nicht zu verwegen sein, darauf hinzuweisen, daß man in Österreich mit 40 und weniger Jahren wohl Minister werden kann, aber kaum Direktor einer Volksschule in einer mittleren Stadt. Nichts gegen junge tüchtige Minister, und nichts gegen ältere, erfahrene Schuldirektoren, aber zu denken gibt die Sache doch! Und
welche Initiative vermag der Lehrer zu entwickeln, besonders der gute Lehrer, der die Nöte der Jugend sieht und der auch Wege der Abhilfe wüßte? Stößt er nicht überall mitten hinein in das Dilemma der Pädagogik?
Der Leser möge mir ersparen, an den gängigen Witz zu erinnern, wer sich im Schulalltag vor wem furch-
tet. Mir jedenfalls graut in einer Demokratie schon vor dem Straßen-bahnkontrollor — und erst recht vor dem Schulinspektor. Schon der Name könnte gräßlicher nicht sein. Es gibt heute Beratungsstellen für Kinder und solche für Eltern; warum sollte dem Schulinspektor eine solche beratende und helfende Funktion in bezug auf den Lehrer schlecht anstehen? Warum sollte ihm der Berufskollege nicht ohne Furcht und Beklemmung Zeugnis von seiner Arbeit geben? Warum sollte der im Dorf Einsame nicht von ihm Ermutigung, Hilfe und Förderung erfahren dürfen? Das setzt freilich voraus, daß dem Lehrer im Vertreter der Schulaufsicht ein aufgeschlossener und politisch
toleranter Mensch und ein Könner seines Metiers begegnet.
Lehrermangel ist und wird immer mehr ein Mangel an männlichen Lehrkräften. Je mehr aber der Lehrstand verweiblicht, um so mehr wird er auch „entmännlicht“, das heißt, er verliert an Attraktivität für den Mann, der in zunehmendem Maß nicht nur den aussichtsreicheren, sondern auch den „männlicheren“, technischen Berufen zustrebt Daran ist nicht die Frau schuld, ohne deren Mitarbeit nicht nur in Österreich, sondern in den meisten Staaten Europas und Amerikas das Schulwesen längst zusammengebrochen wäre. Es ist ein psychologisches, wenn man will, ein soziologisches Phänomen. Dazu trägt bei, daß die Frau gerade für den Unterricht der Kleinen nicht selten mehr Einfühlungsgabe, mehr Geduld, mehr Mütterlichkeit und oft auch mehr Talent mitbringt als der aus härterem Holz geschnitzte Mann. Er steigt also aus dieser Konkurrenz nicht immer vorteilhaft heraus. Als Ergebnis aber bleibt, daß der Volksschullehrer als Mann ausstirbt, weil dieser Beruf infolge seines geringen sozialen Ansehens kein erstrebenswertes Ziel mehr darstellt. Die Jungen ergreifen viel eher den Beruf des Lehrers an höheren Schulen — die Stipendien ermöglichen ihm dies —, oder sie legen zumindest die Hauptschulprüfung ab. In beiden Fällen sind sie davor geschützt, in die entlegensten Orte geschickt zu werden.
Kulturversteppung
Die vielen abgelegenen Dörfer mit ihren ein- oder zweiklassigen Schulen, die sind ja das Problem. Lehrermangel bedeutet doch in Österreich und anderswo auch vor allem einen Mangel an Landlehrern. Die großen und mittleren Städte sind leicht zu versorgen. Wien hat auch heute noch einen beträchtlichen Überschuß an — vor allem weiblichen — Junglehrern. Aber nur wenige können sich entschließen, etwa in Niederösterreich oder in der Steiermark Dienst zu tun. i
Der Gründe dafür sind viele: nicht nur die oft mehr als bescheidenen Wohnmögldchkeiten in den Dörfern oder der für den geringen Anfangsgehalt unverhältnismäßig hohe Aufwand an Lebenskosten. Sie sind auch rem menschlicher Art. Der junge Lehrer — mehr noch die junge Lehrerin — sind im Dorf fremd, und sie bleiben es meist auch. Es fehlt ihnen jegliche Kontaktmöglichkeit. Was immer sie tun, es kann ihnen falsch ausgelegt werden. Schließen sie sich den Gleichaltrigen im Dorf an, wird dies von der älteren Generation mit scheelen Augen betrachtet; sondern sie sich ab, gelten sie als hochfahrend und überheblich. Was wunder, wenn sie dem Dorf entfliehen! Es kann ihnen zuwenig bieten, in den seltensten Fällen einen Partner fürs Leben.
Der Zug zur Stadt, in der der Mensch in der Anonymität versinken kann, ist eine weltweite Erscheinung. Die großen Städte fließen über, ihre Einwohnerzahlen steigen von Jahr zu Jahr sprunghaft an — die Dörfer sind nur zur Urlaubszeit interessant oder als Wochenend-refugium für den Städter: Man erholt sich im Dorf, aber man lebt nicht darin. Jedenfalls bleibt die Tatsache bestehen, daß manche junge Volksschullehrer eher ihren Beruf wechseln oder sich zum Weiterstudium an der Universität entschließen, bevor sie einen Posten an einer Dorfschule annehmen. Zu den Dörfern ohne Arzt, ohne Gendarmerie, ohne Priester kommen immer mehr Dörfer ohne Schule hinzu: Die Kultursteppe breitet sich aus — mitten im Herzen Europas.
Heute berührt der Lehrermangel nur die davon betroffenen Gemeinden und Eltern; er Ist noch ein kulturelles Randproblem. Fallen hinkünftig auch nur die Brösel vom Festmahl der Konjunktur für den Lehrer ab, und läßt man ihn weiterhin bei den Dienstboten essen, dann werden immer mehr begabte junge Menschen diesen gewiß schönen Beruf meiden, der — und das soll nicht vergessen werden — mit jedem Tag schwieriger und aufreibender wird.
,^ T irmsTtMtitmsrKt
aii)aiHi*'“MM*,*,*,M“““
Wenn die großartigen außen- und innenpolitischen Erfolge, welche die gemeinsame Sfaatsführung der beiden Großparteien in den vergangenen 20 Jahren erzielen konnte, im Bewußtsein der Öffentlichkeit zu verblassen drohen, wenn eindrucksvolle Gesetzesbeschlüsse dieses Parlamentes, wie sie auch in dieser Session ihren erfreulichen Abschluß finden konnten, trotzdem in der Bewertung der Öffentlichkeit von einem gewissen Unbehagen überdeckt werden, dann müssen sich die verantwortlichen Politiker mit den psychologischen Ursachen dieser Symptome auseinandersetzen.
Nach wie vor glaube ich, daß allein die Zusammenarbeit der Sozialpartner und Parteien unserem Volk und Staat jene Stabilität und beruhigende Sicherheit garantiert, ohne die Osterreich nicht wäre, was es heute ist, und deren Verlust uns über die Schwelle einer ungewissen Zukunft führen würde. Sicherlich müssen wir uns mit dem Gedanken vertraut machen, daß Zusammenarbeit nicht unbedingt für alle Zeit gleichbedeutend mit dem Begriff der Koalition sein muß, sondern eine Entwicklung dankbar ist, die, wie in England, ein demokratisches Wechselspiel zwischen Regierung und Opposition ermöglicht. Aber solche Entwicklungen brauchen ihre Zeit, müssen vorbereitet werden; keinesfalls dürfen politische Kurzschlußhandlungen unabsehbare und nicht gewollte Folgen auslösen, weil wir keinen Sprung ins dunkle Ungewisse machen wollen, sondern auch bei freiem parlamentarischem Wechselspiel das feste politische Fundament des gemeinsamen Staatsbewußtseins und der Einhaltung unserer demokratischen Spielregeln gewährleistet bleiben muß.
Die große Koalition verhindert in Osterreich bisher das Aufflammen eines Rechts- oder Linksextremismus; jede geplante Oberleitung zu neuen Formen der Regierung sollte daher sorgfältig darauf bedacht sein, daß durch sie solchen Extremismen nicht plötzlich unverdiente Chancen blühen.
(NR.-Präs. Dr. Alfrad Malela: „DI* Spielregeln das Parlamentarismus nicht gefährden.“)
Die Presse
Die Verbandsübung selbst, die weniger kostet als eine Parade auf dem Ring und die doch ein höchst nützliches Training für das Zusammenspiel der Kräfte bedeutet, ist ja nicht das Kernproblem, mit dem sich die Truppe auseinanderzusetzen hat. Es geht vor allem darum, der seit langem schwelenden ernsten Krise im ganzen Organismus der Streitkräfte ein Ende zu setzen. Sie betrifft das Fiasko der Umgliederung des Bundesheeres ab 1963 in Ausbildungs- und Einsatzverbände, die bis auf wenige Sonderfälle kaum noch Tuchfühlung miteinander haben. Das Ziel der Neuordnung, nämlich kampfstarke Druckknopfeinheiten (lies: Alarmkonfin-gente) jederzeit sofort zur Hand zu haben, wurde nicht erreicht. Wohl aber hat sich durch die Zweiteilung des Heeres der Mangel an Kaderpersonal so sehr verschärft, daß jetzt die Gruppenbefehlshaber von Minister Prader die Annullierung jener Reorganisation forderten. Mit anderen Worten — die Generale wünschen die Rückkehr zum System vor 1963.
Auf dem Papier mochte das damalige Konzept der Organisafions-abteilung des Ministeriums, das im übrigen wohlweislich eine Reduzierung der Zahl der Brigaden von neun auf nur fünf vorsah, bestechend gewirkt haben. Man entschied sich aber doch für sieben Brigaden, statuierte sogar drei weitere Stäbe für Reservebrigaden im Kommando der Ausbildungsregimenter, und realisierte den Plan, der sich in der österreichischen Praxis mit Neunmonatssoldaten und dem krassen Defizit an Unterführern aller Dienstgrade als eklatanter Fehlschlag erwies.
Am Vorabend der sehr lebhafter Parlamenfsdebatfe wollten auch die Journalisten in der Sendung „Was halten Sie davon?“ zeigen, daß sie es mit Lebhaftigkeit und Demagogie noch mit jedem Parlamentarier aufnehmen können. Das Thema war die kranke Koalition. Die Koalition ist durch die Diskussion der Chefredakteure nicht gesünder geworden, wohl
aber ha diese Fernsehüberfragung gezeigt, daß an der Chefredakteurdiskussion selbst etwas krank ist. Das war keine Diskussion mehr, das war zumindest bei den Hauptakteuren ein gegenseitiges Belauern, der Versuch, den Gesprächspartner hineinzulegen und festzunageln, da wurde mit einem Stimmaufwand an Rhetorik, Gestik und Mimik eine Show abgeführt. Gewiß mag manches an der Leitung des Gespräches liegen, aber vielleicht sollten die Teilnehmer dieser Journalistendiskussion sich einmal unbeleuchtet von Scheinwerfern und un-belauscht von Kameras und Mikrophonen zusammensetzen, um zu versuchen, diese Sendung, die doch einmal zu den beliebtesten gezählt hat, so zu reformieren, da sie nicht eines Tages abgesetzt wird. Es könnte sein, daß manche auf diesen Zeitpunkt nur warten.
Das Unbehagen über die Kaolition, aus der man nicht ausbrechen, mit der man aber nicht mehr viel weiter kommen kann, manifestiert sich in einer gesteigerten Aggressivität des politischen Kampfstils und im Aufreißen längst vernarbt geglaubter Wunden. Die Volkspartei malt in letzter Zeit das Schreckgespenst der Volksfront an die Wand, weil der neue Bundespräsident, Franz Jonas, mit den Stimmen der Kommunisten gewählt wurde und die Kommunisfische Partei auf ihrem letzten Parteitag freundliche Friedensfühler nach den Sozialisten ausgestreckt hat. Die Sozialisten, unter Führung Vizekanzler Pittermanns dagegen gefallen sich darin, von der Einheitsfront aller demokratischen, republikanischen und antifaschistischen Österreicher zu sprechen, die Mißstimmung gegen ehemalige Nationalsozialisten auszunützen sowie das Gespenst einer reaktionären antimarxistischen Einheitsfront zu beschwören. Beide Frontbildungen haben einen Realitätskern: die Sozialisten haben ihre absolut feindliche Haltung gegenüber den Kommunisten tatsächlich revidiert, und im bürgerlichen Lager gibt es wirklich Kräfte, die von einer Ausschaltung der Sozialisten im Vorkriegsstil träumen.
Trotzdem sind die beschworenen Gefahren im Grunde Ablenkungs- und Werbemanöver, die an den realen Problemen der österreichischen Innenpolitik vorbeiführen. Allerdings kann auch eine systematisch betriebene politische Legendenbildung die Legende zur vollendeten Wirklichkeit werden lassen, wenn sie sich des Bewußtseins der Massen zu bemächtigen versteht. Um so notwendiger scheint es, daß die besonnenen Kräfte in beiden Lagern einsehen, daß der Weg der Aufrührung der Vergangenheit und der Züchtung einer erbitterten Kampfstimmung gefährliche Folgen haben kann und man allzu leicht zum Opfer der aus taktischen Gründen eingeleiteten Entwicklung wird. Die schwierige Aufgabe, die sich den beiden großen Parteien stellt, besteht darin, eine echte Einigkeit über wesentliche gesellschaftliche Probleme herzustellen.
(Norbert Leser: „Zwischen Volksfront und Bürgerblock.*)
Die Wiener würden eher auf ihre Slaatsoper selbst als auf das Intrigenspiel um dieses Institut verzichten. Wer immer auch Direktor der Oper ist oder sein wird, er steht im Kreuzfeuer der Meinungen.
Dürfen wir also heute schon beurteilen, was heute in Wien geschieht, ohne jemandem unrecht zu tun? Wir haben uns in Wien umgesehen, haben mit allen, die wissen müssen, was heute „gespielt“ wird, intensive Gespräche führen können. Das zusammengefaßte Resultat ist überraschend. Es lautet kurz und bündig: Wiens Oper ist im Begriff, sich wesentlich zu wandeln, so entscheidend, wie das seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall war. Die Wandlung entspricht einer Forderung unserer Zeit und mißachtet nicht die Bedingungen, unter denen heute auf internationaler Ebene Oper geboten werden sollte.
Wer Wien und seine Opernfans kennt, weiß, daß solche Wandlung nicht ohne Schmerzen und starke Widersprüche vor sich geht, da immerhin nichts weniger als die Mutation vom puren Sfarsängerireffen zum regiebefonten, geistig verbindlichen Musikfheater statthat. Wiens Oper soll von einer kulinarischen Instifufion zur „moralischen Anstalt“ im Sinne Schillers wachsen. Dieses Unterfangen, das an anderem Ort längst vollzogen ist, mutet gerade hier wie eine Revolution an. Es ist auch noch nicht sicher, ob sie gelingt. Daß sie aber versucht wird — und eben nicht von einem
neuen „künstlerischen“ Direktor _,
ist das bemerkenswerteste aller Opernzeichen von heute.
(W. E. v. Lewinski: „Wiens moralische Anstalt.“)