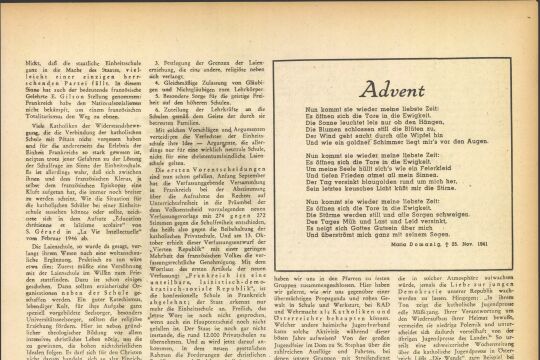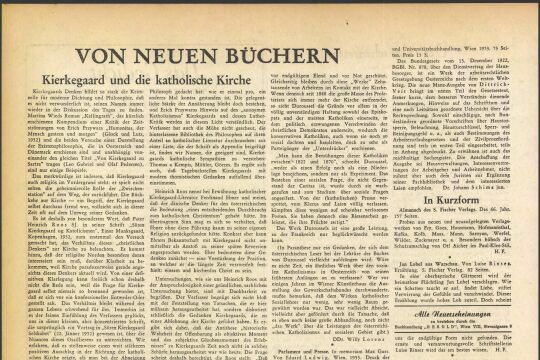GESCHLOSSENER BETRIEB — GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT. „Demokratie isi Diskussion": sie bewährt sich, wenn sie sich an heiße Eisen wagt. Es ist ein Verdienst des Sozialpoli- schen Instituts Wien (Leitung: Prof. A. M. Knoll), eines der heißesten Eisen zum Thema einer Aussprache und Konfrontation gewählt zu haben: die Frage des „closed shop". Der „geschlossene Betrieb" hot sich etwa in Amerika und, auf andere Weise, in den linkstotalitären Staaten durchgesetzt. Alle Arbeitnehmer in ihm sind gezwungen, der Gewerkschaft beizufreten. Nun ist es eine ernste und weitreichende Frage, die gerade aufgeklärte Freunde und Mitarbeiter der Gewerkschaftsbewegung immer wieder sich stellen müssen: Führt nicht der „geschlossene Betrieb" auf die Dauer zur „geschlossenen Gesellschaft", wie Popper, Hajek und andere aus Wien stammende Staats- und Wirtschaftswissenschafter die totalitäre Gesellschaft in ihren modernen Formen genannt haben? Der Generalsekretär des Oesterreichischen Gewerkschaffsbundes, Fritz K I e n n e r, ein Mann, den man nicht einfach in die Garnitur der Apparatschiks und- Nur-Funktionäre einreihen kann, der an sich sehr selbständig zu denken weiß, vertrat in dieser Aussprache den Standpunkt der Gewerkschaftsführung: im Atomzeitalter sollen die Gewerkschaften eine starke „Ordnungsmacht" bilden; die organisierten Arbeitnehmer sehen es als unmoralisch an, wenn ein Arbeitnehmer die von den Gewerkschaften erkämpften Vorteile in Anspruch nimmt, ohne selbst dafür einzufreien. Ihm entgegnete Nationalrat Dr. Kummer: die Gewerkschaften verdanken ihre innere Kraft und wahre politische Stärke ihrer Organisation auf der Grundlage der Freiwilligkeit. Bei einer Zwangsmitgliedschaft durch den „geschlossenen Betrieb" beendet der Gewerkschaftsbund seine Funktion als freiwillige Organisation. Die Freiheit ist unteilbar. Unorganisierte zu gewinnen, gelingt in Freiheit nur durch die Ueberzeugungskraff von Taten. — Hier erhebt sich, und das muß im Anschluß an Kummers Argumentation allen Beteiligten (und unser ganzes Volk ist mitbeteiligt an der hier eingeschlagenen Entwicklung) ein Anliegen ernster Sorge sein, die Frage: Kann die Demokratie auf die Dauer gesichert und ausgebaut werden, wenn sie selbst den Willen zur Freiheit, zur freien Entscheidung lähmt? Man klagt heute, gerade in sozialistischen Kreisen, soviel über mangelnde politische Impulse in der Jungarbeiterschaft — alle gutgemeinten Fackelzüge werden da nicht viel echtes Leben schaffen —, wenn man nämlich der Jugend und dem einzelnen die Möglichkeit freier politischer Entscheidung nimmt. Die Gehäuse, welche die Freiheit „Sichern"' sollen, werden immer größer, immer enger. So daß der Freiheitsliebende in die Versuchung gerät, aus ihnen auszubrechen. Zumal dann, wenn ihm alle Entschlüsse und Entscheidungen schon vorweg abgenommen wetden, von oben her. Ein patronisierender Paternalismus von Gewerkschaften wird sich auf die Dauer nicht weniger lähmend als ein Meltau auf alles echte politische und gesellschaftliche Leben legen, als ein Paternalismus von Unternehmern und anderen Herren. Das müssen sich leidenschaftslos gerade ;ene Gewerkschaftsführer verstellen, die ein achtes politisches Anliegen haben. Und die ihre” Gewerkschaft nicht nur als All-Versiche- ungsanstalfen und Machtbau verstehen.
SCHWEIGEMARSCH FÜR EINE KLEINE EISENBAHN. Eine Demonstration ohne historische Parallelen erlebte in diesen Tagen Salzburg. Da kamen eines Tages aus dem Salzkammergut mit der scherzhaft „feuriger Elias' genannten Lokalbahn Scharen von Menschen in die Landeshauptstadt. Einheimische gesellten sich dazu. Bald formierte sich ein Demonsfrationszug, der in einem Schweigemarsch zur Landesregierung zog. Was war geschehen? Die Demonstranten wollten nichts anderes als eine Revision des Beschlusses über die Einstellung derselben kleinen Eisenbähn, mit der sie soeben in die Stadt gekommen waren. Damit bekommt der bisher im Opereftenstil des „Weißen Rössels" geführte Streit um die Salzkammergutlokalbahn einen neuen, ernsteren Akzent. Mögen wirtschaftliche Motive der betroffenen Anrainer auch zunächst den Ansporn für die spontane Aktion ausgelösf und wenig erfreuliche politische Elemente später auch versucht haben, ins Spiel zu kommen, so sehen wir doch heute in der Aktion „Rettet den .feurigen Elias'" ein ernsteres Anliegen. Seif Jahr und Tag sind wir alle Zeugen, wie die graue Walze eines öden Zivilisationsklischees über unser Land hinweggeht. Da wird durch den Bau einer „Betonschlagader" ein'e Landschaft gefährdet, dort durch eine „Erschließung” ein Ort kaputt gemacht. Ausverkauf in österreichischer Individualität ist ein gut gehendes Geschäft. Das beginnt bei den Speisekarten (Tomaten, Sahne, Pfifferlinge, Hackbraten und „Strammer Max") und endet bei der Uniform unseres Bundesheeres. Man will nicht mehr sich selber — und des Schlimmste: die Verantwortlichen spüren es meistens nicht, daß sie uns an Kolorit und Eigenart ärmer machen. Das Salzkammergutlokalbähnchen, mag es auch nicht unbedingt den technischen Anforderungen der Mitte des 20. Jahrhunderts entsprechen, ist beliebt bei Einheimischen und Fremden. Die Freunde des „feurigen Elias”
haben Tatkraft und Entschlossenheit an den Tag gelegt. Möge man es anderswo ebenso halfen, wann immer ein liebgewordenes Stück der Heimat der Ungeistigkeif des Materialismus unserer zweiten Gründerzeit zum Opfer gebracht werden soll.
EIN PRINZ AUS DÄNEMARK Der Doyen unter den regierenden Fürsten, König Haakon VII., ist, fünfundachtzigjährig, im 52. Jahr seiner Regierung gestorben. In. seinem Lande ist er immer beliebt gewesen, obwohl er, von Hause aus dänischer Prinz aus der in Kopenhagen regierenden Linie des Hauses Oldenburg, erst 1905 von den Norwegern, nach der Trennung von Schweden, zum König ausersehen wurde. Prinz Carl, wie er damals hieß, wünschte zunächst eine Volksabstimmung. Fritjof Nansen versuchte ihn damals zu überreden, nicht zu warfen, sondern schnurstracks nach Norwegen zu kommen, wo er von dem Ministerpräsidenten
Christian Michelsen und dem Freiheitskämpfer und Dichter Björnstierne Björnson erwartet werde. „Mein lieber Nansen", sagte der Prinz, und diese strenge Rechtlichkeit ist kennzeichnend für ihn, „das kannst du jetzt ganz gut sagen. Aber in zwanzig Jahren ist Michelsen tot, Björnson wird gestorben sein und dann können die Norweger kommen und sagen: ,Was zum Teufel machst du in unserem Landl'" r v Volksabstimmung brachte dem Dänenprinz-n eine überwältigende Mehrheit, und niemand hat die Wahl bereut. Seine große Zeit erlebte der König im zweiten Weltkrieg nach der Besetzung des Landes durch die deutsche Wehrmacht. Er lehnte die Kapitulation ab und weigerte sich, damals schon ein alter Herr, abzureisen, ehe nicht alle seine Minister reisefertig waren. Mit Not entkam er noch und kehrte am 7. Juni 1945,
begeistert begrüßt, wieder. Während des Krieges beteiligte er sich von England aus am Krieg gegen die Besatzung und in Norwegen erschienen an den Felswänden immer wieder Aufschriften mit einem großen H VII., dem Symbol des Widerstandes. Das ist alles um so bemerkenswerter, als die norwegische Bevölkerung in ihrer Mehrheit aus radikalen Demokraten besteht. Die Regierung wird von den Sozialisten erstellt, die sich, obschon grundsätzlich republikanisch eingestellt, in der Verehrung der Person des greisen Monarchen von keiner anderen politischen Richtung überbieten lassen. „Die Mehrzahl der Norweger sind Arbeiter, Kleinbauern und kleine Leute", erklärte ein sozialistischer Minister, „und kümmern sich den Teufel um aristokratische Würden. Haakon ist einer von uns, ein ,Selfmademan' unter den Königen, der sich in einem fremden Land aus eigener Kraft als oberster Führer des Volkes verdient gemacht hat. Wir respektieren ihn, weil wir ihn gerne haben ”
Nachrichten". Neben den Tageszeitungen gibt es noch zahlreiche Blätter, die zwei-, drei- und viermal in der Woche herauskommen, so daß es 76 katholische Zeitungen — den Begriff hier auf politische Zeitungen beschränkt — im Schweizerlande gibt. Ein sprechendes Beispiel bietet hier der Oesterreich benachbarte Kanton St. Gallen: Neben der zweimal täglich erscheinenden „O s t s c h w e i z“ gibt es noch vier katholische Tageszeitungen und dazu mehrere täglich erscheinende katholische Blätter bei einer Einwohnerzahl von rund 325.000, von denen rund 60 Prozent katholisch sind.
In einer neuesten Aufstellung werden die 485 politischen Zeitungen in der ganzen Schweiz folgendermaßen angeführt: 76 katholische, 89 freisinnig-demokratische, 8 Bauernpartei, 4 Landesring der Unabhängigen, 32 bürgerliche (ohne Parteizugehörigkeit), 20 sozialdemokratische, 2 kommunistische, 164 neutrale, 24 amtliche, 65 Anzeiger (Inseratenblätter). Die katholischen Blätter sind Organe der konservativ-christlichsozialen Richtung oder stehen ihr auf alle Fälle nahe.
Aus dieser Tabelle ist leicht ersichtlich, daß den neutralen Zeitungen zahlenmäßig ein großes Gewicht zukommt. Wenn man dazu die Auflageziffern betrachtet, verstärkt sich diese Vorrangstellung der Neutralen noch. Der in Zürich erscheinende neutrale „Tages-Anzeiger" kann mit einer beglaubigten Auflage von über 140.000 die weitaus höchste Verbreitungsziffer melden. Daneben wirken die Auflagezahlen katholischer Blätter, die zwischen 1500 und 25.000 liegen, zwar bescheiden. Man muß dabei aber wissen, daß von den fast 500 schweizerischen Zeitungen weniger als 40 Auflagen von über 15.000 aufweisen und der weitaus größte Teil zu der Kategorie unter 10.000 gehört.
Es sei in diesem Zusammenhang noch eine Tatsache erwähnt. Dem konservativen Zentralorgan für die deutschsprachige Schweiz, „Vaterland“, das im alten katholischen Vorort Luzern erscheint, bereiten genau wie der im 53. Jahrgang stehenden katholischen Tageszeitung von Zürich, „NeueZürcherNach- richte n", zwei neutrale Tageszeitungen der beiden Städte verbreitungsmäßig die größten Schwierigkeiten. In dieser Hinsicht unterscheiden sich also die Verhältnisse in der Hauptstadt der katholischen Stammlande und in der größten Diasporastadt (sie weist die höchste Katholikenzahl aller Schweizer Städte auf) nicht.
Daß bei dieser Vielfalt die finanziellen Anforderungen für den einzelnen Zeitungsverleger ganz besonders groß sind, ist selbstverständlich. Der Steigemfrg der Auf läge '!mtt ihre nwesenri- liehen Auswirkungen auf das Inseratengeschäft sind von vornherein relativ enge Grenzen gesetzt. Bei einer Katholikenzahl von zwei Millionen in der ganzen Schweiz steht aber an sich immer noch und wohl für die absehbare Zukunft ein sehr ausgedehntes Wirkungsfeld für die Ausbreitung und das Wachsen der einzelnen katholischen Blätter zur Verfügung. Wie langsam und mühselig hierVjeder spürbare Fortschritt herausgearbeitet werden muß, wissen die Verantwortlichen, die im Zeitungswesen stehen, in allen anderen Ländern wohl ebensogut wie wir in der Schweiz.
Es mag stichhaltige Gründe geben, die für eine gewisse stärkere Konzentration der verfügbaren Kräfte und Mittel da oder dort sprechen. Sicher kann auch das Regionalblattsystem i n bestimmten Verhältnissen für alle Beteiligten von Vorteil jtnd Nutzen sein. Es wäre aber, meines Erachtens, verfehlt, in der Schweiz ganz allgemein die Forderung nach einem Zusammenschluß zu einigen großen Zeitungen oder gar einem einzigen repräsentativen katholischen Blatt aufzustellen. Abgesehen davon, daß solche Bestrebungen auf eidgenössischem Boden kaum Aussicht auf Erfolg haben, würden sie vor allem die eben skizzierte Struktur mißachten und natürlich Gewachsenes gewaltsam durch ein künstliches Gebilde ersetzen. Ein solcher radikaler Zentralismus steht in scharfem Gegensatz gerade zum katholischen Denken in der Schweiz. Dem Föderalismus, dieser Pflege des Kleineren und diesem Verständnis für eine möglichst weitgehend erhaltene Eigenständigkeit der Teile, entspricht auch eine im Aufbau des katholischen Pressewesens vernünftige Aufgliederung und eine Anpassung an die verschiedenen Verhältnisse. Anderseits darf diese Vielfalt allerdings nicht zur bequemen Ausrede werden, im Ringen um die den Verhältnissen und Möglichkeiten angemessene Erfüllung der verantwortungsvollen Aufgabe in der Gestaltung der einzelnen katholischen Zeitung satt und selbstzufrieden zu werden.
Wir dürfen jedoch die Augen nicht davor verschließen, daß diese Zersplitterung auch ihre sehr bedauerlichen Nachteile hat. Das Verlangen, in der Vielfalt schweizerischer Zeitungen auch katholischerseits mit großen, repräsentativen Blättern in möglichst wirkungsvolle
Erscheinung zu treten, ist sehr wohl verständlich. Bei den gerade auf unserer Seite nicht unbeschränkt verfügbaren Mitteln kann man sich meiner Meinung nach der Einsicht nicht verschließen, daß das nur auf dem Wege vermehrter Zusammenarbeit erreicht werden kann. Auf dem weiten Feld der kulturellen Sendung und Aufgabe des Katholizismus wäre das, wie mir scheint, besonders wünschbar und am ehesten zu verwirklichen. Es ließe sich bestimmt ein Weg finden, um für die größeren katholischen Schweizer Zeitungen eines Sprachgebietes eine gemeinsame, bedeutende und entwicklungsfähige Kulturbeilage zu schaffen. Sie müßte nicht einfach an einer einzigen Stelle gestaltet werden. Es würde schweizerischer Eigenart besser entsprechen, wenn sie beispielsweise in einem Turnus von je einigen Monaten von den hierfür zusammengeschlossenen Zeitungen redigiert würde. Es braucht für das reibungslose Funktionieren einer solchen Zusammenarbeit zweifellos sehr genaue und ins Einzelne gehende Abmachungen. Eine solche Verbindung und regelmäßige Aussprache zwischen den Redaktionen und Verlagen der führenden katholischen Blätter der einzelnen Kantone, zwischen alten katholischen Stammlanden und der Diaspora, wäre an sich schon ein bedeutungsvoller Gewinn, der sehr fruchtbare' Wirkungen auszuüben vermöchte. Die einzelnen Zeitungen aber könnten durch eine solche Kulturbeilage viel gewinnen. Welche verlockende Möglichkeiten eröffnen sich da für die Heranziehung prominenter Mitarbeiter, für die sorgfältige Illustration, für das Aufspüren der brennenden Fragen im Sendungsauftrag der Kirche zum Wirken in der Welt, im systematischen und befriedigenden Behandeln ganzer Themenkreise f Was so oft am Mangel finanzieller Mittel oder an genügender Zeit für das Planen und Vorbereiten scheitert, könnte mit einer solchen wohlüberlegten, rationellen Zusammenarbeit mehrerer größerer Blätter für eine regelmäßige kulturelle Beilage wirksamer und erfolgversprechender an die Hand genommen werden. Hier sehe ich eine verheißungsvolle und dankbare Aufgabe der katholischen Presse in der Schweiz. Ein derartiges Beginnen und Gelingen würde neue, in jeder Hinsicht lohnende Entwicklungen anbahnen. Die großen Pausen, die bei diesem Turnus für die einzelne verantwortliche Redaktion zwischen eigenem Geben und Empfangen naturgemäß eintreten, könnten
überdies zu schöpferischem Atemholen werden — und was wäre in der Hetze unserer Tage gerade für den Zeitungsmann heilsamer und notwendiger als das!
Alles Einseitige ist katholischem Denken fremd. Wie sehr könnte eine solche großzügige Beilage ehrlicher Zusammenarbeit im ganzen katholischen Volk mithelfen, den Blick zu weiten und das offene, liebevolle Gespräch zu fördern. Wie schade. und schädlich, wenn wir nur die zu bejahende, durchaus erfreuliche Vielfalt in der Eidgenossenschaft sehen, ohne auch nach dem notwendigen Ausdruck unserer Einheit auf der Grundlage der katholischen Weltanschauung zu streben. Ich glaube, wenn es uns gelingt, im Mitgestalten der katholischen Presse in der Schweiz getragen zu sein vom Bekenntnis zu unserem wesenseigenen Föderalismus und getrieben zu werden vom Drang nach einer sichtbar werdenden Gemeinschaft, sind wir auf dem rechten Weg.