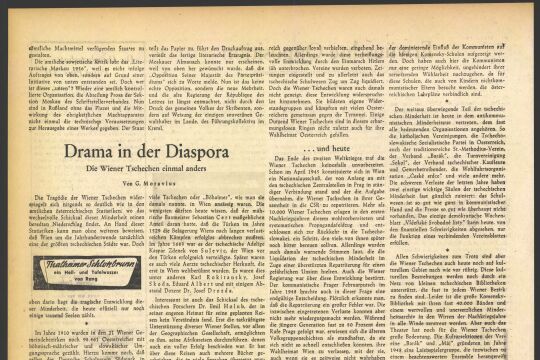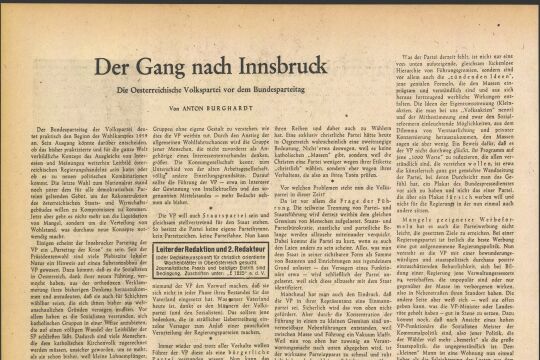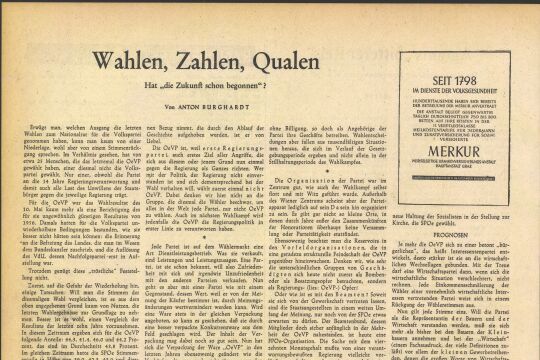Das Innenleben einer Partei
Politikern und Parolen begegnet der Staatsbürger pausenlos. Es gehört zum Wesen einer Partei, sich ununterbrochen mitzuteilen — auf der Plakatwand, in den Zeitungen, im Rundfunk, im Fernsehen, auf Versammlungen, in den gesetzgebenden Körperschaften, oft nur durch bloße Präsenz führender Persönlichkeiten. Was die Parteien nach außen hin tun und lassen, erfährt man oft bis zum Überdruß, doch wie's drinnen aussieht, geht, so scheint's, niemand was an. Das will niemand wissen.
Politikern und Parolen begegnet der Staatsbürger pausenlos. Es gehört zum Wesen einer Partei, sich ununterbrochen mitzuteilen — auf der Plakatwand, in den Zeitungen, im Rundfunk, im Fernsehen, auf Versammlungen, in den gesetzgebenden Körperschaften, oft nur durch bloße Präsenz führender Persönlichkeiten. Was die Parteien nach außen hin tun und lassen, erfährt man oft bis zum Überdruß, doch wie's drinnen aussieht, geht, so scheint's, niemand was an. Das will niemand wissen.
O doch. Wer innerhalb einer Partei aufsteigt, wessen Stern im Sinken ist, wer gegen wen wann wo warum intrigiert haben könnte, das ist ausführlich zu lesen und zu hören. Skandale und Zerreißproben füllen die Titelseiten und Magazinsendungen.
Kreiskys Gerangel um die nächste und übernächste Regierungsumbildung, die Vakanz im ÖVP-General-sekretariat mit ihren Wiener Präludien und das Nachfolge-Peter-Spiel brauchten an mangelnder Publizität nicht zu leiden.
„Die Kärntnerstraße“ und „die Löwelstraße“ werden da zu unheimlich drohenden Begriffen, und der gutmütigste Wähler hält sich an den Marquis von Halifax, daß die beste Partei nichts als eine Art von Verschwörung gegen den Rest der Nation ist.
Aber wie eine demokratische Partei wirklich lebt, wie ihre organisatorische Anatomie aussieht, ihre rechtliche Grundlage, ihr oft heiß umfeh-detes Statut, bleibt im Dunklen. Der Alltag interessiert nicht. Obwohl er es sollte. Macht und Einfluß werden gerade im Alltag ausgeübt, ohne daß die vielzitierte Transparenz vorhanden wäre. (Das gilt natürlich auch für die Einrichtungen der Sozialpartner.)
Eine Partei funktioniert scheinbar wie eine Firma. Die Zentrale und ihre Filialen haben den mehr oder minder festen Aufbau von Kanzleien. Es gibt je nach Größe der Dienststelle Schreibstuben, Vorzimmerbeamte, Archive, Telephonzentralen, Referate, Sekretariate und Chefsekretariate. Es gibt die „Bosse“ und die Unterläufer, es gibt Kaffeeküchen, Tratschereien, Verärgerungen, Enttäuschungen, Eifersüchteleien, Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern und Eheschließungen.
Es gibt eine „Firmenleitung“, eine Finanzabteilung, eine Buchhaltung, ein Lohnbüro, einen Vertreterstab (die Funktionäre), Aktionäre (die Mitglieder) und Kunden (die Wähler).
Und doch gibt es gravierende Unterschiede. Bernhard Görg, leitender Angestellter großer Wirtschaftsunternehmen und kurzzeitig Insider der ÖVP-Bundesparteileitung und des Wirtschaftsbundes, weist in dem von Alois Mock herausgegebenen Buch „Die Zukunft der Volkspartei“ darauf hin, daß die Wähler aus den verschiedenensoziographischen
Schichten kommen und die unterschiedlichsten Ziele haben, deren Durchsetzung sie sich von der gewählten Partei erhoffen. Die Parteiführung wird daher mit äußersten Interessensgegensätzen konfrontiert, wie sie in Industrie und Wirtschaft innerhalb eines Unternehmens nie vorkommen können. Dieser Effekt wirkt bei einer Volkspartei naturgemäß stärker als bei einer homogenen Klassenpartei, die es aber von den Kommunisten abgesehen bald nicht mehr gibt.
Noch drastischer ist ein weiteres Beispiel. Das Spitzenmanagement eines Unternehmens entscheidet frei nicht nur über die einzusetzenden Mittel und Methoden, sondern auch über die Aufnahme neuer Mitarbeiter und die Versetzung oder den Abbau jener, die sich als unfähig erwiesen haben, an der Realisierung des angestrebten Zieles mitzuwirken. Auch ohne tatsächliche Veränderungen hat dieses Pouvoir des Managements eine stark leistungsfördernde Wirkung. In demokratischen Parteien gilt diese Möglichkeit bis zu einem gewissen Grad für die Parteiangestellten, nicht aber für die „politischen“ Mitarbeiter, das heißt, für die mittlere Funktionärsschicht. Die Mittelgarnitur besetzt die Spitzengarnitur, und nur letztere wird nach Mißerfolgen ersetzt — von der unveränderten Mittelgarnitur.
Man kann es aber auch weniger pessimistisch betrachten, als es hier in sehr freier Wiedergabe der Görg-schen Gedanken erfolgt ist: „Was eine Partei groß macht, sind nicht in erster Linie die großen Männer, sondern das Format der unzähligen Mittelmäßigen“. Ortega y Gasset hat diesen Satz nicht von der Partei, sondern von der Nation gesagt, aber er läßt trotzdem der obigen These zumindest die theoretische Chance einer positiven Interpretation — zumal jeder einzelne Funktionär aus der Mittelgarnitur ja wieder die auswechselbare Spitze seiner Unterorganisation bildet.
Nun aber zur dritten und wie mir scheint wichtigsten Unterscheidung: Ein Unternehmen kann sein Produkt den veränderten Marktverhältnissen anpassen, weil dieses wertfrei ist. Ob beispielsweise einfarbige, geblümte oder gestreifte Damenblusen erzeugt werden, kann sich ausschließlich an der Nachfrage orientieren, eine Partei muß in ihrer Politik konstante Wertvorstellungen realisieren.
Noch etwas: Die Partei muß nicht nur Kunden (Wähler) motivieren, sondern auch ihre eigenen Mitarbeiter. Die großen österreichischen Parteien stützen sich auf zigtausende kleine Funktionäre, denen für ihren Fleiß kein anderer Preis winkt als allenfalls ein Erfolgserlebnis bei einem Wahlgang. Es gibt für sie keine Bezahlung, sie arbeiten um ihr eigenes Geld in der Freizeit und ohne Hoffnung (zumeist sogar ohne Ambition) auf ein einträgliches politisches Amt. Sie wollen nur ernst genommen werden, haben aber oft ihre beruflichen, lokalen und persönlichen Gartenzäune. Infolge ihres maximalen Identifizierungsgrades mit der Partei gehören sie bei ausbleibenden Wahlsiegen zu den schärfsten Kritikern. Ohne den Einsatz dieser Frauen und Männer könnte aber keine demokratische Partei existieren. In den angebrochenen Zeiten der Vorwahlen steigt ihre Bedeutung, denn eigentlich sind nur sie in der Lage, aus persönlicher Kenntnis die Kandidaten zu beurteilen.
Eine deutlich andere Rolle spielen die sogenannten mittleren Funktionäre, die oft schon ein bezahltes politisches Amt ausüben oder anstreben. Hier gleich ein Wort, das der Volksmeinung widerspricht: Politiker, die ihr Mandat ernst nehmen und verantwortungsbewußt ausfüllen, sind in Österreich nicht überbezahlt Das gilt für den Bürgermeister einer Kleingemeinde genauso wie für den Abgeordneten und den Minister. Man muß den Einsatz dieser Menschen — gleich welcher Couleur — aus der Nähe kennengelernt haben, um abschätzen zu können, welchen Verzicht an Lebensqualität sie auf sich nehmen (sie tuns allerdings freiwillig).
Aber zurück zur Mittelschicht. Sie hat etwas zu verlieren: Ansehen, Einfluß, auch Geld. Die ideelle Identifikation der „kleinen“ Mitarbeiter mit dem Parteischicksal wird bei ihnen zur ganz persönlichen Verkettung. Sie haben Feinde, Konkurrenten, Verbündete, versuchen, das Fußvolk auf sich und die Partei zu vergattern und murren möglichst nur dort, wo es nicht auffällt.
Zum organisatorischen Rückgrat der Parteien zählen aber nicht nur die Funktionäre, sondern auch die Sekretariate, die es je nach der Stärke der einzelnen Parteien und ihrer Gliederungen bis zu verschiedenen Ebenen herab gibt und mit hauptamtlichen Angestellten besetzt sind.
Für das Verhältnis der Apparate zu den zentralen Parteileitungen (ÖVP-Kärntnerstraße, SPÖ-Löwelstraße) gilt, was Kurt Tucholsky vor mehr als einem halben Jahrhundert geschrieben hat: „Die Zentrale weiß alles besser. Die Zentrale hat die Ubersicht und den Glauben an die Übersicht... In der Zentrale sitzen nicht die Klugen, sondern die Schlauen ... Der Zentrale fällt nichts ein, und die anderen müssen es ausführen.“ Diese Haltung gegenüber der Zentrale wird so lange eingenommen, bis man selbst durch Avancement dort sitzt und zu regieren beginnt: „als durchaus gotteingesetzte Zentrale, voll tiefer Verachtung für die einfachen Männer der Praxis.“ Das hört sich nicht nur bei Tucholsky so an: „Lieber Freund, Sie können das von Ihrem Einzelposten nicht so beurteilen! Wir in der Zentrale ...“
Das Zentral- oder Generalsekretariat ist jedoch tatsächlich das Nervenzentrum für das Innenleben einer Partei. Hier wird jene Politik geplant, die darin besteht, Gott so zu dienen, daß man den Teufel nicht verärgert, wie Thomas Füller schon im 17. Jahrhundert wußte.
Hier entstehen — je nach Parteiführer mit mehr oder weniger privaten Beratern — die wichtigsten Erklärungen der Partei, „ghost writers“ schreiben Reden und Artikel, Kampagnen werden entworfen und durchgeführt, Plakate, Postwurfsendungen, Broschüren in Auftrag gegeben, die Massenmedien über einen Pressedienst versorgt, Parteitage und Wahlreisen organisiert. (Nur die Parlamentsklubs und die seit neuestem zur Schulung eingerichteten Institute und Akademien werken als zentrale Parteistellen grundsätzlich extern.)
Was frappieren mag: Die Referenten und Redakteure in den Parteizentralen genießen ein Höchstmaß an kreativer und kritischer Freiheit. Es bedarf daher eines ebensolchen Höchstmaßes an Vertrauen zwischen der obersten Parteiführung und ihren Angestellten. Ein Abteilungssystem wie in einem Ministerium, in dem die angestellten Mitarbeiter bleiben, während die politischen Chefs wechseln, ist nicht nur wegen der unausbleiblichen positiven und negativen Kompetenzkonflikte zum Scheitern verurteilt.
Parteiobmänner und Zentral- bzw. Generalsekretäre müssen die Möglichkeit haben, für' jede einzelne Aktion die ihnen geeignet erscheinenden Mitarbeiter heranzuziehen, wie der Pianist für verschiedene Akkorde verschiedene Tasten anschlägt, was eine gewisse psychologische Virtuosität voraussetzt, die ein politischer Manager eben besitzen muß. Daß die Routinearbeiten in den einzelnen Referaten mitlaufen müssen, versteht sich von selbst.
Ein Problem für sich, das einer ausführlicheren Erörterung wert wäre, ist das Innenverhältnis zwischen der Partei und ihrer Presse.
Weniger an der Spitze als im Mittelbau fehlt oft das Verständnis, daß plumpe Einseitigkeit und die sogenannte Hofberichterstattung keine Existenzberechtigung und erst recht keine wirtschaftliche Existenzmöglichkeit für eine Zeitung bieten.
Heute verstehen sich die von den Parteien herausgegebenen Blätter als engagierte Gesinnungspresse — nicht mehr als Organe der Partei, sondern für die Partei (Walter Raming). Sie sehen — und schreiben — die Dinge nicht mehr im schwarz-weißen Zwischenkriegsstil. Die maßgeblichen Partei Journalisten haben sich auf der Basis ihrer offen deklarierten Gesinnung einen Freiheitsraum geschaffen, um den sie von manchen Kollegen anderer Presseerzeugnisse beneidet werden könnten. „Der Herausgeber braucht und kann nicht mit allem einverstanden sein, was .seine' Zeitung schreibt“, stellt Hermann Czekal fordernd fest, denn „eine Zeitung darf nicht zum Marionettentheater werden, und wer sich Jouralisten ,hält', muß wissen, daß sie im Durchschnitt zwar etwas teurer sind als Stenotypistinnen, aber für Diktate selten so geeignet wie diese.“
Peter Klar meint ebenso kaltschnäuzig: „Man muß sich auch als Partei Journalist von solchen Funktionären freispielen, die vom Parteijournalisten alles verlangen, aber ihm eines verbieten: daß er Journalist ist.“
'S war immer so, 's war immer so. „Das berühmt-berüchtigte Kaiserwort ,Ja derf's denn das?' haben wir im Lauf der vergangenen Jahrzehnte auch von sozialistischen Funktionären und Mandataren zu hören bekommen“, blickte Kurt Wessely im Zorn zurück.
Wenn Politiker einmal daneben greifen, und auch Politiker greifen manchmal daneben, soll „wenigstens“ in der Parteizeitung nichts darüber stehen, die ja nie die auflagenstärkste Zeitung am Platz ist. Vertuschen läßt sich also die Sache nicht, aber die Parteizeitung soll ein Stück ihrer Glaubwürdigkeit verlieren. Dafür hätte „wenigstens“ die Parteizeitung abzudrucken, was lediglich die persönliche Eitelkeit befriedigt, aber nicht den geringsten Nachrichtenwert aufweist und zahlenden Abonnenten nicht zugemutet werden kann.
Kritische Äußerungen über Mißstände — eine wichtige Aufgabe der modernen Massenmedien“ — sollen überhaupt unterdrückt werden. Uber die Gastronomie soll man nichts schreiben, weil die Wirte zur Handelskammer bzw. die Kellner zur Arbeiterkammer gehören, und die Polizei ist tabu, weil die Personalvertretung eine sozialistische bzw. eine ÖAAB-Fraktion aufweist. Der Hinweis auf schwarz qualmende Postautobusse läßt zwar das zuständige Ministerium kalt, schockt aber die Postgewerkschaft quer durch die Fraktionen.
Der Parteijournalist weiß, was Funktionäre wünschen, aber in diesem einzigen Fall ist er beinahe wie der liebe Gott: Er weiß es wirklich besser.
Wenn das Innenleben der österreichischen Parteien eine unbewältigte Gegenwart hat: Hier ist sie.
Vorabdruck aus „couleur“