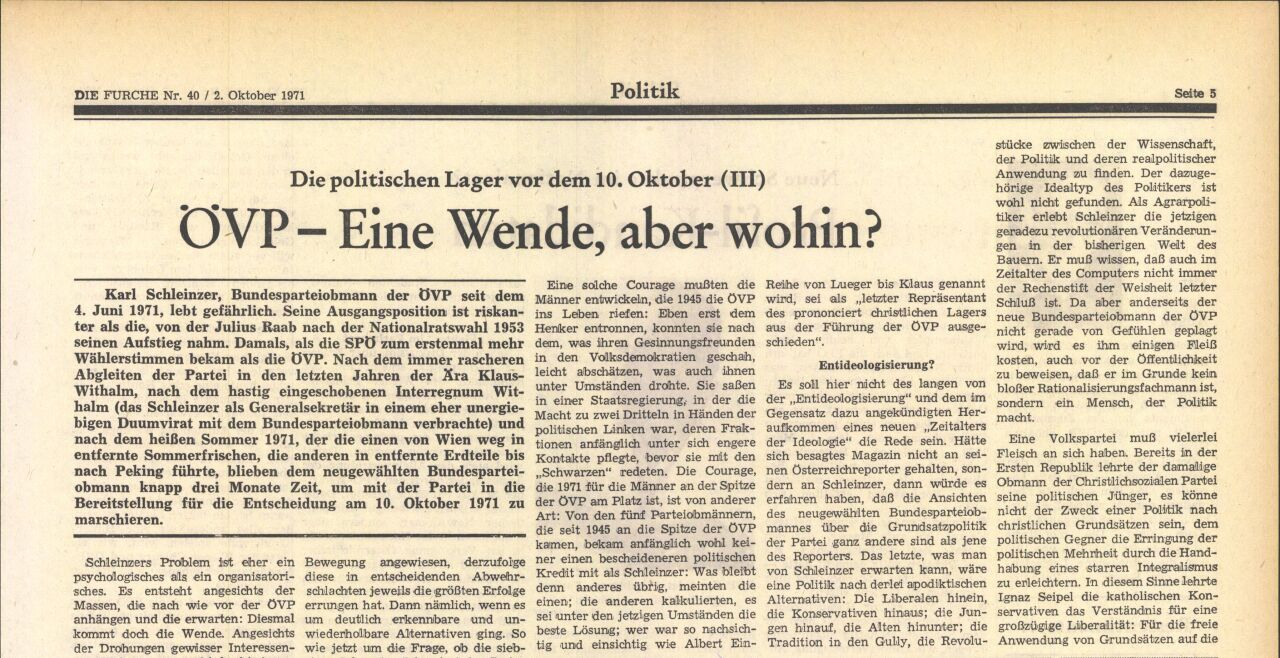
ÖVP - Eine Wende, aber wohin?
Karl Schleinzer, Bundesparteiobmann der ÖVP seit dem 4. Juni 1971, lebt gefährlich. Seine Ausgangsposition ist riskanter als die, von der Julius Raab nach der Nationalratswahl 1953 seinen Aufstieg nahm. Damals, als die SPÖ zum erstenmal mehr Wählerstimmen bekam als die ÖVP. Nach dem immer rascheren Abgleiten der Partei in den letzten Jahren der Ära Klaus- Withalm, nach dem hastig eingeschobenen Interregnum Wit- halm (das Schleinzer als Generalsekretär in einem eher unergiebigen Duumvirat mit dem Bundesparteiobmann verbrachte) und nach dem heißen Sommer 1971, der die einen von Wien weg in entfernte Sommerfrischen, die anderen in entfernte Erdteile bis nach Peking führte, blieben dem neugewählten Bundesparteiobmann knapp drei Monate Zeit, um mit der Partei in die Bereitstellung für die Entscheidung am 10. Oktober 1971 zu marschieren.
Karl Schleinzer, Bundesparteiobmann der ÖVP seit dem 4. Juni 1971, lebt gefährlich. Seine Ausgangsposition ist riskanter als die, von der Julius Raab nach der Nationalratswahl 1953 seinen Aufstieg nahm. Damals, als die SPÖ zum erstenmal mehr Wählerstimmen bekam als die ÖVP. Nach dem immer rascheren Abgleiten der Partei in den letzten Jahren der Ära Klaus- Withalm, nach dem hastig eingeschobenen Interregnum Wit- halm (das Schleinzer als Generalsekretär in einem eher unergiebigen Duumvirat mit dem Bundesparteiobmann verbrachte) und nach dem heißen Sommer 1971, der die einen von Wien weg in entfernte Sommerfrischen, die anderen in entfernte Erdteile bis nach Peking führte, blieben dem neugewählten Bundesparteiobmann knapp drei Monate Zeit, um mit der Partei in die Bereitstellung für die Entscheidung am 10. Oktober 1971 zu marschieren.
Schleinzers Problem ist eher ein psychologisches als ein organisatorisches. Es entsteht angesichts der Massen, die nach wie vor der ÖVP anhängen und die erwarten: Diesmal kommt doch die Wende. Angesichts der Drohungen gewisser Interessenten: Wehe wenn es schief geht. Angesichts geheimer Wünsche gewerbsmäßiger Kurbier : Wenn er stolpert, kommen unsere Leute, die richtigen. Und angesichts des Geraunes der Schwätzer: Was kann aus Kärnten schon Gutes kommen; wo so viel Freisinn und nationale Gesinnung zu Hause ist; so viel Eigenwilligkeit dieser Grenzländer;.und wie kommt einer auf den Platz, dem einmal die CVer Figl und Raab ein historisches Gepräge gaben, einer, der so wie sein Amtsvorgänger im Landwirtschaftsministerium, Eduard Hartmann, nicht einmal auf das Ehrenband einer Verbindung aus gewesen ist?
Zu früh und zu spät kam Schleinzer zum Handeln. Zu spät, weil er erst nach den für die ÖVP besonders fatalen Jahren 1969 bis 1971 an die Spitze kam. Zu früh, weil jetzt die Partei vor die Entscheidung gestellt ist, bevor sie ihr künftiges Grundsatzprogramm erfassen und das unzulängliche Bundesparteiorganisationsstatut reformieren konnte. Schleinzers in letzter Stunde unternommener Versuch, wenigstens gewisse organisatorische Verbesserungen anzubringen, wurde unterbunden.
Nichts ist in der Politik erfolgreicher als der Erfolg. Die Erfolge, die SPÖ und FPÖ in jüngster Zeit gegen eine auf dem Rückzug befindliche ÖVP errungen haben, waren zugleich höchstpersönliche Erfolge der Parteiführer Kreisky und Peter. Im Gegensatz zu dem relativ hohen Stand auf den diesbezüglichen Erfolgskonten der Gegner hat das neueröffnete Konto des Bundesparteiobmannes der ÖVP eine eher reduzierte Stammeinlage. Diese Tatsache bedeutet aber in der jetzigen Lage der ÖVP nicht nur ein Risiko, sondern auch die Chance. Denn der nochmalige Erfolg der Wahlparole: „Laßt Kreisky und sein Team arbeiten“ hängt in hohem Maße von der unverminderten Zugkraft eines Mannes, der Zugslokomotive Kreisky ab. Auch die FPÖ weiß, daß an ihr nichts besser ist als ihr Bundesparteiobmann und daher schickt sie Peter allein als Schrittmacher auf die Tour. Schleinzer ist im Jahre 1971, so wie Raab im Jahre 1953, nach einer Wahlniederlage der ÖVP auf jene Steherqualität seiner Bewegung angewiesen, derzufolge diese in entscheidenden Abwehrschlachten jeweils die größten Erfolge errungen hat. Dann nämlich, wenn es um deutlich erkennbare und unwiederholbare Alternativen ging. So wie jetzt um die Frage, ob die siebziger Jahre das Jahrzehnt des Sozialismus werden oder nicht.
Nichts ist kostspieliger als ein Anfang. Dieser Satz findet sich in den Schriften eines deutschen Philosophen, der ein ganzes Buch über den Willen zur Macht schrieb. Im Sommer 1971 hieß es für die ÖVP: primum viverve deinde philosophari. Für sie ging es nicht um die Macht im Staate, die sie erst den anderen in einem Wahlkampf streitig machen muß Es ging und geht um den Willen, die Krise zu bestehen und die Wende zu erreichen.
In einer Zeit, in der man in den USA bereits wieder die unlängst in die Wüste geschickten erfahrenen Wirtschaftsführer zurückholt, damit sie wenigstens die ersten Auswirkungen jüngst gemachter Fehler in Ordnung bringen, heizen in Europa die Massenmedien noch auf Grund von Vorstellungen von gestern d^s Generationsproblem an. In einer derartig überhitzten Atmosphäre sollte auf dem Bundesparteitag 1971 der „Generationssprung“ in der ÖVP stattfinden. Aber: Die jungen Löwen der Partei sprangen nicht. Es hätte an diesem 4. Juni 1971 nur eines Wortes, einer Geste von ihrer Seite bedurft, und sie wären an der Spitze und unter sich gewesen. Aber die Löwen brüllten nicht gut und sie sprangen nicht. Obwohl der junge Alois Mock bereits vorher im ÖAAB demonstriert hatte, wie das zugeht, wenn man vom Fleck weg den riskanten Sprung an die Spitze wagt.
Bescheidener Kredit
Ein Pferd, das in ungezügelter Hast die Hürde wirft, oder die Annahme der Hürde verweigert, macht das Rennen nicht John F. Kennedy schrieb, bevor er das hohe Amt annahm, das ihm den Tod des Politikers eintrug, ein Buch über den Mut in der Politik. Der Titel der deutschen Übersetzung des Buches heißt „Zivilcourage“. Im Falle der Zivilcourage handelt es sich in der Politik um die nicht allzuhäufige Fähigkeit, ein politisches Risiko mit Hirn und Herz zu erfassen, es zu akzeptieren und dann den Willen zu entwickeln, so damit fertig zu werden, daß der Sache ein möglichst großer Nutzen, jedenfalls aber der geringste Schaden erwächst.
Eine solche Courage mußten die Männer entwickeln, die 1945 die ÖVP ins Leben riefen: Eben erst dem Henker entronnen, konnten sie nach dem, was ihren Gesinnungsfreunden in den Volksdemokratien geschah, leicht abschätzen, was auch ihnen unter Umständen drohte. Sie saßen in einer Staatsregierung, in der die Macht zu zwei Dritteln in Händen der politischen Linken war, deren Fraktionen anfänglich unter sich engere Kontakte pflegte, bevor sie mit den „Schwarzen“ redeten. Die Courage, die 1971 für die Männer an der Spitze der ÖVP am Platz ist, ist von anderer Art: Von den fünf Parteiobmännem, die seit 1945 an die Spitze der ÖVP kamen, bekam anfänglich wohl keiner einen bescheideneren politischen Kredit mit als Schleinzer: Was bleibt denn anderes übrig, meinten die einen; die anderen kalkulierten, es sei unter den jetzigen Umständen die beste Lösung; wer war so nachsichtig und einsichtig wie Albert Einstein, der bekanntlich sagte, Persönlichkeiten würden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
In der ÖVP hat es sicher brillante Redner gegeben und Typen, die man jetzt Senkrechtstarter nennt. Hinter Schleinzer steht keine Pressuregroup, die ihn hinaufkatapultiert hat. Seine sprachliche Begabung ist, ein Problem in klaren Worten auszudrücken, den eigenen Standpunkt zu diesem Problem faßbar zu machen und mit dem Ausdruck des eigenen Willens für den Mitvollzug zu werben. Als Nachfolger Eduard Hartmanns im Landwirtschaftsministerium und im Widerspruch zu eingealterten agrarpolitischen Denkweisen mußte sich Schleinzer eine unabhängige politische Denkweise angewöhnen. Aus einer fast zehnjährigen Zugehörigkeit zur Bundesregierung bringt Schleinzer wohl auch jenes staatsmännische Profil mit, das gerade jetzt die Partei Figls und Raabs braucht, um nicht in einen vulgären Oppositionsstil zu versacken.
Was ist Anfang, was Ende in der ÖVP von heute? Die ausländischen Leser der internationalen politischen Zeitschrift „Christlich demokratisches Panorama“ werden nicht schlecht erstaunt gewesen sein, als sie unlängst in diesem Magazin der „Christdemokraten“ lesen mußten, es hätten auf dem Bundesparteitag 1971 der ÖVP nicht nur „personelle Weichenstellungen“ stattgefunden; vielmehr sei es im Zusammenhang damit zur „Absage an eine Tradition“ gekommen. Withalm, der in diesem Zusammenhang als der allerletzte einer langen Reihe von Lueger bis Klaus genannt wird, sei als „letzter Repräsentant des prononciert christlichen Lagers aus der Führung der ÖVP ausgeschieden“.
Entideologisierung?
Es soll hier nicht des langen von der „Entideologisierung“ und dem im Gegensatz dazu angekündigten Heraufkommen eines neuen „Zeitalters der Ideologie“ die Rede sein. Hätte sich besagtes Magazin nicht an seinen Österreichreporter gehalten, sondern an Schleinzer, dann würde es erfahren haben, daß die Ansichten des neugewählten Bundesparteiobmannes über die Grundsatzpolitik der Partei ganz andere sind als jene des Reporters. Das letzte, was man von Schleinzer erwarten kann, wäre eine Politik nach derlei apodiktischen Alternativen: Die Liberalen hinein, die Konservativen hinaus; die Jungen hinauf, die Alten hinunter; die Tradition in den Gully, die Revolution auf die Fahne; den Wirtschaftsliberalismus an die Spitze, die weltanschaulich-religiösen Motive für Sonntagsreden und Kommersphrasen. Für derartige Erwartungen gibt das im Entwurf vorliegende künftige Grundsatzprogramm der ÖVP, wie immer man über Einzelheiten urteilen mag, jedenfalls keinen Anlaß.
Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht Schleinzers Stil, Bruchstellen zu erzeugen; es geht ihm eher darum, über Bruchstellen zu einer neuen Mitte zu kommen. In dieser Hinsicht wild es der ÖVP nützen, daß er weder 1963 (anläßlich des damaligen Bundesparteitages in Klagenfurt) zusammen mit Klaus/ Withalm hinaufkam, noch sieben Jahre später zusammen mit dieser Ära ein politisches Ende erlebte. Wie immer die konkreten Gründe gewesen sein mögen, deretwegen sich damals Leopold Figl, Eduard Hartmann, Heinrich Drimmel und andere gegen Klaus und Withalm gestellt haben mögen — die drei Genannten waren jedenfalls keine vom Ehrgeiz zerfressenen Politiker, die wegen persönlicher Zwistigkeiten anders dachten. Drimmel, heute der einzige Überlebende der drei, hat nach 1963 nie in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, warum er auf dem damaligen Bundesparteitag seine bisherige politische Laufbahn aufs Spiel setzte. Withalm will keine politischen Memoiren schreiben, Klaus übergibt jetzt die seinen der Öffentlichkeit.
Klaus und Withalm haben sich zu ihrer Zeit um die Lösung des aktuellen Problems bemüht, das darin besteht, die Fittings , die Verbindungsstücke zwischen der Wissenschaft, der Politik und deren realpolitischer Anwendung zu finden. Der dazugehörige Idealtyp des Politikers ist wohl nicht gefunden. Als Agrarpolitiker erlebt Schleinzer die jetzigen geradezu revolutionären Veränderungen in der bisherigen Welt des Bauern. Er muß wissen, daß auch im Zeitalter des Computers nicht immer der Rechenstift der Weisheit letzter Schluß ist. Da aber anderseits der neue Bundesparteiobmann der ÖVP nicht gerade von Gefühlen geplagt wird, wird es ihm einigen Fleiß kosten, auch vor der Öffentlichkeit zu beweisen, daß er im Grunde kein bloßer Rationalisierungsfachmann ist, sondern ein Mensch, der Politik macht.
Eine Volkspartei muß vielerlei Fleisch an sich haben. Bereits in der Ersten Republik lehrte der damalige Obmann der Christlichsozialen Partei seine politischen Jünger, es könne nicht der Zweck einer Politik nach christlichen Grundsätzen sein, dem politischen Gegner die Erringung der politischen Mehrheit durch die Handhabung eines starren Integraiismus zu erleichtern. In diesem Sinne lehrte Ignaz Seipel die katholischen Konservativen das Verständnis für eine großzügige Liberalität: Für die freie Anwendung von Grundsätzen auf die
Veränderlichkeit des Lebens. Nur so kam es dazu, daß sich damals in Österreich viele Menschen für Seipel entschieden, die nach Herkunft und Anschauung weder konservativ noch katholisch waren. Denn: Nicht die Politik mit dem „politischen Bauchladen als Offert für jedermann“, also die politische Verwaschenheit, imponiert auf die Dauer, sondern: Erfolge, die aus erkennbaren persönlichen Überzeugungen und Haltungen des Politikers resultieren.
Weder der erste Generalsekretär der ÖVP, Felix Hundes, der seinerzeit ausdrücklich gegen die Gründung einer „katholischen“ oder „christlichen“ Partei war, noch Julius Raab, erfolgreichster Bundesparteiobmann der ÖVP, hatten etwas für Integraii- sten, katholische miteingeschlossen, übrig. Die Volkspartei sollte auf den Menschen, so wie er ist, reflektieren: als Angehöriger seiner Familie, seines Volkes, seiner Religion, seines Berufsstandes und nicht bloß auf ein spezifisches Zugehörigkeitsmerkmal.
Erst in den sechziger Jahren gewöhnten sich Spitzenpolitiker der ÖVP jene apodiktischen Erklärungen an, mit denen sie scharfe Trennungslinien zwischen Politik und Religion, Partei und religiösem Leben zogen. Sie unterschieden sich darin durchaus von Kreisky, der in solchen Fällen betont, er selbst sei Agnostiker, erwarte sich aber den Fortschritt der Welt von einem fortschrittlichen Sozialismus und einem fortschrittlichen Christentum. Im übrigen habe er hohen Respekt vor dem Erzbischof von Wien, den ja die Bundeshauptstadt zu ihrem Ehrenbürger machte. Diese Art von: take the best of it, die für die SPÖ unverbindlich, im Tenor aber verbindlich wirkt, kostet nicht viel; nur ihr Mangel ist kostspielig.
Die Tatsache, daß sich in der BRD Jungsozialisten so wie die Jugend in CDU/CSU und FDP auf ideologischer Basis neu formieren, um gegen die von „entideologisierten“ Vätern geleiteten Parteispitzen loszugehen, ist in der österreichischen Provinz noch kein moderner Begriff. Aber damit wird Schleinzer sich wohl erst nach dem 10. Oktober 1971 auseinandersetzen müssen.
Wo große Fragen enden, beginnen kleine Parteien. Was heute die Massenmedien und Massen interessiert, sind meist nicht die „großen Fragen“, sondern sogenannte heiße Eisen. Im Hinblick auf das künftige Grundsatzprogramm der ÖVP schreibt in der letzten Folge der „österreichischen Monatshefte“ einer ihrer früheren Politiker, es könne nicht darum gehen, heiße Eisen mit der bloßen Hand anzugreifen. Die Partei müßte mit ihrem Programm so etwas wie eine Zange in die Hand bekommen, mit der sie Eisen schmieden kann, solange es heiß ist: Probleme in Eigentums- und Besitzverhältnissen; Statusprobleme der jungen Menschen, der Frau, der Familie, des dritten Lebensalters; die Reform des Bildungs- und Erziehungswesens; neue Ideen in Europa und in der ganzen Welt.
Damit 1m Zusammenhang stehen Kritiken, wonach die ÖVP in jüngster Zeit in „großen Fragen“ (militärische Landesverteidigung, Straf- mentsreform usw.) weniger auf Grund eigener Modelle die nach ihrer begründeten Ansicht bessere Lösung zur Entscheidung gestellt hat, als vielmehr versuchte, die Unzulänglichkeiten ihrer Gegner zu retuschieren. Dieses Verhalten trug der ÖVP zum Teil ein Lob der Massenmedien ein, die im anderen Fall einen Versuch der ÖVP: Grundsatzpolitik des Gegners mit eigener Grundsatzpolitik zu begegnen, zweifellos als Versuch denunziert hätten, die „Versachlichung“ durch „rein politische oder weltanschauliche Einwände“ zu stören. Dieser Zustand in den Massenmedien ist nicht. zuletzt eine Folge dessen, was unlängst Franz Kreuzer (früher Chefredakteur der „Arbeiterzeitung“, jetzt „am Schalthebel der Nachrichtenpolitik des reformierten Fernsehens“) offen und klar feststellte: „Ich persönlich glaube, daß die Rundfunkreform tatsächlich der SPÖ genützt hat.“ Und: „Die ÖVP- Regierung (hat) durch die Rundfunkreform ein Opfer auf dem Altar des Vaterlandes gebracht.“
Diese beiden Sätze bezeichnen das, was für die ÖVP das Schicksal sein könnte. Denn wir leben in einer Zeit, in der die Ausdeutung der öffentlichen Meinung durch die Massenmedien viel vollständiger und wirkungsvoller Ist, als es das Parlament oder eine politische Partei jemals zustande brächten.
Das Programm eines Konzerts ist nicht das Konzert. Und die Wahlprogramme 1971 sind mit Sicherheit nicht das politische Konzept der siebziger Jahre. 1970 versprach die
ÖVP Fortschritt und Sicherheit, 1971 macht die SPÖ mit demselben Appell an jene auf, die „Sicherheit und Fortschritt“ wählen möchten. In bildlichen und textlichen Variationen werben alle Gruppen für die Sicherung der „drei letzten Dinge“, um die es dem modernen Menschen geht: Leben, Freiheit, Eigentum. Dem politischen Instinkt des Wählers, der noch zwischen Parolen wählen möchte, und seine Wahl nicht bereits vollzogen hat, sind also starke Ansprüche gestellt. Offenbar geht es aber nicht um die bloße Zielansprache, sondern um die Realisierung der Ziele, also um die Frage: Wer wird nach dem 10. Oktober 1971 dabei sein, wenn die Macht im Staate zur Erreichung dieser Ziele angewendet werden soll.
Es gab im politischen Leben Österreichs bis unlängst kein Wort, das abschätziger gebraucht worden wäre als das Wort Koalition. In diesem Sommer 1971 ist es anders geworden: Niemand, auch nicht die eisernen Typen, möchten nach dem 10. Oktober 1971 in das kräftigende „Stahlbad“ der Opposition steigen. Die FPÖ hat von dem Gebrauch dieses Bades genug. Und so wird dieses Bad nur mehr jenen zugedacht, mit denen sich niemand koalieren möchte: den Kommunisten. In dieser plötzlich modern gewordenen Vorliebe für die Möglichkeiten einer politischen Nachbadesaison im Koalitionsstil gibt es aber Unterschiede: Kreisky möchte am liebsten mit der SPÖ allein regieren. Die FPÖ bleibt der ein wenig platonischen Erklärung, sie werde ihre Äquidistanz zwischen SPÖ und ÖVP wahren (hoffend, daß sich nicht zu viele an ihr letztes Wahlversprechen erinnern, demzufolge sich nach dem 1. März 1970 ein sozialistischer Bundeskanzler wohl kaum hätte halten können). Schleinzer hat sich am Beginn der Wahlwerbung der ÖVP für moderne Formen der Zusammenarbeit und gegen die Methoden der in den sechziger Jahren erstarrten Koalition ausgesprochen. Es ist, wenn man will, das direkt an die SPÖ gerichtete Angebot, an die Partei also, die bisher die Tradition der „Großen Koalition“ hochgehalten hat. Nicht nur im Fall der Krise, sondern in einer auf Dauer abgestellten Staatspolitik ist diese Koalition Komplementärfaktor zur Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft. Koalition ist nicht mehr „out“, sondern „in“. Damit beginnt wohl die Wende des Jahres 1971.




































































































