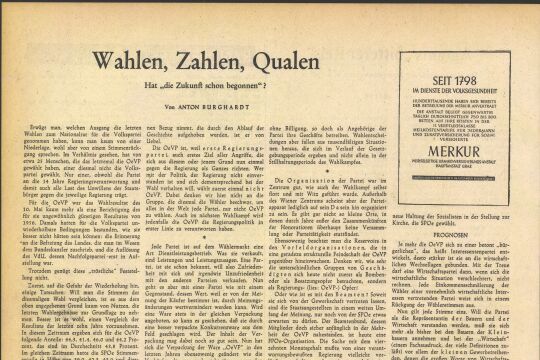Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Volkspartei heißt: Platz für alle
Die in letzter Zeit wieder aufgeflammte Diskussion über die organisatorische Struktur der österreichischen Volkspartei macht den Versuch notwendig, die Dinge wieder in das rechte Licht zu rücken, nicht zuletzt, um möglichen Fehlentscheidungen vorzubeugen. Damit aber kein Mißverständnis entsteht, sei an die Spitze dieser Überlegungen die Feststellung gesetzt, daß jede Partei, und damit auch die ÖVP, einer starken, einheitlichen Führung bedarf, deren Entscheidungen berufliche Sonderinteressen nachzuordnen sind. Unter diesem Aspekt — und nur unter diesem! — ist das folgende zu verstehen.
Die in letzter Zeit wieder aufgeflammte Diskussion über die organisatorische Struktur der österreichischen Volkspartei macht den Versuch notwendig, die Dinge wieder in das rechte Licht zu rücken, nicht zuletzt, um möglichen Fehlentscheidungen vorzubeugen. Damit aber kein Mißverständnis entsteht, sei an die Spitze dieser Überlegungen die Feststellung gesetzt, daß jede Partei, und damit auch die ÖVP, einer starken, einheitlichen Führung bedarf, deren Entscheidungen berufliche Sonderinteressen nachzuordnen sind. Unter diesem Aspekt — und nur unter diesem! — ist das folgende zu verstehen.
Wenn das Primat der Führung an der Spitze dieser Betrachtungen steht, ist sofort einmal zu klären, aus welchen Personen die Führung der ÖVP besteht. Sowohl das Parteiorganisationsstatut als auch das ganze Funktionieren der Partei geben auf diese Frage eine eindeutige Antwort Mit dem Bundesparteiobmann und dem Generalsekretär bilden die Obmänner der Bünde — jetzt heißt das „Teilorganisationen“ — gemeinsam die Parteispitze und die Entscheidungen dieses Führungsgremiums sind bisher in allen wichtigen Fragen einstimmig erfolgt, die Partei hat also in bedeutsamen Entscheidungen immer noch ihre Einheitlichkeit bewiesen. Daß das in der Art und Weise, wie es geschehen ist, stark vom jeweiligen Bundesparteiobmann beeinflußt wurde, ist selbstverständlich. Die Autorität Figls oder Raabs war unbestritten, doch gab es auch zwischen diesen beiden großen Persönlichkeiten der Geschichte der Zweiten Republik Unterschiede. Während ,es Figl möglich war, wichtigste Entscheidungen mit Zuhilfenahme seines unüberwindlichen Charmes herbeizuführen, war Raab der Mann der sogenannten „einsamen Beschlüsse“; eine Eigenschaft, die ihm allgemein zuerkannt wurde, obwohl auch dazu einiges zu sagen ist,
Julius Raab faßte seine Entschlüsse niemals, ohne vorher Leute, die zur Sache etwas auszusagen hatten, meist in persönlichen Gesprächen unter vier Augen, zu Rate zu ziehen. Erst nach Abwägung der Meinungen zuständiger Fachexperten traf er seine eigene Entscheidung, die allerdings nicht selten von den Vorschlägen derer, die er zu Rate gezogen hatte, abwichen. Daher die ihm zugeschriebene Eigenschaft eines Mannes mit „einsamen“ Entschlüssen.
Ganz anders war es unter der Parteiobmannschaft von Alfons Gorbach. Er war der Mann der Diskussion, der eine Sache so lange besprechen ließ, bis sich aus der Besprechung ein Resultat herauskristallisierte. Daß dieses diskussionsfreudige Verhalten Gorbachs manchmal auch Entscheidungen ungebührlich lange verzögerte, ergab sich aus der Natur der Sache. Als Beispiel ?ei auf die ein halbes Jahr dauernden Regierungsverhandlungen nach den Wahlen von 1962 verwiesen. Als es um die Besetzung des Außenministeriums ging, das die ÖVP für sich beanspruchte und als Franz Olah seinen vielzitierten Ausspruch tat, daß das Außenministerium zu Weihnachten nicht auf dem Christbaum der ÖVP hänge, wurde mein damaliger Ratschlag, diese Entscheidung der SPÖ zur Kenntnis zu nehmen, erst drei Monate später befolgt. Indessen aber verlor die ÖVP da und dort an Terrain, was bei einer raschen Ent-
Scheidung vermieden hätte werden können.
Wieder anders gestaltete sich die Praxis von Josef Klaus, dessen ausgeprägter Führungscharakter in dem Augenblick zu Schwierigkeiten führen mußte, als seine unbestrittenen Führungsqualitäten in einer Weise mit seinen engsten Mitarbeitern konfrontiert wurden, die den notwendigen Konsens sehr erschwerten.
Daß sich mit dem Wahlergebnis von 1970 die Führungsaufgaben der plötzlich in die Opposition gedrängten ÖVP besonders schwierig gestalteten, war nur selbstverständlich. Diese Situation hat die harte Aufgabe des neuen Parteiobmanns Hermann Withalm schwer belastet. Diese Zeit war eine typische Übergangsphase, die zur Parteiobmann-schaft Karl Schleinzers führte, der sich seinen Führungsstil erst aneignen mußte. Daß er von einem Höheren gerade zu einem Zeitpunkt abberufen wurde, da er sich Anerkennung und Autorität erworben hatte, kann nur als ein Schicksal bezeichnet werden, dem sich alle in Demut zu beugen haben.
Nun steht an der Spitze der Partei ein in jeder Beziehung neuer Mann, dem der erste angestrebte Erfolg, nämlich ein günstigerer Wahlausgang, einfach deshalb versagt blieb — man möchte beinahe sagen,' versagt bleiben mußte —, weil es eben nun einmal nicht möglich ist, in zehn Wochen die in der Demokratie notwendige Publizität aufzuholen, die ein Gegner mit 25jährigem Bekanntsein in der Öffentlichkeit voraus hat. Bei den nächsten Wahlen wird das ganz anders sein.
Nun ist die Frage zu stellen, ob die bündische Organisation der ÖVP auch künftig noch ihre Berechtigung haben wird. Diese Frage ist nicht schwer zu beantworten. Eine Partei, die eine Volkspartei sein will, muß in ihrer Organisation für alle Berufsgruppen Platz haben! Die Politik wird heute weithin von ökonomischen und sozialen Interessen beherrscht. Man sehe sich nur einmal die Bundesgesetzblätter der letzten 10 Jahre durch.
Überdies ist der konservative Teil der Bevölkerung — das gilt nicht nur für Österreich — weitaus weniger organisationsfreudig als der sozialistische. Das läßt sich aus historischen Gründen' erklären. Die Sozialdemokratische Partei begann schon gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts, ihre Organisation auf- und auszubauen, während die Christlichsoziale Partei — vielleicht abgesehen von der Ära Lueger — vornehmlich eine Wählerpartei gewesen ist, die auch in ihren besten Zeiten niemals so viele eingeschriebene Mitglieder hatte wie die Sozialdemokraten. Das erklärt sich auch aus dem Umstand, daß konservativ denkende Menschen mehr oder minder Individualisten sind, während in den sozialistischen Bewegungen das kollektive Denken immer einen breiten Raum eingenommen hat.
Stellen wir diese Fakten nun den organisatorischen Notwendigkeiten der Volkspartei gegenüber, so ergibt sich, daß bei den zur konservativen Gesinnungsgemeinschaft gehörenden Bevölkerungsgruppen die Bereitschaft zur Mitgliedschaft in eigenen beruflichen Interessensvertretungen weitaus stärker zu veranschlagen ist als die . Bereitschaft zur Mitgliedschaft bei einer politischen Parteiorganisation. Das waren auch die Beweggründe dafür, daß man 1945 aus der ÖVP keine organisatorische Nachfolgerin der Christlichsozialen Partei gemacht hat, sondern die bündische Gliederung wählte. Hier sei nur in Parenthese noch hinzugefügt, daß man auf den Namen „christlichsozial“ verzichtet hat, um auch der liberalen Bevölkerungsgruppe Zugang zu verschaffen.
Der Wunsch, aus der ÖVP eine Einheitspartei mit unmittelbarer Parteimitgliedschaft zu machen, ist allerdings seither nie verstummt. Aber solche Erwägungen gehen an der Tatsache vorbei, daß sich sehr viele ÖVP-Wähler in ihrem Bauernbund ihrem Wirtschaftsbund und ihrem Arbeiter- und Angestelltenbund w'ohler fühlen als im Rahmen einer Einheitspartei und daß die Umwandlung der ÖVP in eine solche ohne Zweifel zu einem hohen Mitgliederverlust führen müßte.
Es ist schon gesagt worden, daß heute die ökonomischen und sozialen Probleme in der Gesamtpolitik überwiegen. Wie sollte nun eine Partei überhaupt funktionieren, wenn ihre Konstruktion keinen entsprechenden Raum für diese Dinge hätte? Natürlich kann man auch der SPÖ nicht absprechen, daß sie neben der großen Mitgliederanzahl aus den Arbeitnehmerkreisen auch ihre berufsständischen Gruppierungen im Ar-beitsbauernbund und im Freien Wirtschaftsverband hat. Aber diese beiden Gruppen stellen nur unbedeutende Minderheiten dar und bedürfen daher keiner eigenständigen organisatorischen Aufgliederung der Gesamtpartei. Wenn bei den Bauern-kammerwahlen 91 Prozent für den österreichischen Bauembund und bei den Wirtschaftskammerwahlen 85 Prozent für die ÖVP-Listen stimmen, so ist das eben ganz etwas anderes, als wenn innerhalb der SPÖ nicht einmal 10 Prozent derartige Stimmen abgegeben werden. Die SPÖ ist daher nach wie vor eine Arbeitnehmerpartei, die ÖVP aber eine echte Volkspartei. Welche ernsthaften Gründe könnte es also wirklich geben, diese bewährte bündische Organisation der ÖVP zu zerschlagen?
Gar keine! Natürlich ist eine bündisch gegliederte Partei schwieriger zu führen als eine Einheitspartei, weil divergierende Interessen koordiniert werden müssen. Dieser Zwang zur Koordination unterschiedlicher Berufsinteressen fehlt der SPÖ im wesentlichen. Aber was schadet es einer Partei, wenn einmal hinter verschlossenen Türen lange diskutiert werden muß, ob und welche Milchpreiserhöhung notwendig geworden ist, oder in welchem wirtschaftlich erträglichen Ausmaß die Entwicklung der Sozialpolitik weitergetrieben werden kann. Hinter verschlossenen Türen, weil es bekannt ist, daß solche Diskussionen manchmal auch in aller Öffentlichkeit geführt werden, was absolut abträglich ist, denn dies bietet den Gegnern immer wieder Anlaß, von angeblichen Zerwürfnissen innerhalb der ÖVP zu reden, von Diskussionen, die in Wirklichkeit nur das ernste Bemühen darstellen, den nun einmal notwendigen Ausgleich divergierender Berufsinteressen herzustellen, i
Kehren wir zurück zu dem eingangs Festgestellten. Eine einheitliche und starke Führung der ÖVP ist eine unbedingte Voraussetzung für jeden erhofften zukünftigen Erfolg. Sie ist durch die Männer, die die Partei und ihre Bünde an die Spitze berufen hat, gewährleistet. Die Beweise für diese Behauptung werden nicht lange auf sich warten lassen. Aber die Bünde — pardon: Teilorganisationen — sind nun einmal das Fundament dieser österreichischen Volkspartei, und wer könnte ein Interesse daran haben, am Fundament zu rütteln?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!