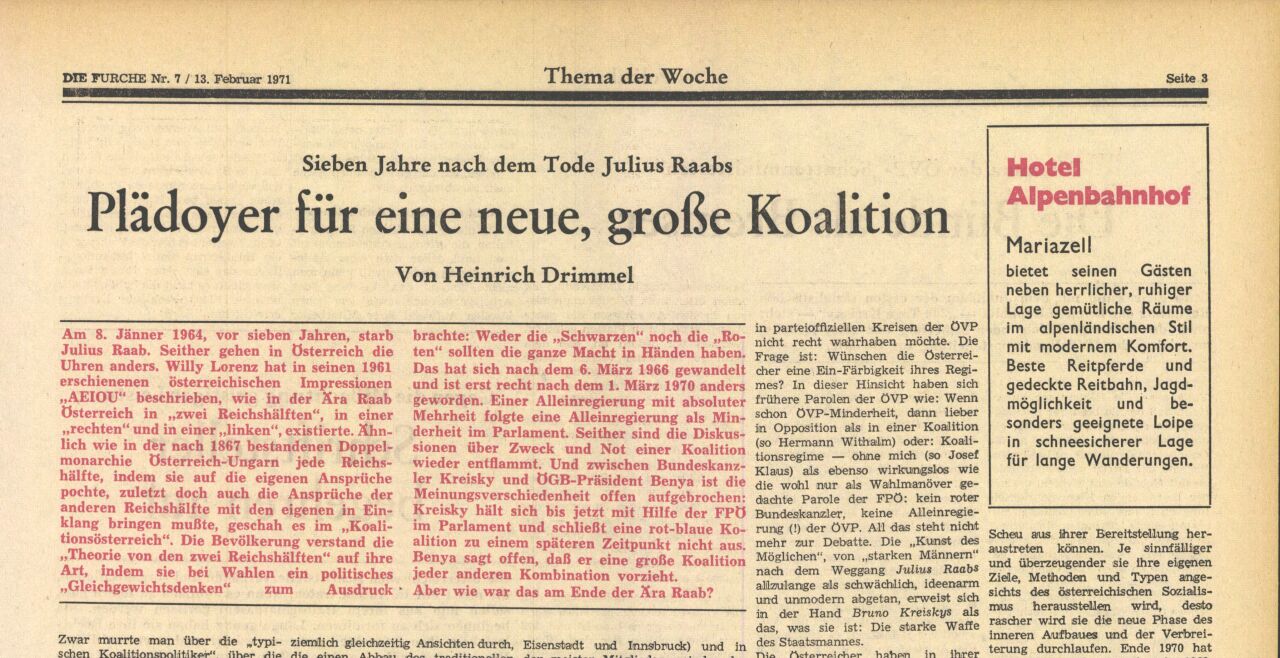
Plädoyer für eine neue, große Koalition
Am 8. Jänner 1964, vor sieben Jahren, starb Julius Raab. Seither gehen in Österreich die Uhren anders. Willy Lorenz hat in seinen 1961 erschienenen österreichischen Impressionen „AEIOU” beschrieben, wie in der Ära Raab Österreich in „zwei Reichshälften”, in einer „rechten” und in einer „linken”, existierte. Ähnlich wie in dter nach 1867 bestandenen Doppelmonarchie Österreich-Ungarn jede Reichshälfte, indem sie auf die eigenen Ansprüche pochte, zuletzt doch auch die Ansprüche der anderen Reichshälfte mit den eigenen in Einklang bringen mußte, geschah es im „Koalitionsösterreich”. Die Bevölkerung verstand die „Theorie von den zwei Reichshälften” auf ihre Art, indem sie bei Wahlen ein politisches „Gleichgewichtsdenken” zum Ausdruck brachte: Weder die „Schwarzen” noch die „Roten” sollten die ganze Macht in Händen haben. Das hat sich nach dem 6. März 1966 gewandelt und ist erst recht nach dem 1. März 1970 anders geworden. Einer Alleinregierung mit absoluter Mehrheit folgte eine Alleinregierung als Minderheit im Parlament. Seither sind die Diskussionen über Zweck und Not einer Koalition wieder entflammt. Und zwischen Bundeskanzler Kreisky und ÖGB-Präsident Benya ist die Meinungsverschiedenheit offen aufgebrochen: Kreisky hält sich bis jetzt mit Hilfe der FPÖ im Parlament und schließt eine rot-blaue Koalition zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus. Benya sagt offen, daß er eine große Koalition jeder anderen Kombination vorzieht. Aber wie war das am Ende der Ära Raab?
Am 8. Jänner 1964, vor sieben Jahren, starb Julius Raab. Seither gehen in Österreich die Uhren anders. Willy Lorenz hat in seinen 1961 erschienenen österreichischen Impressionen „AEIOU” beschrieben, wie in der Ära Raab Österreich in „zwei Reichshälften”, in einer „rechten” und in einer „linken”, existierte. Ähnlich wie in dter nach 1867 bestandenen Doppelmonarchie Österreich-Ungarn jede Reichshälfte, indem sie auf die eigenen Ansprüche pochte, zuletzt doch auch die Ansprüche der anderen Reichshälfte mit den eigenen in Einklang bringen mußte, geschah es im „Koalitionsösterreich”. Die Bevölkerung verstand die „Theorie von den zwei Reichshälften” auf ihre Art, indem sie bei Wahlen ein politisches „Gleichgewichtsdenken” zum Ausdruck brachte: Weder die „Schwarzen” noch die „Roten” sollten die ganze Macht in Händen haben. Das hat sich nach dem 6. März 1966 gewandelt und ist erst recht nach dem 1. März 1970 anders geworden. Einer Alleinregierung mit absoluter Mehrheit folgte eine Alleinregierung als Minderheit im Parlament. Seither sind die Diskussionen über Zweck und Not einer Koalition wieder entflammt. Und zwischen Bundeskanzler Kreisky und ÖGB-Präsident Benya ist die Meinungsverschiedenheit offen aufgebrochen: Kreisky hält sich bis jetzt mit Hilfe der FPÖ im Parlament und schließt eine rot-blaue Koalition zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus. Benya sagt offen, daß er eine große Koalition jeder anderen Kombination vorzieht. Aber wie war das am Ende der Ära Raab?
Zwar murrte man über die „typischen Koalitionspolitikei-”, über die Padder; über die altvaterischen Typen, die nur „nach dem Gespür” Politik machten; und über jene, die es nicht verstanden, errechenbare Ziele mit kalkulierten Methoden anzugehen. Und es kamen die „jungen Herren in der Politik”, wie sie Julius Raab zuweilen nannte, die nidit länger das „Halfter der Koalition über haben wollten”, die darauf aus waren, nur nach der eigenen Fasson — und nicht auf Grund von Kom-I>romissen mit den „anderen” — zu regieren. Solange aber Julius Raab und Adolf Sdiärf am Leben waren, hatte dieser Typus keine Chance.
Mehr als eimmad konnte nan anläßlich der Wahl eines Bundespräsidenten hören, es wäre für die RepuMik gar nicht gut, wenn nidit nur an der Spitze der Regierung, sondern auch an der, Spitze des Staates ein „Schwarzer” stünde. Dem Verfasser sind namentlich prominente Stammwähler der ÖVP in Erinnerung, die unbesdiadet fiirer bürgerlichen,
christlichen, konservativen und so weiter Herkunft und Anschauung den Einzug eines Gesinnungsfreundes Julius Raabs in das Präsidentenbüro des Amalientraktes ehr-licii fürchteten, weil sie meinten, die „anderen” würden nachher womöglich in der Zusammenarbeit zurückhaltender werden, wenn alle Spitzenpositionen der Republik in den Händen von ÖVP-Politikem wären.
Die Etappe Olah
Nach dem Ende der Kanzlerschaft Julius Raabs (1961) setzten sich in beiden Koalitionsparteien und ziemlicih gleichzeitig Ansicihten durch, die einen Abbau des traditionellen „Systems der starren Koalitionsbindungen” für notwendig erachteten. Einflüssa die teils aus dem Inland, teüs aus dem Ausland, seltener aus den Parteizentralen kamen, wurden maßgebend. Jeder Koalitionspartner sollte das Recht bekommen, im Kon-fliktsfa’U anstatt des Koalitionspartners die FPÖ zur Mehrheitsbildung im Parlament heranzuziehen. In der ÖVP redete man von den Vorteilen eines Manövrierens im „koalitionsfreien Raum”; die SPÖ fackelte nicht lange, sondern stimmte bei der nächsten passenden Gelegenheit mit Hilfe der FPÖ die ÖVP nieder (Frühjahr 1963).
Dieser Frühjahrstag des Jahres 1963 markiert die Startlinie für cüe letzte Etappe des 1949/50 begonnenen Mar-sdies der SPÖ zur Spitase, manche sagen: in ein sozialistisches Österreich. Der nacii einem neuerlichen Exzeß der politischen Exzentrik Franz Olahs zustande gekommene Wahlsieg der ÖVP vom
6. März 1966 (viele sprachen später von einem Pyrrhussieg) änderte nichts mehr an der Zielrichtung des Ganges der Ereignisse. Wer im Jahre 1971 von einem sozialistischen österreicii spricht, reciinet dazu: den Posten des Staatsoberhauptes, die absolute Mehrheit im Bimdesnat (mindestens bis 1973/74 haltbar), die relative Mehrheit im Nationalrat, die Alleinregierung im Bund; die Funktion des ersten Präsidenten in fünf (von neun) Landtagen und die absolute Mehrheit in drei Bundesländern, darunter Wien; den Posten des Bürgermeisters in allen Landeshauptstädten (außer
Eisenstadt und Innsbruck) und in den meisten Mitgliedsgemeinden des Städtebundes; die beträchtlichen Mandatsgewinne in Gemeinden mit bisher agrarischer Wohnbevölkerung usw. Konform mit dieser Verstärkung des Besitzes an politischen Mandaten und Positionen verlief der weitere Ausbau des „Festungsviereckes” finanziellwirtschaftlicher Besitzstände: erstens der Arbeiterbank, zweitens der Konsumgenossensciialt samt angeschlossenen Unternehmungen, drittens der Verlage und Druckereien, viertens des ÖGB als Sparbüchse der BAWAO. Während die „kapitalistiscihe” Volkspartei im Herbst 1970 gezwungen war, aus finanziellen Gründen ihr Zentralorgan, das „Volksblatt”, zu liquidieren, an Stelle lässig gewordener Förderer bei Mitgliedern und Mandataren ein Notopfer einzuheben und die Reform der Partei neuerdings auszurufen, bietet die Partei der „Proletarier” sdieinbar ein BMd finanzieller Leistungskraift, publizistischer
Durchschlagskraft und politisciier Schlagkraft.
Der Zug der FPÖ
Trotz des „Wahlerfolges in der Wende” (1. März 1970), bleibt die numerisciie Überlegenheit des österreichischen Sozialismus flach. Ohne die gekonnt ausgeführte Halblinks-ziehung der FPÖ wäre die erste Linksregierung in Österreich nicht in eine Balance gekommen. „Altväterische” Beurteiler der Laige glauben auch jetzt nocäi ein Gleichgewichtsdenken des Wählervolkes wahrzu-nelimen; allerdings eines, das man in parteioffiziellen Kreisen der ÖVP nicht recht wahrhaben möchte. Die Frage ist: Wünschen die Österreicher eine Ein-Färbigkeit ihres Regimes? In dieser Hinsicht haben sich frühere Parolen der ÖVP wie: Wenn sciion ÖVP-Minderheit, dann lieber in Opposition als in einer Koalition (so Hermann Withalm) oder: Koalitionsregime — ohne micih (so Josef Klaus) als ebenso wirlcungslos wie die wohl nur als Wahlmanöver gedachte Parole der FPÖ: kein roter Bundeskanzler, keine Alleinregierung (!) der ÖVP. All das steht niciit mehr zur Debatte. Die „Kunst des Möglichen”, von „starken Männern” nach dem Weggang Julius Raabs allzulange als schwächlicäi, ideenarm imd unmodern abgetan, erweist sich in der Hand Bruno Kreiskys als das, was sie ist: Die starke Waffe des Staatsmannes.
Die Österreicher haben in ihrer Mehrheit bisherige Experimente nach dem System einer Einparteienregierung ebensowenig ein für allemal akzeptiert wie sie das System der Mehrparteienregierang als abgetan betrachten. In der Krise des früheren Koalitionsregimes, die nacih dem Weggang Julius Raabs spürbar wurde, bekundete Bruno Pitfermann unverhohlen sein damals nicht eben populäres Interesse für das Mehrparteiensystem einer Regierung nach dem Muster der Schweiz anstatt der Konzepte für ein politisch einfarbiges Majorzsystem mit den damit verbimdenen dauernden Kämpfen um den Posten des Bundeskanzlers. Mehrparteienregierung, Koalition, Proi)orz usw. müssen niciit Zeichen einer „Demokratie in den Kinderschuhen” c>der einer. „Dekadenz der Demokratie” sein (wie die in den letzten Jahren .beharrlich, in. de? öffentlichen Meinung verbreitet wurde); als Bestandteile des schweizerischen Modells der Demokratie sind sie im Prinzip so gut demokra-
tisch wie Methoden der angelsächsischen Demokratie. In beiden Fällen ist Demokratie Sache kluger Köpfe und nicht grober Klötze.
Allparteienregierung?
Es kann jetzt für die ÖVP niciit einfach darum gehen, den Balanceakt der sozialistischen Minderheitsregie-runig zu Fall zu bringen. In der Partei rücken Kräfte in den Vordergrund, die durchaus imstande sind, die Strukturen, Formen und Punktionen der Partei neu zu erfassen, zu prägen und in Aktion zu bringen. Dies getan, wird die Partei olme
Sciieu aus ihrer Bereitstellung heraustreten können. Je sinnfälliger und überzeugender sie ihre eigenen Ziele, Methoden und Typen angesichts des österreichlscihen Sozialismus herausstellen wird, desto rasdier wird sie die neue Phase des inneren Aufbaues und der Verbreiterung durchlaufen. Ende 1970 hat Pittermann noch einmal, wie 1963, seine Reserviertheit gegenüber dem Experiment einer Einparteienregie-rung aufgezeigt Inzwischen hat audi ein anderer grand old man der österreichischen Innenpolitik, Josef Krai-ner, von einer All- oder Mehrpar-teienrcgierung auf Bundesebene gesprochen. Und es ist nicht einzusehen, warum das in sieben von neun Bundesländern auf Grund der Verfassung seit 50 Jahren praktizierte System einer All- oder Mehrparteienregierung ohne Opposition einer Großpartei nicht auch im Bund reciitens und praktikabel werden könnte.
„Unbewältigte Vergangenheit”
Schmal ist in Österreich die Zone eigener politischer Entscheidungen der Österreicher. Für den Staat in der Schüttzone einer nach wie vor geteUten Welt; für den Staat, dessen Fundament relativ neu ist; für den Staat einer Bevölkerung, in der eine „unbewältigte Vergangenheit” ebenso spürbar ist wie die unbewäl-tigten Aggressionen einer jungen Generation, die neuerdings drastische oder revolutionäre Methoden in den Sinn bekommen hat, ist das altehrwürdige Ritual des angelsächsischen Parlamentarismus aus dem
17. Jahrhundert, der grundsätzlich geforderte Widerstreit von Regierung und Opposition, politlscii kostspielig und eher bereits unergiebig. Zudem ist längst widerlegt, was lange Stehsatz war; nämlich, daß die Koalition aus 1945 nach dem Ende des Besatzungsregimes entbehrlich gewesen wäre. Einsichtigen Beobachtern ist längst klar geworden, daß die Erfolge des „Raab-Kamitz-Kurses” nicht möglich gewesen wären, wäre in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre das in der Ära Raab entwickelte Instrument der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft der Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht voll wirksam geworden. Dieses System der Partnerschaft brauciit, soll es nicht in eine Art korporative Wirtsciiaftsverfassunig abgleiten, eine Ergänzung und Kontrolle durch ein System der Kooperation m Parlament und Regierung.
Wir leben heute niciit mehr in den feudalen Oligarchien des 17. und des
18. Jahrhunderts, in denen eine hauchdünne Schicht der herrschenden Standesgenossen nach den blutigen Erfahrungen ihrer Machtkämpfe die zwischen ihnen auftretenden Interessenkollisionen lieber nach dem Majorzsystem als mit dem Schwert bereinigte. Dem Pluralismus des 20. Jahrhunderts nrut seinem tatsächlich vorhandenen politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Polyzentrismus entspricht der Interessenausgleich mit Hilfe eines fortentwickelten Systems der Partnerschaften. In dieser Hinsicht wird es wohl kein „rotes” und kein „sciiwarzes” und kein „Koali-tionsösterreicii” geben. Die Erziehung künftiger Generationen für die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Einigung im Sachlichen entsteht als der aktuelle Auftrag an die poli-tisciie Bildung.



































































































