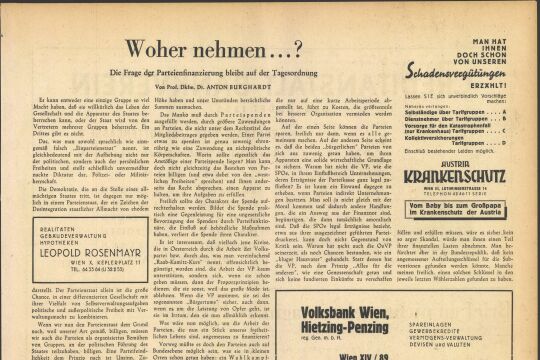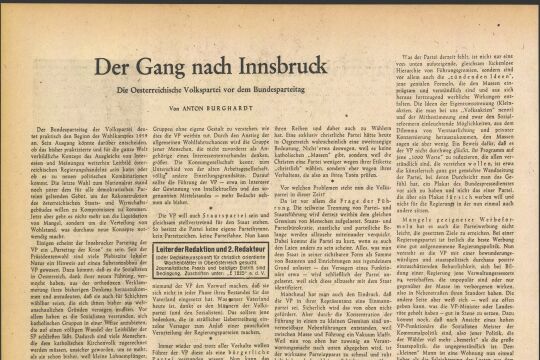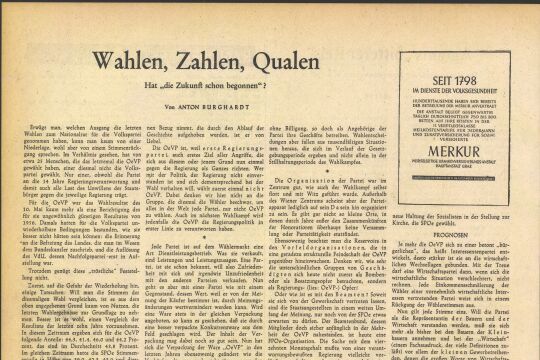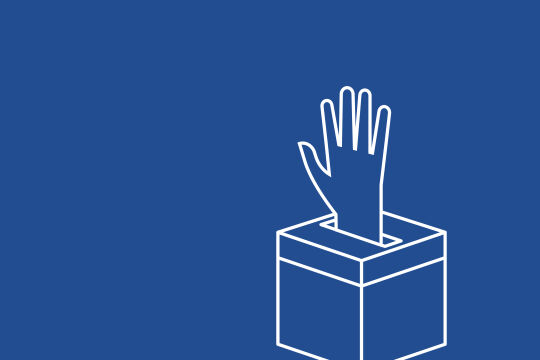Mit vernichtenden Vertrauenswerten haben Politiker aller Parteien - trotz Kuschelkurs der Regierung - zu kämpfen: Nur 20 Prozent der Bevölkerung halten Politik für wichtig. Demgemäß sind immer weniger Menschen bereit, sich aktiv am politischen Geschehen zu beteiligen. Neue systemische Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden.
Entgegen der landläufigen Meinung werden Politiker vor allem gewählt, weil sie mehr oder weniger glaubwürdig eine sichere Zukunft versprechen. Leistungsbilanzen machen bestenfalls ein Drittel der Wahlmotive aus. Zwei Drittel der Motive sind Absichtserklärungen, in Zukunft dieses und jenes so oder so und alles besonders gut zu machen. Für die Gestaltung der Zukunft des Gemeinwesens polis ist freilich eine Berufsgruppe bzw. Branche zuständig, welche sich in Anbetracht eines erschütternden Images selbst um ihren zukünftigen Bestand Sorgen machen sollte.
Rund 90 Prozent der Österreicher halten Familie und Freunde für einen wichtigen Lebensbereich, bis zu 80 Prozent sagen das von ihrer Arbeitswelt und Freizeit. Politik ist für 20 Prozent wichtig. Dahinter rangiert mit ähnlich dramatisch sinkenden Daten nur die Religion. Während man jedoch trefflich streiten kann, ob und inwiefern religiöse Überzeugungen unverzichtbar sind - Atheisten würden das bestreiten -, ist Politik nichts anderes als die zweifelsfrei nötige Gestaltung unseres Zusammenlebens.
Für die zuständigen Institutionen werden vernichtende Vertrauenswerte gemessen. Parteien, egal welcher Farbe, werden von einem Fünftel geschätzt, vier Fünftel haben eine eher negative Meinung. Fast jeder vertraut Feuerwehrleuten und Krankenschwestern, bei Politikern tut das höchstens jeder Zehnte. Paradox ist, dass wir somit denjenigen am wenigsten vertrauen, welche wir uns mittels Wahl aussuchen können. Blindes Vertrauen gegenüber Ärzten fällt - obwohl weiße Götter es genauso missbrauchen können - leichter als jedweder Vertrauensvorschuss gegenüber Politikern. Ein bisschen Kuschelkurs statt Dauerstreit wird kaum genügen, um das zu ändern. Wie sieht also die längerfristige Zukunft der Politik aus?
Potenzial für politische Rattenfänger
Eine Konstante in allen Studien sind ein Drittel mit der Demokratie Unzufriedene. Dabei handelt es sich weder um Möchtegern-Faschisten noch Nostalgie-Kommunisten, sondern bloß um das theoretische Potenzial für politische Rattenfänger. In einigen Jahren könnte allerdings Politik so aussehen, dass radikale Gruppen als bei Wahlen regelmäßig erstplatzierte Parteien diese Option nutzen. Der Grund dafür liegt in den Verschiebungen des Verhältnisses aktiver, passiver und latenter Öffentlichkeit.
Die aktive Öffentlichkeit als jener Teil der Bevölkerung, welcher sich regelmäßig und unmittelbar am Politikprozess beteiligt, wird kontinuierlich abnehmen. Schon jetzt haben sämtliche Parteien Rekrutierungsprobleme für Mitglieder, Mandatare und Amtsträger. Wenn jemand vor Zeugen gebeten wird, zu einer Partei zu gehen, gilt es im Freundeskreis beinahe als gesellschaftlich erwünschtes Verhalten, den Zeigefinger zur Stirn zu führen. Nichtregierungsorganisationen sind gleichermaßen mit einer Erosion ihres sozialen Kapitals konfrontiert, weil das Engagement abnimmt.
Passive Öffentlichkeit
Zwar ist es durchaus normal und geradezu notwendig, dass nicht absolut jeder ständig politisch aktiv ist und eine Partei gründen will, für Wahlen kandidiert und/oder Aktivist für Volksbegehren ist. Eine hochmoderne und komplexe Gesellschaft wäre da gar nicht organisierbar. Im Regelfall gehört die Mehrheit zur passiven Öffentlichkeit, welche in unterschiedlicher Prozentzahl an Wahlen teilnimmt und sich ansonsten weniger als eine Stunde in der Woche gedanklich mit Politik beschäftigt. Zusätzlich gibt es eine latente - im Politsinn nicht existierende - Öffentlichkeit, welche den noch so indirekten Bezug zu (demokratischen) Entscheidungen der Politik total verweigert.
Das Problem ist daher nicht allein der steigende Prozentsatz passiver und latenter Öffentlichkeit, sondern die mangelnde Durchlässigkeit zwischen den Gruppen. Es findet lediglich eine Wanderung von ehemals aktiven Personen zur Gruppe der Passiven statt, umgekehrt tut sich nichts. Genauso sind immer mehr Latente gar nicht politisch reintegrierbar, sei es aus sozialen, ethnisch-religiösen, sprachlichen oder anderen Gründen. Irgendwann wird die aktive Gruppe so klein und derart verfestigt sein, dass Politik nichts mehr mit Demokratiequalität zu tun hat.
Die Mediendemokratie reagiert darauf mit immer schrilleren Inszenierungen. Das mag, siehe die hohe Wahlbeteiligung nach einer gigantischen Werbeschlacht in der Kärntner Landtagswahl, Parteien im politischen Wettbewerb helfen. Demokratiepolitisch vergrößert sich in Wahrheit die Distanz zwischen Volksvertretern und Volk oder beschränkt sich auf eine inhaltsleere Kommunikation von Wahlkampfslogans der Politiker versus Negativklischees der Bürger. Politik versucht nicht mehr ihre Inhalte zu vermitteln. Eigenständige Meinungsbildungen und Partizipation gelten als unerwünscht, die soziale Kompetenz geht verloren.
Mehrheitswahlrecht & Direktdemokratie
Ein Lösungsansatz wäre es, systemische Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine Annäherung der Öffentlichkeitsgruppen zu fördern. Zu den Möglichkeiten zählen ein mehr personenbezogenes (Mehrheits-)Wahlrecht, mehr Direktdemokratie - etwa als verpflichtende Volksabstimmungen ab einer Unterschriftenzahl von zehn Prozent der Wahlberechtigten - alternative Formen der Interessenvertretung ohne realpolitische Verflechtung von Parteien und Kammern sowie ein Selbstverständnis der Politiker als Treuhänder der Interessen ihrer Wählerschaft und nicht als Parteidelegierte.
Apropos Parteien: Weil eine Umgestaltung des politischen Systems in "Parteienstaaten" Machtverlust bedeutet, werden sich diese nicht quasi selbst abschaffen. Es sei denn, etablierte Parteien akzeptieren ihre relative Schwächung als mittelfristig notwendig, um nicht langfristig noch mehr zu verlieren. Man gibt einen Teil der Macht absichtlich auf bzw. an die demokratische Zivilgesellschaft ab, um nicht wirklich demokratische Basisbewegungen im Populismusstil zu verhindern.
Eine Pseudolösung der zukünftigen Politik wäre es, Planungssicherheit dadurch zu schaffen, indem aufwändige Demokratieprozesse und individuelle Freiheiten reduziert werden. Das ist selbstverständlich abzulehnen. Nichtsdestoweniger stellt sich die Frage, ob in einer hochgradig verunsicherten Gesellschaft - vergleichbar mit den dreißiger Jahren in Deutschland - entsprechende Parolen nicht zwangsläufig auf fruchtbaren Boden fallen. Einfachheit und Vereinfachung befriedigen das Bedürfnis nach Sofortlösungen.
Logischer und weniger einfach wäre es für eine Politik der Zukunft, zunächst die Frage zu klären, welche Bedürfnisse wir wirklich haben (sollen) und wie diese politisch erreichbar sind. Es ist vom Luxusdenken der Konsumgesellschaft bis zur Neiddebatte in der Wirtschaftskrise eine unkontrollierbare Eigendynamik des Wollens entstanden, die Steuerungsaufgaben der Politik unterminiert. Zum Glück geht es umgekehrt in Europa für die Bevölkerungsmehrheit auch nicht darum, durch Nahrung, Kleidung und Wohnen nur elementarste Bedürfnisse zu befriedigen. Politik der Zukunft bräuchte einen Grundkonsens, welche zusätzlichen Wünsche und Erwartungen wir an sie haben.
Anderes (Selbst-)Verständnis nötig
Besteht ein solcher Konsens, könnte es zu einem inhaltlichen Ideenwettbewerb politischer Akteure kommen, wie eine Zielerreichung erfolgen kann. Schaumschläger würden sich disqualifizieren. Die Politik könnte ihr Negativimage ablegen, da sie sich ja grosso modo für allgemein anerkannte Bedürfnisse einsetzt. Rot-schwarz-blau-orange-grüne Schafe sind keine Katastrophe, weil Einzelfälle - während gegenwärtig der Politik generell abgesprochen wird, sich für gemeinsame Ziele einzusetzen.
Daher müsste die Politik ihr Selbstverständnis ändern und wir unser Verständnis von Politik. Ob das funktioniert, ist sehr zweifelhaft. Die Politik der Zukunft leidet nämlich unter der gesellschaftlichen Komplexität. Diese ist derart groß, dass nicht einmal Probleme und ihre Ursachen sowie Folgen - und schon gar nicht persönliche Betroffenheiten - vermittelt werden können. Mit anderen Worten: Die jetzige und zukünftige Politik hat etwas zu gestalten, von dem sie nicht einmal weiß, was und wie es ist.
* Peter Filzmaier ist Politikwissenschafter sowie Leiter des Departments Politische Kommunikation an der Donau-Universität Krems und geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Strategieanalysen (ISA) in Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!