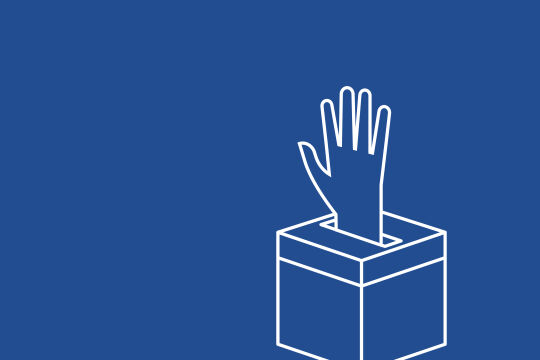Kaum eine Diskussion zur Krise der Demokratie kommt am Schreckgespenst Populismus vorbei. Doch Populismus ist nur das Symptom für die eigentliche Verfehlung unseres politischen Systems: Elitismus. Sämtliche populistische Parteien und Bewegungen reagieren auf die Auszehrung der repräsentativen Demokratie und machen sich den Wunsch nach "echter Demokratie" und tatsächlicher Entscheidungsmacht (sinnbildlich der Brexit-Slogan "Take back control") für ihre Agenden zunutze. Das diffuse Gefühl des Kontrollverlustes beruht auf der Verlagerung politischer Gestaltungsspielräume auf die supranationale Ebene, ohne dort ähnlich demokratische Einflussnahme eröffnet zu haben, wie man sie im souveränen Nationalstaat wenigstens ansatzweise kannte. Hinzu kommt die weitgehend ungeregelte Macht multinationaler Konzerne auf Basis eines globalen Finanzkapitalismus, wodurch grundlegende Gesellschaftsfragen aus dem Bereich des gemeinsam Verhandel- und Entscheidbaren ausgenommen und einer kleinen Elite übertragen sind.
Die eigenen Belange im Blick
Diese Elite hat mangels ausreichender Checks and Balances vorrangig ihre eigenen Belange im Blick. Dadurch nimmt der egalitäre Kern eines demokratischen Systems, der nach der gleichen Beteiligung und Berücksichtigung aller Bürger verlangt, Schaden. Die Auswirkungen solcher Politik zeigen sich vor allem in steigender sozioökonomischer Ungleichheit und gesellschaftlichen Spannungen, was letztlich das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit der Demokratie mindert und Populisten Zulauf beschert. Das hat sowohl Konsequenzen für das politische Koordinatensystem, das sich durch die Polarisierung der Parteienlandschaft verschiebt, als auch auf die politische Beteiligung selbst.
Jene Wirkungskette von Elitismus, Politikverdrossenheit, wachsender Ungleichheit und Populismus lässt sich mittlerweile auch hierzulande nachvollziehen: Seit dem Ende der Wahlpflicht 1992 bleibt stets ein Fünftel bis zu einem Viertel der Wahlberechtigten den Nationalratswahlen fern. Jüngste Landtagswahlen zeigen eine noch deutlich geringere Beteiligung (Salzburg 65 %, Niederösterreich 67 %, Kärnten 69 %). Neben grundsätzlichen Fragen der Legitimation ist vor allem problematisch, dass die Nichtwähler gesellschaftlich nicht gleich verteilt sind, sondern mehrheitlich ressourcenarmen Schichten (in Bezug auf Haushaltsvermögen und Bildungsabschluss) entstammen.
Nun mag man einwenden, dass deren politischer Rückzug freiwillig erfolgt, doch dies verkennt die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Menschen sind soziale Wesen, die sich mit anderen vergleichen; nicht allein die Höhe der individuell verfügbaren Ressourcen beeinträchtigt die politische Beteiligungsneigung, sondern vielmehr deren Verteilung innerhalb der Wählerschaft. Schlechtergestellte beobachten demnach die wachsende Ungleichheit und meinen, "die da oben" würden sich ohnehin nur um ihresgleichen kümmern, also wäre es sinnlos, überhaupt an deren politischen Verständigungsinstrumenten mitzuwirken.
Eine dieser Tage erschienene Langzeitanalyse der Gesetzgebung neun europäischer Staaten zeigt, dass eine höhere gesellschaftliche Ungleichheit nicht nur eine ungleiche Wahlbeteiligung nach sich zieht, sondern sich dadurch konkret auf die Politikgestaltung auswirkt. Denn die Gesetzgebung orientiert sich dann vermehrt an den ökonomischen Eliten und lenkt ihren Fokus auf jene Politikbereiche, die deren Wohlstand weiter absichern beziehungsweise die Interessen der übrigen Wählerschaft ablenken: auf Sicherheitspolitik und Migration.
Wie wir aus der Beteiligungsforschung wissen, sind es nicht die Ärmsten und am schlechtesten Ausgebildeten, die populistische und extreme Parteien wählen; denn sie partizipieren kaum und haben sich aus der Politik weitgehend verabschiedet. Es ist vielmehr einerseits eine sozioökonomisch in Bedrängnis geratene Mittelschicht und andererseits eine auf Absicherung ihrer Stellung bedachte Wirtschaftselite, die jene Parteien wählt beziehungsweise finanziell unterstützt. Will man die Demokratie retten, gilt es deshalb nicht in erster Linie, dem Populismus beizukommen, sondern man muss einen Schritt früher ansetzen und Institutionen schaffen, die dem Elitismus Einhalt gebieten. Denn die Demokratie lebt von Freiheit und Gleichheit.
Auf jener Grundlage des demokratischen Ideals der Gleichheit kamen in den vergangenen Jahren weltweit vermehrt Bürgerräte per Losprinzip zum Einsatz. Mittels qualifizierter Zufallsauswahl bilden sie die Bevölkerung ab. Auf diese Weise sollen Menschen an der Politik beteiligt werden, die sonst ungehört bleiben. Dieses Instrument der partizipativen Demokratie tritt allerdings nicht in Konkurrenz zur repräsentativen Demokratie, sondern soll sie vielmehr stärken, indem sie deren Repräsentativität erhöht.
Vorbild Irland
Am bekanntesten ist wohl die irische Citizens' Assembly: Die Institutionen der Republik Irland hatten durch die Finanzkrise 2008 bei vielen Bürgern einen immensen Vertrauensverlust erlitten. Man machte zurecht die politische Elite für das Debakel verantwortlich. Als vertrauensbildende Maßnahme trat diese die Flucht in die Demokratie an und entschloss sich zu einem Experiment, das zuvor nur Historiker der attischen Polis kannten. Durch das Los ermittelte Bürger sollten über Zukunftsfragen entscheiden. Die so zusammengewürfelte Assembly bildete eine ausgewogene Mischung von Altersgruppen, Bildungshintergrund und sozioökonomischer Stellung, verwirklichte Geschlechterparität, berücksichtigte Migrationshintergrund und regionale Diversität. An mehreren Wochenenden trat sie unter Begleitung eines Moderatorenteams zu Beratungen und Experten-Hearings zusammen und gab Politikempfehlungen an die Regierung ab. Wie nachfolgende Untersuchungen zeigten, erhöhte die Einbeziehung gewöhnlicher Bürger in den Gesetzgebungsprozess sowie das transparente Verfahren das Vertrauen aller Einwohner Irlands in die Politik.
Warum nicht auch im Bund?
Was Irland auf nationalstaatlicher Ebene unternahm, kennt Österreich nur im Kleinen: Die Vorarlberger Landesregierung organisiert mehrmals pro Jahr ein-bis zweitägige Bürgerräte als partizipative Ergänzung der repräsentativen Demokratie. Dieses Instrument kann mittels 1.000 Unterschriften auch von den Bürgern selbst initiiert werden. An Bürgerräten teilnahmeberechtigt sind alle in Vorarlberg wohnhaften Menschen, die per Zufallsauswahl aus dem Melderegister eingeladen werden. Dem Losverfahren kommt hierbei die Aufgabe zu, das politische Amt des Beraters beziehungsweise der Beraterin auf Zeit zu vergeben, im Grunde den politischen Lobbyismus zu demokratisieren.
Warum sollte es nicht auch auf Bundesebene möglich sein, eine beratende Bürgerversammlung nach diesem Vorbild abzuhalten? Es gibt genügend drängende Zukunftsfragen, die bislang unbeantwortet sind. Wie Irland und Vorarlberg zeigen, sind gewöhnliche Bürger -da sie nicht einer Partei verantwortlich sind -imstande, Systemblockaden zu überwinden und populistisch aufgeladene Themen sachlich zu diskutieren, wenn man ihnen nur den richtigen Rahmen bietet. Für die europäische Ebene wurde unlängst die Idee eingebracht, eine transnational geloste Bürgerversammlung als zweite Kammer des EU-Parlaments zu konstituieren. Ich kann darüber hinaus vor allem dem Gedanken eines neuen EU-Verfassungskonvents, dem auch zugeloste Bürger angehören, einiges abgewinnen.
Die Demokratisierung muss jedenfalls auf allen Ebenen erfolgen und das Ideal der Gleichheit betonen. Denn wer mitmachen und mitentscheiden kann, erlebt sich als selbstwirksamen, politisch nicht fremdbestimmten Menschen und hat viel weniger Anlass, bei Wahlen Denkzettel zu verteilen und populistische Heilsversprecher zu wählen, die gegen "Brüssel" und gegen "die da oben" wettern. Das Los bringt zudem die Sichtweise jener wieder in den politischen Prozess, die diesen schon aufgegeben hatten und sich nicht mehr repräsentiert sahen. Jene Gleichheit im Formalen wird sich schließlich auch in den Politikinhalten widerspiegeln.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!