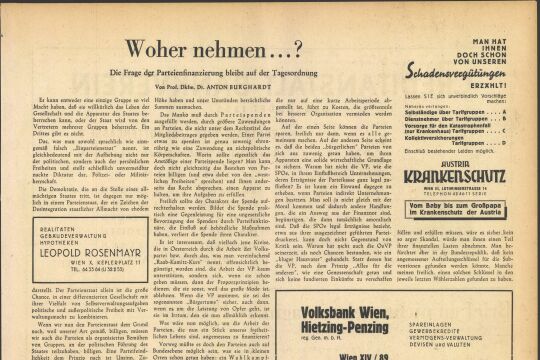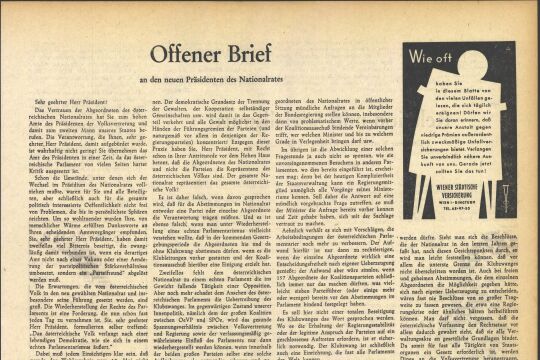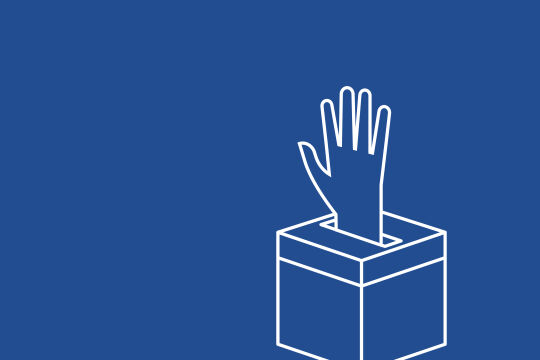Direkte Demokratie hat Hochkunjunktur in Österreich: Ein Sozial-Volksbegehren startet, eine Volksabstimmung zur EU-Erweiterung droht, ein Volksbegehren gegen Temelin steht vielleicht auch noch an. Ist Österreich also ein Hort direkter Demokratie? Eher nicht. Warum, das lesen Sie im Dossier.
Dass Demokratie die Herrschaft des Volkes ist, ist ebenso eine unzureichende Halbwahrheit wie die Gleichsetzung von Demokratie mit Mehrheitsherrschaft. Zur Demokratie gehört ebenso der Respekt vor den Rechten der Minderheit und die Garantie der Grundrechte für jeden Menschen.
Damit ist schon eine Grenze für die direkte Demokratie aufgezeigt: Es ist zum Beispiel ganz bestimmt nicht mit den Prinzipien der Demokratie vereinbar, wenn darüber abgestimmt werden soll, ob Menschen einer bestimmten Haar- oder Hautfarbe das Stimmrecht besitzen sollen. Es ist aber sehr wohl mit den Prinzipien der Demokratie vereinbar, wenn über einen eventuellen Beitritt Österreichs zur Nato in Form einer Volksabstimmung entschieden werden soll.
Demokratie bedeutet, plebiszitäre (also direkt demokratische) mit repräsentativen (also indirekt demokratischen) Elementen zu verbinden. Wie diese Kombination konkret aussehen kann und soll, das hängt von den Erfahrungen ab, die eine bestimmte Gesellschaft mit der Demokratie gemacht hat: In der Schweiz wird ungewöhnlich viel dem Bundesvolk zur unmittelbaren Entscheidung übergeben; in Deutschland gibt es, auf der Bundesebene, überhaupt keine Möglichkeit der Direktentscheidung durch die Wählerinnen und Wähler. In den USA haben manche Bundesstaaten - Kalifornien etwa - ein hohes Maß an direkter Demokratie entwickelt. Auf der Ebene der Union beschränkt sich aber die unmittelbare Mitsprache der Wählerinnen und Wähler auf die Wahl der Mitglieder des Repräsentantenhauses - nicht einmal die Wahl des Präsidenten ist, wie im November 2000 in Erinnerung gerufen wurde, eine Direktwahl. Eine "Volksabstimmung" gibt es in den USA auf der Ebene des Bundes schon gar nicht.
Die Entwicklung steht nicht still. In einigen Ländern, wie etwa in Italien, hat in den letzten 30 Jahren die Zahl der plebiszitären Entscheidungen zugenommen; in Frankreich sind Volksabstimmungen nach de Gaulle hingegen sehr selten geworden. Großbritannien, das klassische Land der Repräsentativdemokratie, hat unter Labour-Regierungen eine gewisse Neigung zu Plebisziten entwickelt - in Fragen der "devolution", also der Autonomie von Schottland und Wales, aber auch des Verhältnisses zur Europäischen Union.
Was in der Schweiz offenkundig für gut befunden wird, muss noch lange nicht gut für Deutschland sein; und was dem britischen Demokratieverständnis vor 50 Jahren entsprochen hat, muss mit dem heute herrschenden Verständnis nicht mehr übereinstimmen. Die Forderung nach (mehr) direkter Demokratie ist - für sich genommen - also weder der Ruf nach der einzig wahren Form von Demokratie; noch bedeutet er, dass damit der Parlamentarismus zerstört werden soll.
Der Wunsch, mehr Entscheidungen dem Wechselspiel von Regierung und Opposition im Parlament zu entziehen und direkt den Wählerinnen und Wählern vorzulegen, ist im Zusammenhang mit bestimmten Rahmenbedingungen zu sehen:
* Rückgang des Parteienstaates: Da immer mehr Menschen sich nicht von vornherein einer Partei (einem "Lager") verpflichtet fühlen, sind direkt demokratische Entscheidungen immer weniger vorhersehbar - anders als Entscheidungen im Parlament, wo die jeweils regierende Mehrheit unter Nutzung einer ausgeprägten Fraktionsdisziplin mit einer extrem hohen Berechenbarkeit die Entscheidungen bestimmt. Wer immer im Parlament zu unterliegen droht, wird daher nach einer Befragung "des Volkes" rufen.
* Kalkül der Opposition: Der Ruf nach Volksabstimmungen und die Nutzung des Instruments des Volksbegehrens ist eine Taktik, die im logischen Interesse der Opposition liegt. Die meisten Volksbegehren der letzten 25 Jahren wurden in engem Naheverhältnis mit Oppositionsparteien formuliert. Dass die FPÖ trotz ihrer Rolle als Regierungspartei in manchen Fragen auf direkt demokratische Entscheidungen drängt, demonstriert eine gewisse Rollenunsicherheit; oder zeigt, dass ein Teil der Partei nicht voll mit dem Regierungsteam harmoniert.
* Personalisierung der Politik: Plebiszite müssen letztlich auf ein "Ja - Nein" zugespitzt werden. Sie entsprechen damit einer Neigung zur Vereinfachung. Diese Tendenz, der Komplexität der Politik zu entfliehen, entspricht dem Trend zur Personalisierung. Nicht mehr ein breiter Kreis von Personen findet - arbeitsteilig - zu vielschichtigen Entscheidungen, sondern der "leader" kommuniziert direkt mit "dem Volk". Zwischeninstanzen - Parteien, Verbände, Parlamente - sind in diesem Wechselspiel von Personalisierung und Einsatz direkter Demokratie die eindeutigen Verlierer.
Deshalb passt der Populismus als Stil besonders gut zur Neigung, sich nicht nur auf das "Volk" zu berufen, sondern das "Volk" immer häufiger zur unmittelbar entscheidenden Instanz zu machen. Dabei ist Populismus keineswegs ein Vorrecht derer, die - oft sehr unscharf - als "Rechtspopulisten" gelten. Es gibt nicht nur einen Populismus der FPÖ, sondern auch einen - freilich zumeist mit anderen Inhalten versehenen - Populismus der Linken.
Wenn von bestimmten Parteien und Personen, aber auch Medien allzu oft der Ruf nach einer Volksabstimmung oder einer Volksbefragung erhoben wird, dann zeigt dies auch, dass die Verantwortung der Entscheidungsträger - also der regierenden Parlamentsmehrheit - nicht sehr ernst genommen wird. Die Parteien haben durch die Technik der Meinungsbefragung ohnehin ein Instrument, sich über die Stimmungslage in der Gesellschaft ein Bild zu machen. Wenn sie dennoch immer wieder nicht selbst entscheiden wollen, so kommen sie in Gefahr, sich selbst überflüssig zu machen.
Nach einem Wortspiel von Ernst Fraenkel ist die plebiszitäre Komponente in der Demokratie ein Mittel, die Karpfen - die Parteien - nicht allzu träge werden zu lassen. Die Parteien brauchen, ebenso wie die Sozialpartner, ein Stück direkte Demokratie als Korrektiv. Der Hecht im Karpfenteich braucht aber auch die Karpfen - keine Demokratie ohne die Einrichtungen der Volksvertretung, also insbesondere der Parteien und Parlamente.
Der Autor ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!